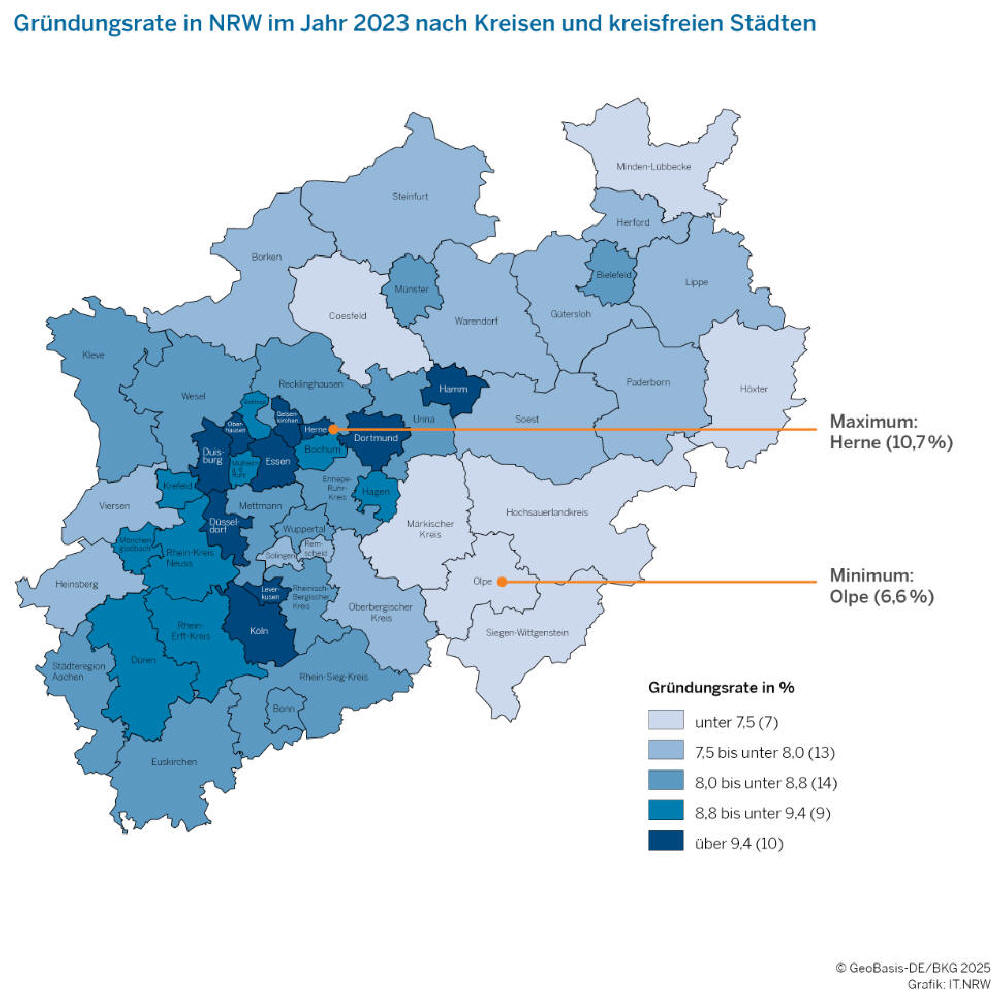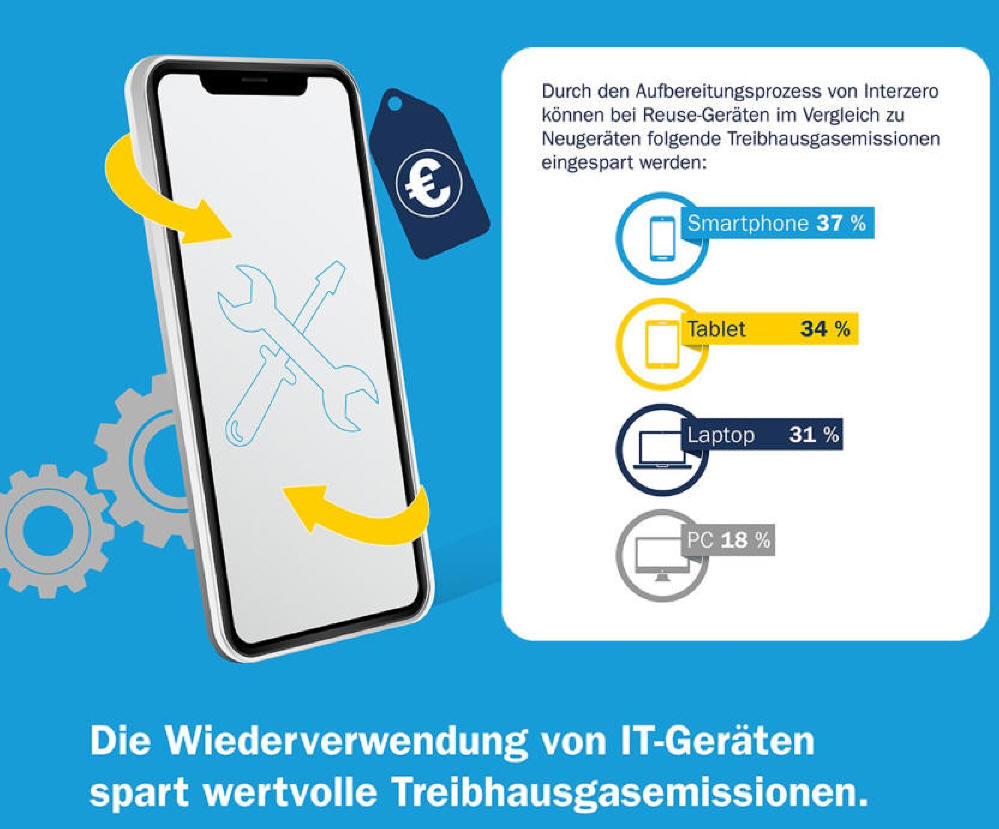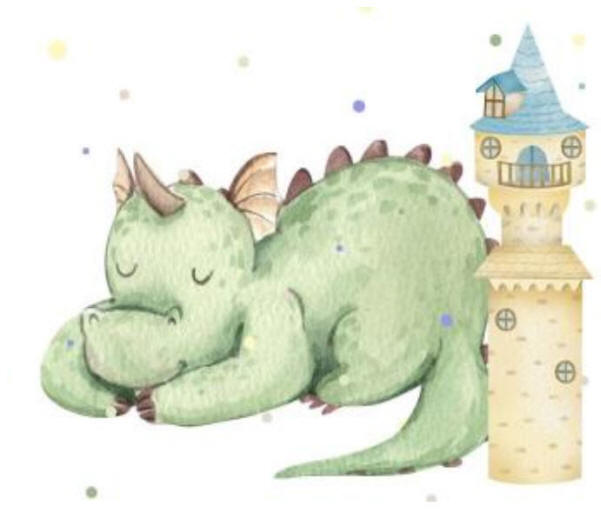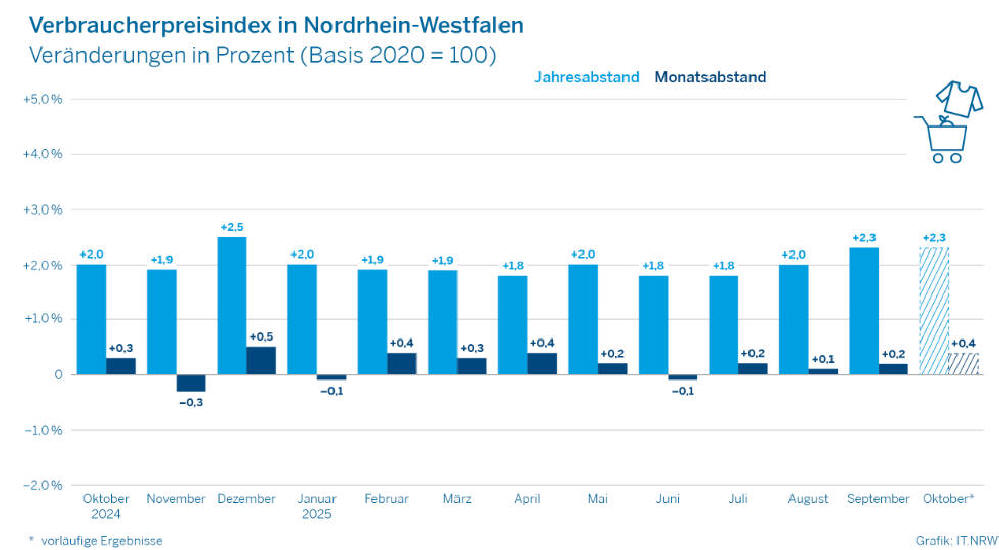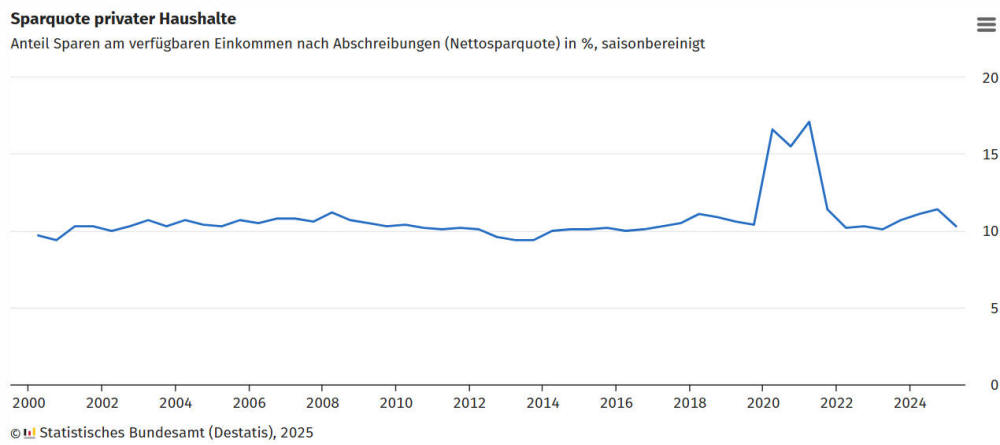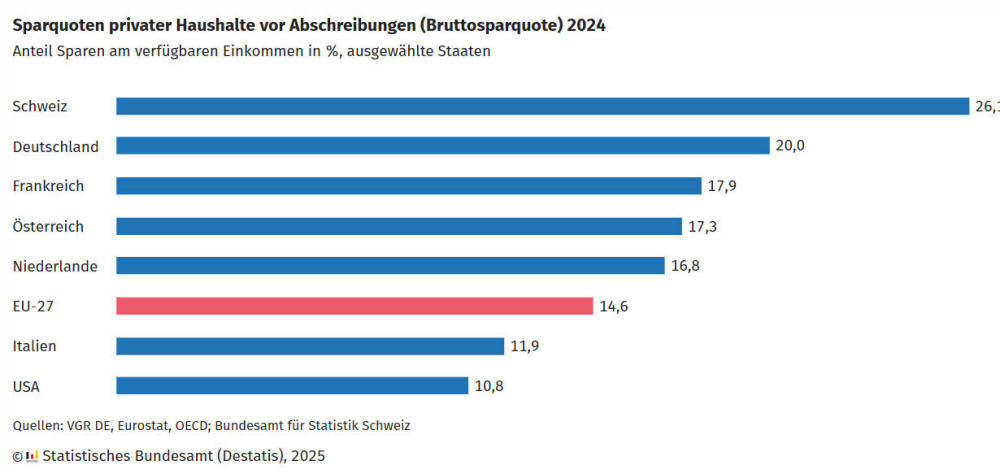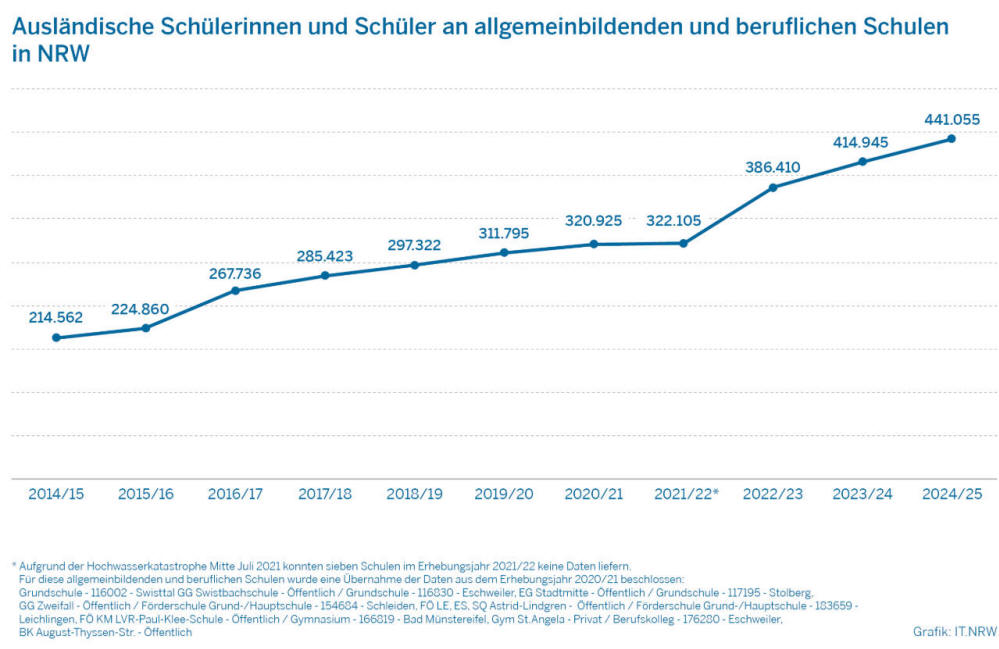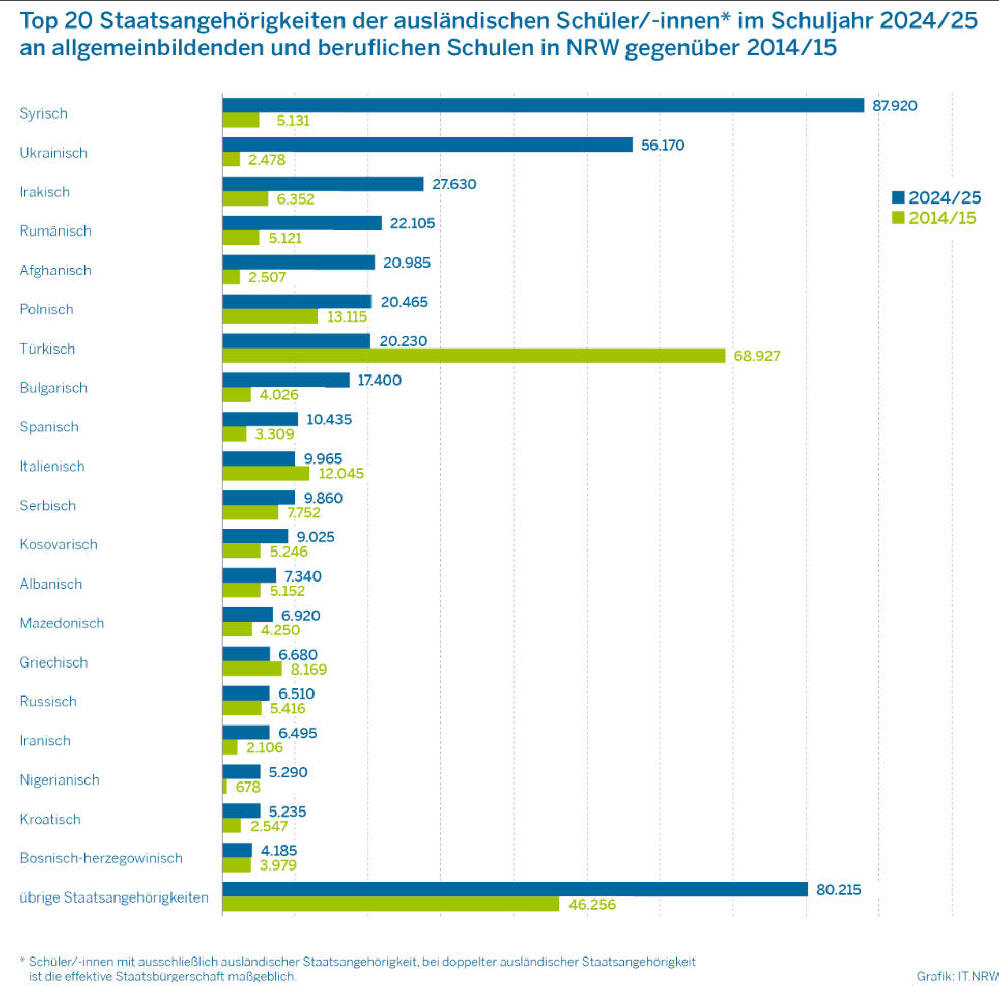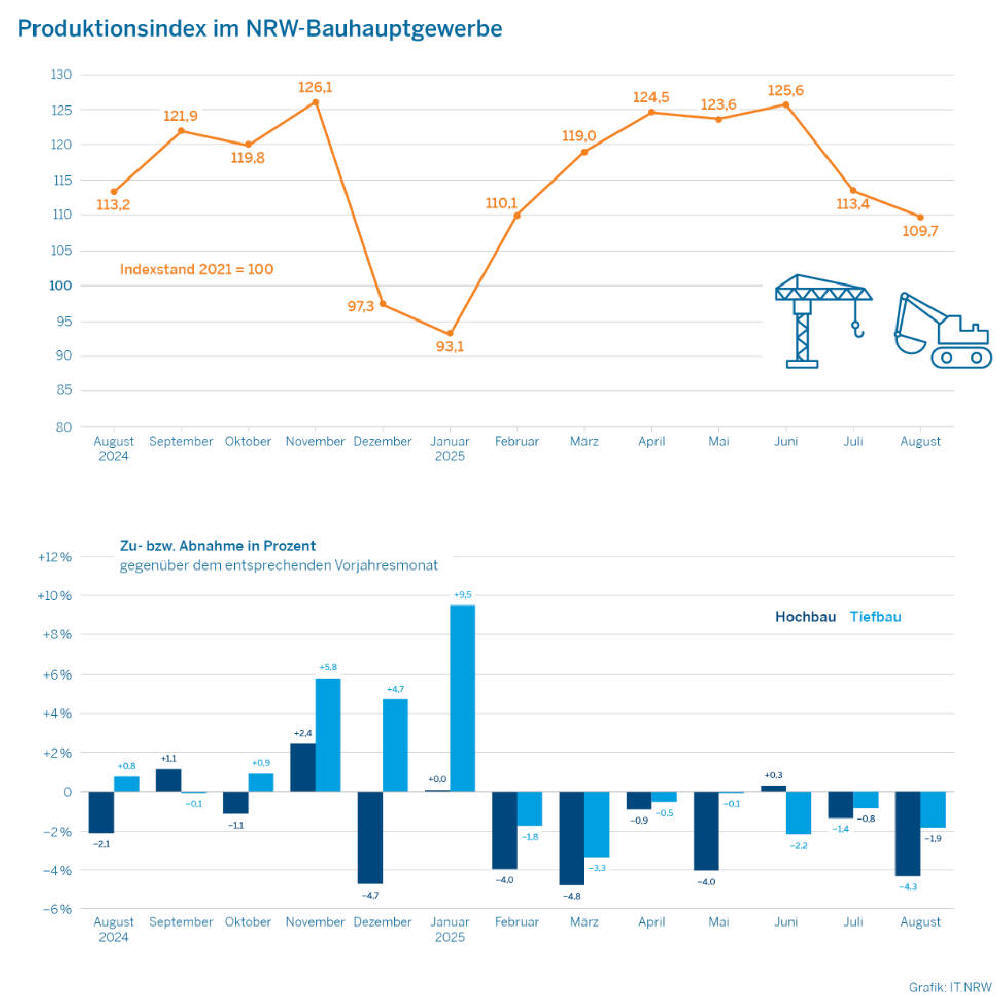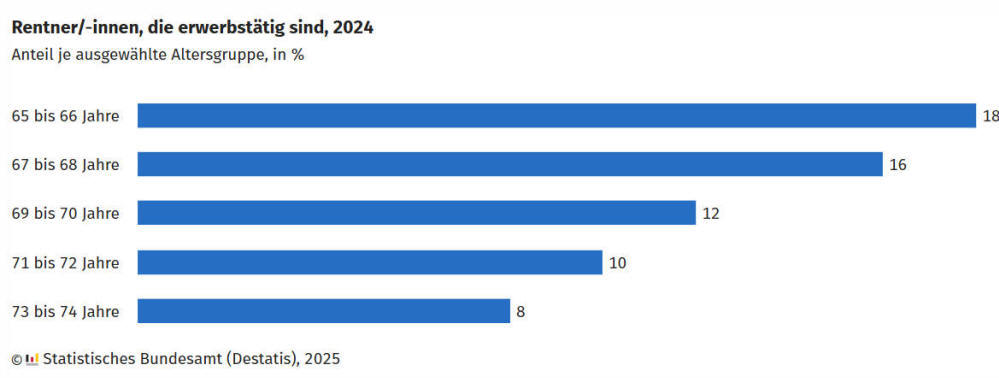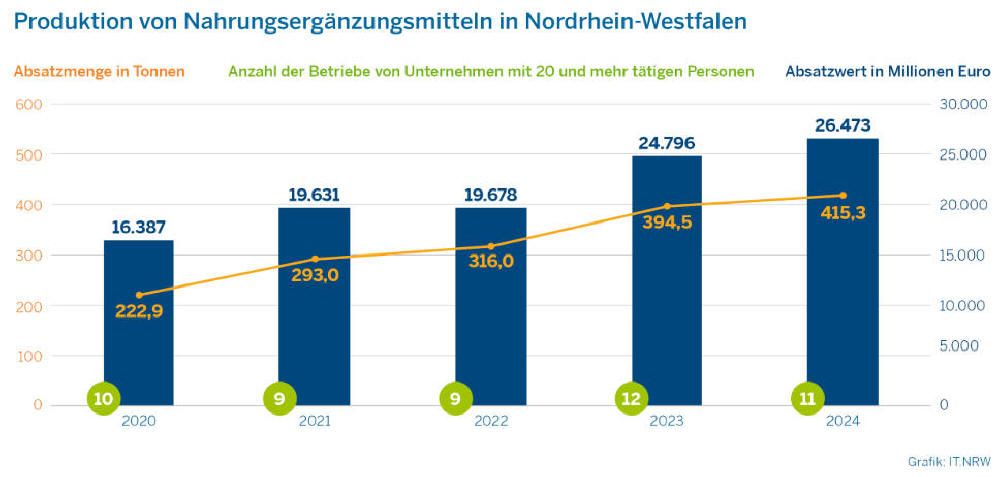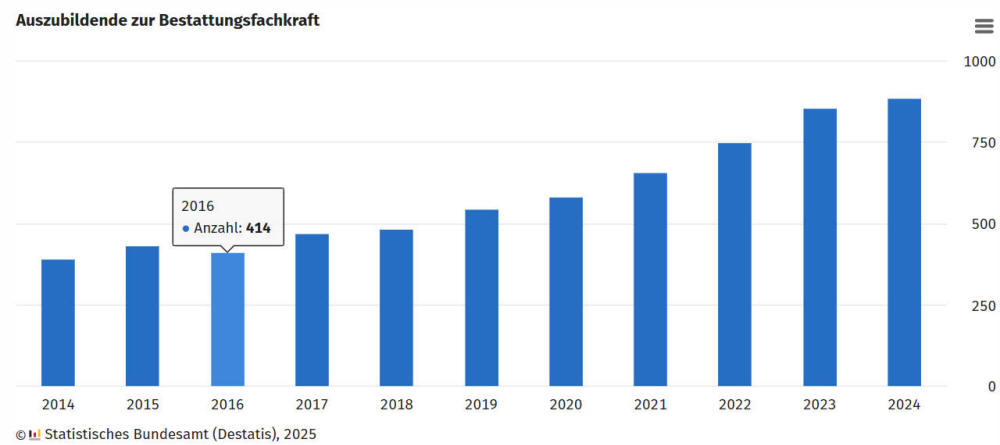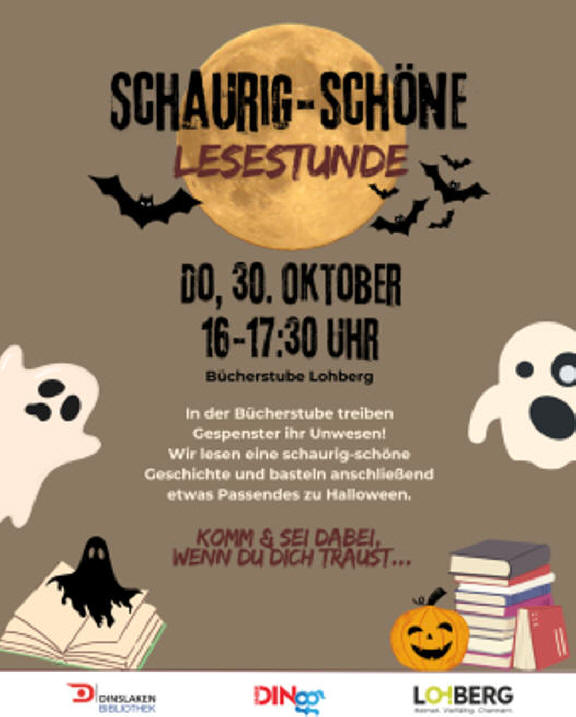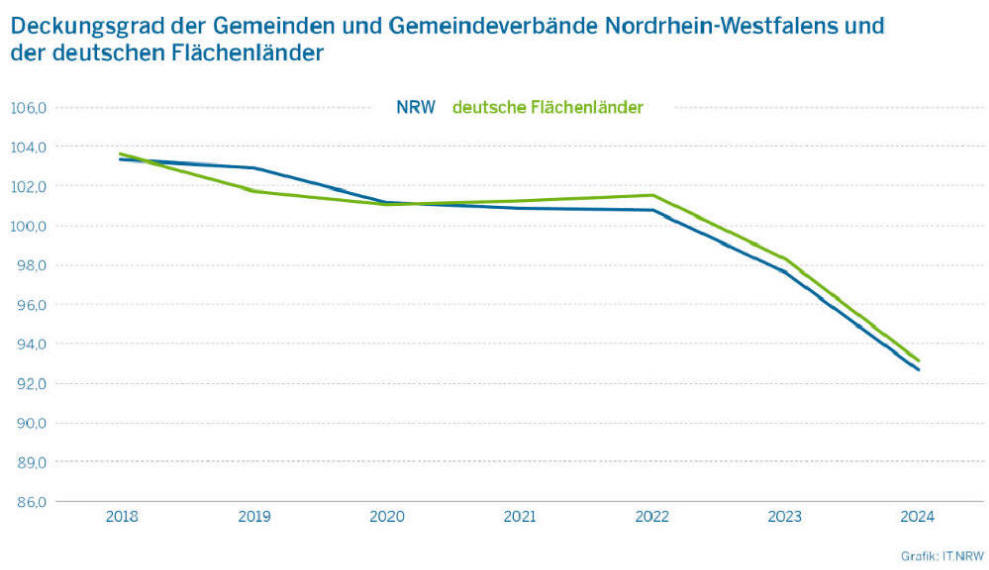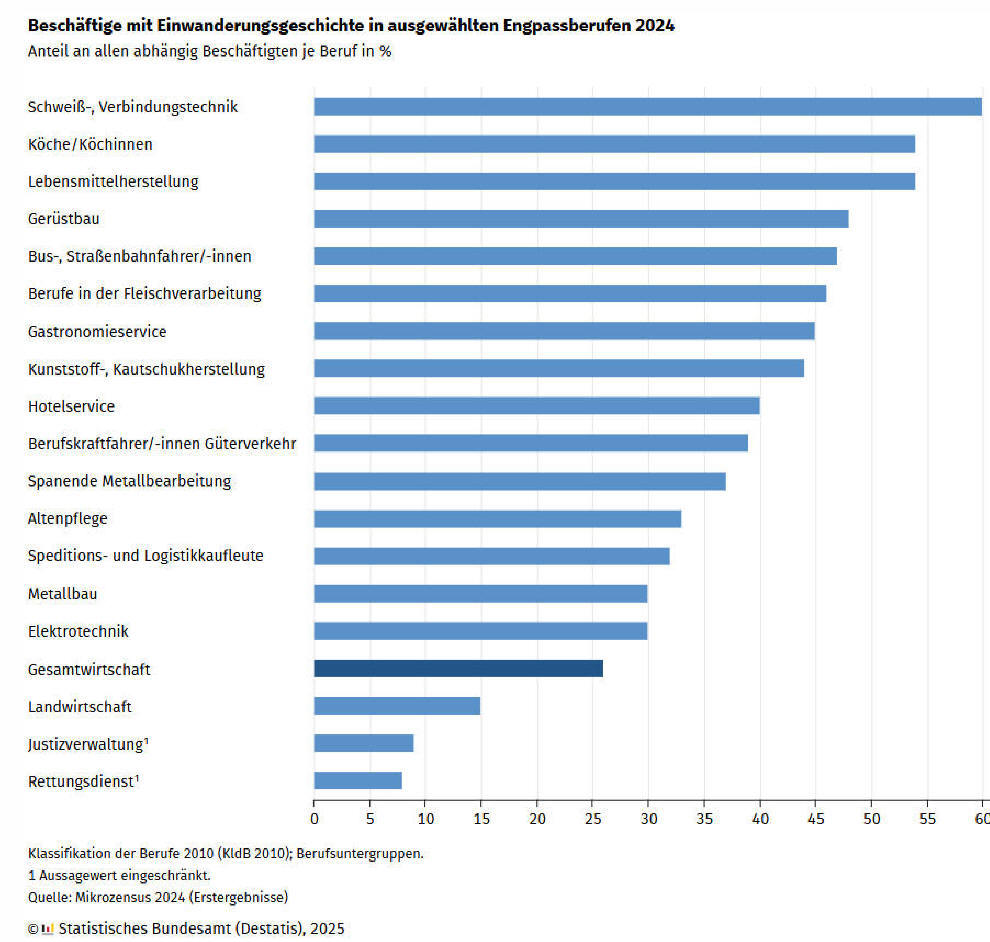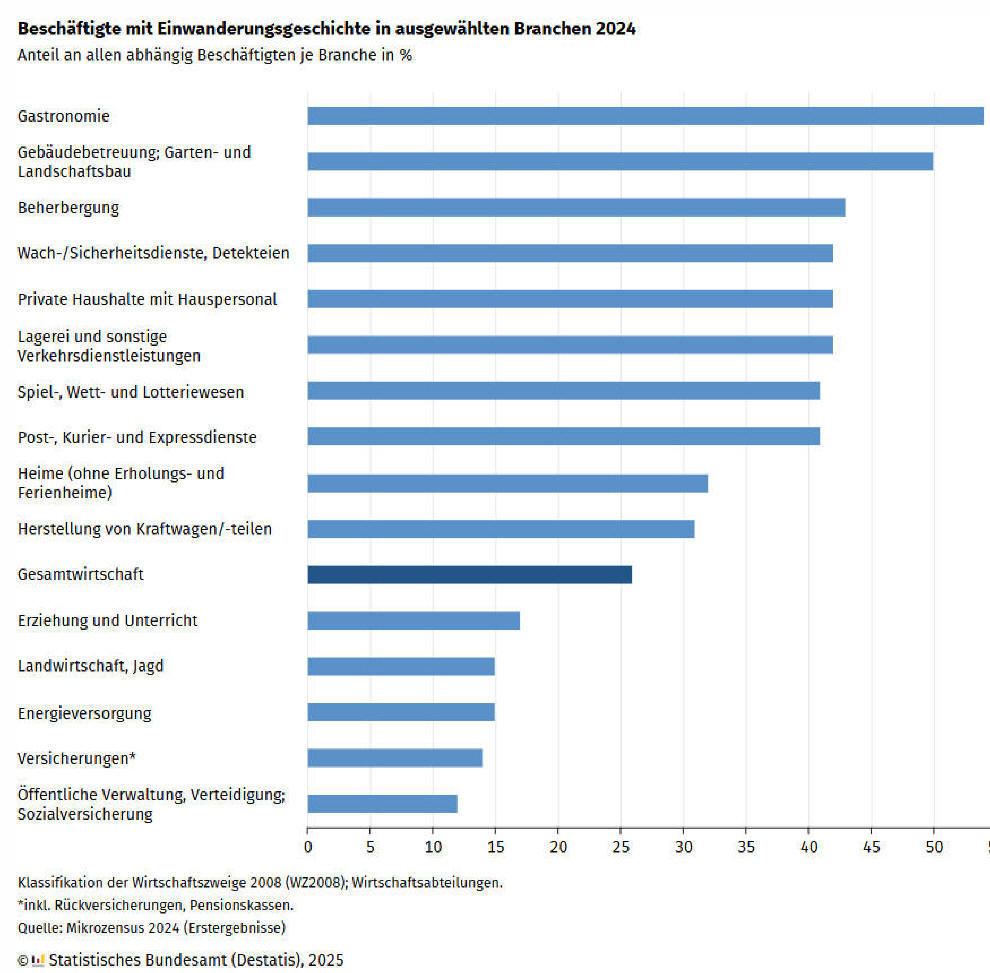|
KW 44:
Montag, 27. Oktober - Sonntag, 2.11.2025
Themen u.a.:
Kreis Wesel
ordnet Stallpflicht für Geflügel an
Aufgrund des aktuellen starken
Aufkommens der Geflügelpest und der dadurch
bestehenden Gefahr für Geflügelhaltungen
ordnet der Kreis Wesel die kreisweite
Aufstallung von Geflügel an, die am Freitag,
31. Oktober 2025, in Kraft tritt. Geflügel
muss dann entweder in geschlossenen Ställen
oder unter einer Vorrichtung gehalten
werden, die aus einer überstehenden, nach
oben gegen Einträge gesicherten dichten
Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen
von Wildvögeln - auch Kleinvögeln -
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss
(Schutzvorrichtung).
Wildvögel
dürfen keinen Zugang zu Tränkwasser und
Futter haben. Außerdem dürfen im Kreis keine
Geflügelausstellungen, -märkte, -schauen,
Wettbewerbe mit Geflügel oder ähnliche
Veranstaltungen stattfinden. Wie lange die
Maßnahmen erforderlich sind, lässt sich
nicht vorhersagen, erfahrungsgemäß muss mit
mindestens drei Monaten gerechnet werden.
Betroffen sind insgesamt ca. 2.950
Geflügelhaltungen im Kreisgebiet mit etwa
600.000 Stück Geflügel.
Die aktuelle
Risikoeinschätzung des hierfür maßgeblichen
Friedrich-Loeffler-Institutes vom 20.10.2025
geht von einem hohen Risiko des Eintrags von
Influenzaviren vom Typ HPAI H5 sowohl in
wildlebende Wasservogelpopulationen als auch
in Geflügelhaltungen und Vogelbestände in
Deutschland aus. Zwischen dem 01. September
und 20. Oktober 2025 wurden in Deutschland
15 HPAIV H5N1- Ausbrüche bei Geflügel in
sieben Bundesländern festgestellt.
Hinzu kommen zahlreiche Feststellungen bei
Wildvögeln, insbesondere bei durchziehenden
Kranichen. Im Kreis Wesel wurden seit dem
15. Oktober 2025 etliche verendet
aufgefundene Wildvögel, überwiegend
Wassergeflügel und Greifvögel, zur
Untersuchung eingesandt. Bis zum 29. Oktober
2025 lagen bereits insgesamt sechs
labordiagnostische Verdachtsfälle auf
Geflügelpest vor (Nachweis von H5), die
derzeit im Friedrich-Löffler-Institut
abgeklärt werden.
Es ist sicher zu
erwarten, dass ein Großteil der noch nicht
vorliegenden Untersuchungsergebnisse
ebenfalls positiv sein wird. Der Kreis Wesel
ist mit seinen Flüssen, Wasserflächen und
Feuchtgebieten ein bedeutendes Rast- und
Durchzugsgebiet für wildlebende Wasservögel.
Weite Flächen des Kreises werden regelmäßig
und in den kommenden Wochen zunehmend vor
allem von hier rastenden Wildgänsen genutzt
und auch überflogen.
Von den bisher
sechs Verdachtsfällen betreffen fünf
Wildgänse. Zudem gab es in jüngster
Vergangenheit einen amtlich festgestellten
Ausbruch in einer Putenhaltung in Rees im
Kreis Kleve. Die eingerichtete
Überwachungszone betrifft Teile von
Hamminkeln und Xanten. Nach jetzigem Stand
muss als Ursache ein Eintrag aus der
Wildvogelpopulation angenommen werden.
Insgesamt liegen für den Kreis Wesel
somit hinreichend sichere Erkenntnisse über
den Eintrag von gefährlichen Influenzaviren
in die regionale Wildvogelpopulation vor,
wodurch Geflügelbestände und Vogelhaltungen
stark gefährdet werden.
Update vom
31.10.2025: 11.58 Uhr: Aufgrund eines
klinischen und labordiagnostisch bestätigten
Verdachts auf Geflügelpest (H5) in einem
Putenmastbestand in Kamp Lintfort werden die
dort gehaltenen ca. 18.300 Puten derzeit
getötet. Um den Betrieb wird eine vorläufige
Sperrzone mit einem Radius von 10 km
errichtet.
Sie wird dann bei
Bestätigung und näherer Differenzierung des
Virustyps durch das Friedrich - Loeffler
Institut in einigen Tagen auch die
endgültige Sperrzone werden, die sich dann
in eine innere 3-km- Schutzzone und darum
liegende Überwachungszone unterteilt. Die
Allgemeinverfügung für die vorläufige
Sperrzone tritt heute Nacht um 0 Uhr in
Kraft. Das Gebiet betrifft etwa zur Hälfte
die Kreises Kleve und Wesel, ein kleiner
Bereich fällt in den Kreis Viersen.
Neues Amtsblatt
Am
31. Oktober 2025 ist ein neues Amtsblatt der
Stadt Dinslaken erschienen. Es enthält eine
öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Dinslaken. Die städtischen Amtsblätter
können auch auf der städtischen Homepage
eingesehen werden: https://www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/aktuelles/amtsblatt#
Stadtwerke
Wesel Service und Energie erweitern das
Schnellladenetz
Die Stadtwerke
Wesel informieren über den weiteren Ausbau
der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.
An der Moltkestraße wurden zwei neue 200 kW
Schnellladesäulen mit jeweils zwei
Ladepunkten installiert. Zwei weitere
Schnellladesäulen werden kurzfristig an den
Standorten Martinistraße und Goldstraße
durch die Stadtwerke Wesel Service und
Energie GmbH errichtet.
Die vier
Schnellladesäulen werden von der Stadtwerke
Service und Energie GmbH an die Stadtwerke
Wesel GmbH verpachtet. Diese übernehmen den
Stromverbrauch und -abrechnung. Die
Zusammenarbeit mit der Stadt Wesel
unterstreicht das Engagement der Stadtwerke
Wesel Service und Energie GmbH für eine
umweltfreundliche Mobilität und die
Förderung der Elektromobilität in der
Region.
„Mit den neuen
Schnellladesäulen an der Moltkestraße sowie
den weiteren Anlagen an der Martinistraße
und der Goldstraße schaffen wir für unsere
Kundinnen und Kunden mehr Komfort und kurze
Ladezeiten. Damit treiben wir den Ausbau
einer zukunftssicheren und verlässlichen
Ladeinfrastruktur in Wesel konsequent
voran“, sagt Geschäftsführer Rainer Hegmann.
Mit den neuen Ladesäulen betreiben
die Stadtwerke Wesel derzeit 60 Ladepunkte
an 30 Standorten. Die Stadtwerke Wesel
Service und Energie GmbH installieren
insgesamt vier neue Schnellladesäulen,
welche 200 kW Gleichstromladung
bereitstellen. Wie alle öffentlichen
Ladesäulen der Stadtwerke Wesel sind auch
die neuen Lademöglichkeiten dem
Stadtwerke-Verbund von ladenetz.de
angeschlossen.
Damit können alle
Fahrer eines Elektro-PKW, die eine SWW
Ladekarte oder eine andere Karte mit Zugang
zu ladenetz.de haben, ihr Fahrzeug an einem
der beiden Ladepunkte mit 100-prozentigem
Ökostrom versorgen.
Darüber hinaus
ist auch Ad-hoc-Laden möglich – das heißt,
Kundinnen und Kunden können ohne vorherige
Registrierung oder Ladekarte direkt per
Smartphone und gängigen Zahlungsmethoden
laden. Weitere Informationen zur
Elektromobilität der Stadtwerke Wesel finden
Bürgerinnen und Bürger unter www.stadtwerke-wesel.de/elektromobilitaet.
Wesel: Vorübergehende
Schließung der Ausländerbehörde wegen
Netzwerkausbau
Die
Ausländerbehörde der Stadt Wesel bleibt in
der 46. Kalenderwoche 2025 (10. bis 14.
November 2025) aufgrund umfangreicher
Arbeiten am IT- und Netzwerksystem
geschlossen. Ziel der Maßnahme ist es, die
digitale Infrastruktur der Behörde zu
modernisieren und künftig einen noch
schnelleren und zuverlässigeren Service
anbieten zu können.
Während der Arbeiten sind keine persönlichen
Vorsprachen und telefonischen Auskünfte
möglich. Fristwahrende Anträge können per
E-Mail unter team74@wesel.de eingereicht
werden. Die Ausländerbehörde bittet um
Verständnis für die vorübergehenden
Einschränkungen.
Wesel:
Kostenlose Energieberatung zum Start der
Heizsaison. Offene Sprechstunde am 4.
November um 15 Uhr
Mit Beginn
der kalten Jahreszeit rücken Themen wie
Heizen, Dämmen und Energiesparen wieder in
den Mittelpunkt. Steigende Energiepreise,
begrenzte Ressourcen und der Klimaschutz
machen einen bewussten und effizienten
Umgang mit Energie wichtiger denn je. Darum
bietet das Klimabündnis der Kommunen im
Kreis Wesel eine offene, digitale
Sprechstunde für alle Bürgerinnen und Bürger
im Kreis Wesel an.
Energieexperte
Akke Wilmes von der Verbraucherzentrale NRW
beantwortet Fragen rund um das Thema
„Energieeffizientes Bauen und Wohnen“. Ob
Heizen und Dämmen, Wärmepumpentechnik,
Photovoltaikanlagen, energiesparendes „Smart
Home“, Dach- und Fassadenbegrünung oder
Förderprogramme – jede Frage wird
berücksichtigt. Auch zu den Vorgaben und
Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes
(GEG) wird beraten.
Die offene
Sprechstunde findet in der Regel jeden
zweiten Dienstag von 15 bis 16 Uhr online
statt. Die nächsten Termine sind: 4.
November 2025 18. November 2025 2. Dezember
2025 Eine Übersicht aller Termine ist unter www.kreis-wesel.de/klimabuendnis zu
finden. Die Sprechstunde ist Teil der
Klimakampagne „Gut für uns – und das Klima“,
mit der das Klimabündnis der Kommunen im
Kreis Wesel über Möglichkeiten zu
klimabewusstem Handeln informiert.
Zielgruppe: Die Veranstaltungen richten sich
an alle Bürgerinnen und Bürger, die Fragen
rund um das Thema „Energieeffizientes Bauen
und Wohnen“ haben oder sich hierzu
informieren möchten. Anmeldung: Die
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist
jedoch erforderlich. Interessierte können
sich per E-Mail an
julia.joergensen@kreis-wesel.de oder
telefonisch unter 0281 207-4016 anmelden.
Die Veranstaltung findet online über Zoom
statt. Den Zugangslink erhalten die
Teilnehmenden rechtzeitig vor Beginn.
Moers:
Startklar für den Winter - Winterdienst
probte am Betriebshof den Ernstfall
Frühaufsteher fröstelt es in diesen Tagen
bereits. Von einem richtigen Winter mit
Temperaturen um den Gefrierpunkt ist am
Niederrhein der-zeit aber noch keine Spur.
Für den Winterdienst der ENNI Stadt &
Service Niederrhein (Enni) ist die
Wintersaison aber bereits eröffnet. Dazu hat
die Mannschaft von Abteilungsleiter Ulrich
Kempken auf dem Be-triebshof ‚Am Jostenhof‘
kürzlich bereits den Ernstfall geprobt.

„Das Fahren mit schweren Räumschildern,
Salz- und Solebehältern und
unübersichtlichen Einsatzfahrzeugen will
geübt sein,“ gehöre ein Pro-belauf laut
Abteilungsleiter Ulrich Kempken stets zu
Saisonbeginn zur Routine des Einsatzteams.
Die Rufbereitschaft ist damit für
Ein-sätze von November bis Ende März bereit
und hat dabei das rund 400 Kilo-meter lange
Moerser Straßennetz ab sofort stets im Auge.
Kempken rät Autofahrern ab November vor
allem morgens und abends immer vorsichtig
unterwegs zu sein. „In der Übergangsphase
können Straßen in Sekunden überfrieren und
gepaart mit dem derzeit rieselnden Laub
plötzlich zu gefährlichen Rutschbahnen
werden.“

Auch wenn der Winterdienst bislang nicht
gefordert war, hat Kempken für den Fall der
Fälle bereits über den Sommer vorgesorgt.
Das Salzla-ger am Jostenhof ist mit rund 900
Tonnen gut gefüllt, neun Einsatz-fahrzeuge
stehen bereit, von denen drei speziell auch
für den Einsatz auf Radwegen geeignet sind.
Zur Routine gehört ab sofort, dass ein
Mitarbeiter bei angekündigten Temperaturen
unter drei Grad Celsius jeden Morgen gegen
drei Uhr bekannte Problemstellen, wie
Brücken und Unterführungen, abfährt und auf
Glätte kontrolliert.
Stellt er eine
Rutschgefahr fest, alarmiert er sofort den
Bereitschaftsdienst. Je nach Einsatz können
bis zu 60 Kollegen zeitgleich ausrücken.
Damit der Verkehr weiter rollen kann,
befreit der Winterdienst dann immer
zu-nächst die rund 160 Kilometer langen
Hauptverkehrsstraßen sowie Schulbuslinien
und 51 Kilometer priorisierte Radwege von
Schnee und Eis.
„Wenn es sehr stark
schneien sollte, geschieht dies zweimal
täg-lich“, kümmere sich Enni dann parallel
auch um Gehwege zu städti-schen
Einrichtungen, etwa rund um Friedhöfe,
Parkanlagen sowie an Kindergärten und
Schulen. „Erst wenn dann noch Kapazitäten
frei sind und es Einsatzzeiten noch
zulassen, räumen wir Nebenstraßen der
sogenannten Priorität 2“, sei dies ein
festgeschriebener Ablauf.
Dort, wo
Straßen nicht der Streupflicht unterliegen,
müssen Bürger auch in Moers im Winter mit
anpacken, ihrer Kehrpflicht nachkommen und
Gehwege vor ihren Grundstücken und Häusern
von Eis und Schnee befreien. „Wie und wo
dies geschehen muss, ist in der so
ge-nannten Straßenreinigungssatzung
festgelegt, die wir im Internet
veröf-fentlicht haben.“ Fragen zum
Winterdienst beantwortet die Enni zudem
unter der kostenlosen Servicenummer 0800 222
1040.
Dinslaken:
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel
verabschiedet sich aus dem Amt: Dank,
Rückblick und Zuversicht für Dinslaken
Nach fünf intensiven Jahren an
der Spitze der Stadt Dinslaken verabschiedet
sich Bürgermeisterin Michaela Eislöffel aus
dem Amt. In einer persönlichen Erklärung
blickt sie auf bewegte Zeiten, die von
Krisen, Zusammenhalt, Engagement und
wichtigen Fortschritten für die Stadt
geprägt waren.

„Es war und ist mir eine große Ehre, die
Entwicklung unserer Stadt mitgestaltet zu
haben“, sagt Michaela Eislöffel. „Die fünf
Jahre Amtszeit waren kein Spaziergang, aber
sie haben mir gezeigt, dass viele Menschen
in unserer Stadt Verantwortung übernehmen,
zusammenhalten und sich für das Gemeinwohl
einsetzen.“
Zu den besonderen
Herausforderungen ihrer Amtszeit zählten die
Corona-Pandemie, die Energiekrise, die
Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine
sowie außergewöhnliche Ereignisse wie der
Deichabbruch und der Ölteppich auf der
Emscher.
„Die Krisen haben uns allen
organisatorisch, emotional und menschlich
einiges abverlangt. Aber die Menschen in
Dinslaken haben gezeigt, dass sie in Krisen
zusammenhalten. Trotz dieser Belastungen
haben wir in Dinslaken in die Zukunft
geplant und investiert.“
Besonders
am Herzen lagen Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel die Stadtentwicklungsprojekte wie
das Freibadgelände in Hiesfeld, die
Neugestaltung des Trabrennbahnareals, die
Entwicklungen der Gewerbeflächen am
Mannesmanngelände (MCS) und bei Hamco, der
neu entstehende Wohnraum im Solarquartier
Lohberg und vor allem die Modernisierung des
Bahnhofsgebäudes.
„Diese Projekte
stehen für Zukunft, Lebensqualität und
Perspektive. Ich freue mich, dass sie auf
einem guten Weg sind und weiter
vorangebracht werden.“ Ebenso hebt sie die
Investitionen in Bildung und Betreuung
hervor: „In den letzten Jahren haben wir bei
Kitas, Schulen in die Zukunft geplant. Trotz
knapper Finanzen ist es gelungen neue Plätze
zu schaffen und moderne Bildungsorte zu
gestalten. Das war nur möglich, weil viele
Kolleginnen und Kollegen mit spitzem
Bleistift gerechnet und mit großem
Engagement und Verantwortungsbewusstsein
gearbeitet haben.“
In ihrem
Rückblick spricht die Bürgermeisterin auch
offen über die schwierigen Seiten ihres
Amtes:„Öffentlich in der Verantwortung zu
stehen bedeutet auch Kritik und Angriffe
auszuhalten und trotzdem seine Aufgaben
professionell zu erledigen. In vielen
Situationen ist es schon aus rechtlichen
Gründen nicht möglich, sich im Detail
rechtfertigen zu können. Besonders bei
Personalentscheidungen oder internen
Abläufen war es mir wichtig mein Amt
professionell auszufüllen. Auch wenn manches
nach außen unverständlich wirkte, habe ich
jede Entscheidung mit Blick auf den
Sachstand, das Gemeinwohl und aus einem
tiefen Verantwortungsgefühl getroffen.“
Als parteilose Bürgermeisterin habe sie
gelernt, dass Politik manchmal ein
„vermintes Gelände“ sein könne, „aber eines,
das sich zu betreten lohnt, wenn man
gestalten und Verantwortung übernehmen
möchte.“ Mit Blick auf ihren Nachfolger sagt
Bürgermeisterin Eislöffel: „Ich wünsche dem
neuen Bürgermeister viel Kraft, Offenheit
und Fingerspitzengefühl sowie eine gute
Balance für zukünftige Entscheidungen.
Dieses Amt ist herausfordernd, aber es
ist auch ein großes Privileg die Zukunft
Dinslaken gestalten zu dürfen. Ich wünsche
ihm, dass er auf die Menschen bauen kann,
die Tag für Tag mit großer Leidenschaft in
der Verwaltung, in den Einrichtungen und in
der Bürgerschaft für unsere Stadt die
Zukunft gestalten.“
Zum Abschluss
richtet Michaela Eislöffel den Blick auch
auf ihre persönliche Zukunft: „Für mich
beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Ich
freue mich auf neue berufliche Ziele, aber
vor allem darauf, endlich wieder mehr Zeit
für meine Familie und Freunde zu haben.
Private Interessen sind in den letzten
Jahren zu kurz gekommen.
Ich freue
mich darauf, viele Dinslakenerinnen und
Dinslakener künftig im Alltag, beim
Einkaufen oder bei Veranstaltungen in
unserer schönen Stadt zu treffen. Ich gehe
mit Dankbarkeit, Wehmut und Zuversicht.
Dinslaken hat enormes Potenzial und ich bin
stolz darauf ein Stück unserer
Stadtgeschichte mitgeschrieben zu haben.“
Dinslaken: Neuer Leiter der
Feuerwehr
David Marten tritt
sein Amt als neuer Leiter der Feuerwehr
Dinslaken und des Fachdienstes
Feuerschutz/Rettungsdienst an. Zum
Amtsantritt gratulieren Achim Thomae (Erster
Beigeordneter der Stadt Dinslaken) und
Christiane Wenzel (Leiterin der
Ordnungsbehörde).

David Marten (40) ist seit Oktober 2025
Leiter der Feuerwehr Dinslaken und des
Fachdienstes Feuerschutz/Rettungsdienst.
Nach dem Abitur studierte er an der
Technischen Hochschule Köln den Studiengang
Rettungsingenieurwesen, den er mit dem
Bachelor und dann mit dem Master abschloss.
Anschließend arbeitete er als
Projektingenieur in der
Sicherheitsforschung/Schiffssicherheit,
bevor er die Laufbahn für den höheren
feuerwehrtechnischen Dienst einschlug.
Nachdem er sein Brandreferendariat
im April 2016 beendet hatte, wurde er zum
Brandrat ernannt. Von April 2016 bis Oktober
2018 war er als Sachgebietsleiter Daten- und
Kommunikationstechnik bei der Feuerwehr
Düsseldorf tätig. Im August 2018 wurde er
zum Oberbrandrat befördert. Im Oktober 2018
wechselte er zur Feuerwehr Ratingen. Dort
verblieb er bis Dezember 2023 und war als
Abteilungsleiter Personal, Ausbildung und
Rettungsdienst sowie als stellvertretender
Amtsleiter tätig.
Zum 1.1.2024
wechselte Marten zur Feuerwehr Dinslaken und
wurde bis zur Übernahme der Leitung als
Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr eingesetzt.
Der dreifache Familienvater engagiert sich
seit Beginn seiner Laufbahn auch für das
Feuerwehrwesen im Land Nordrhein-Westfalen
unter anderem im Aktionsbündnis zum Schutz
von Feuerwehr- und Rettungskräften vor
Gewalt.
Seit seinem 15. Lebensjahr
ist er in der Jugendfeuerwehr und später in
der freiwilligen Feuerwehr engagiert. Die
Feuerwehr Dinslaken ist eine freiwillige
Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Knapp
120 hauptamtliche Beschäftigte, 250
ehrenamtliche Angehörige der
Einsatzabteilung, Kinder- und
Jugendfeuerwehr setzen sich für den
Brandschutz/Rettungsdienst in Dinslaken
sowie die rettungsdienstliche Versorgung von
Voerde und Teilen von Hünxe ein. Marten
tritt die Nachfolge von Ulrich Borgmann an,
der Ende September in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet worden war.
„Simply the Best“: Briefmarke
erinnert an Tina Turner
Deutsche
Post erweitert Sonderbriefmarken-Serie
„Legenden der Pop-/ Rockmusik“ um die „Queen
of Rock’n’Roll“ - Marke ab 3. November in
Postfilialen und online erhältlich
Die Deutsche Post ehrt Tina Turner mit einer
eigenen Sonderbriefmarke. Die „Queen of
Rock’n’Roll“ wird nach Jimi Hendrix (2023)
und Freddie Mercury (2024) die erste
Musikerin, die Teil der Briefmarken-Serie
„Legenden der Pop-/Rockmusik“ wird. Damit
würdigt die Deutsche Post die großen Erfolge
des Weltstars, der auch in Deutschland sehr
populär war.

Songs wie “Nutbush City Limits", "The Best",
"What's Love Got to Do with It" und
"GoldenEye” schafften es in die Top 10 der
deutschen Charts, „We Don't Need Another
Hero" landete 1985 - vor 40 Jahren - sogar
auf Platz 1. Zudem füllte Tina Turner
hierzulande die größten Konzerthallen,
zuletzt auf ihrer Abschiedstournee mit dem
Namen „Tina!: 50th Anniversary Tour“, die
sie 2009 nach Köln, Berlin, Hamburg,
Hannover, Mannheim und München führte.
Die Sonderbriefmarke ist ab dem 3.
November in Postfilialen mit Vollsortiment,
im Online-Shop oder telefonisch beim
Bestellservice der Deutschen Post erhältlich
(Tel.: 0961 – 3818 – 3818). Gestaltet wurde
sie von Jan-Niklas Kröger,
Briefmarken-Designer der Deutschen Post. In
den Philatelieshops, im Online-Shop oder
beim Bestellservice können zudem Produkte
rund um die Briefmarke erworben werden.
Über den Online-Shop und Bestellservice
ist zudem eine limitierte Gold-Edition der
Briefmarke, bestehend aus der Briefmarke mit
der laufenden Nummer 1-1.000 und dem Abbild
der Briefmarke mit echtem Gold in einem
hochwertigen Hardcover erhältlich. Die Marke
hat den Portowert 95 Cent, mit dem z.B. ein
Standardbrief (bis 20g) innerhalb
Deutschlands frankiert werden kann.
Offizieller Herausgeber ist das
Bundesministerium der Finanzen.
Benjamin Rasch, Leiter Produktmanagement und
Marketing der Deutschen Post: „Es ist uns
eine Freude, Tina Turner mit einer
Sonderbriefmarke zu ehren. Sie war zu
Lebzeiten ein internationaler Superstar und
auch in Deutschland sehr beliebt. Noch heute
erinnern sich die Menschen an ihre Hits.
Deshalb war für uns klar, dass sie als erste
Musikerin in unsere Sondermarken-Serie
‚Legenden der Pop-/Rockmusik‘ aufgenommen
werden muss. Sicherlich werden sich viele
ihrer Fans freuen, ihre Post jetzt mit ihrem
Idol frankieren zu können.“
Über Tina
Turner
Tina Turner wurde am 26. November
1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville,
Tennessee (USA), geboren. Sie wuchs im
nahegelegenen Nutbush auf und sang im
Gospelchor der Baptistenkirche. Mit siebzehn
zog sie nach St. Louis, Missouri, wo sie Ike
Turner traf, der sie als Sängerin für seine
Band Kings of Rhythm engagierte. Er gab ihr
den Bühnennamen Tina Turner, und sie
heirateten später.
Die beiden hatten
in den 1960er und 70er Jahren großen Erfolg
mit Songs wie „Nutbush City Limits“, „Proud
Mary“ und dem von Phil Spector produzierten
„River Deep - Mountain High“. Tinas Stimme
und Bühnenpräsenz setzten bereits neue
Maßstäbe in der Musikindustrie. Wenige
wussten jedoch zu der Zeit, dass Tina unter
fortwährenden Misshandlungen durch Ike litt,
von dem sie sich 1976 trennte und zwei Jahre
später scheiden ließ.
Die Trennung
markierte das Ende von Tina Turners erster
globaler Karriere. Es dauerte eine Weile,
bis sie sich neu etablierte. 1983 feierte
sie mit ihrem fünften Soloalbum „Private
Dancer“ ein bemerkenswertes Comeback,
insbesondere mit dem weltweiten Hit „What’s
Love Got To Do With It“. Danach war Tina
Turner nicht mehr aufzuhalten und verkaufte
über 100 Millionen Alben.
Zu ihren
bekanntesten Songs gehören „I Don’t Wanna
Lose You“, „Steamy Windows“, „The Best“, das
James-Bond-Thema „GoldenEye“ und „We Don’t
Need Another Hero“ aus „Mad Max Beyond
Thunderdome“, in dem sie die mittlerweile
legendäre Figur Aunty Entity spielte. Tina
Turner veranstaltete auch rekordbrechende
Welttourneen: Die Break Every Rule World
Tour war die umsatzstärkste Tour der
80er-Jahre einer weiblichen Künstlerin, in
Brasilien brach sie den Rekord für das
größte zahlende Publikum aller Zeiten.
Nach über fünf Jahrzehnten im Dienste
von Rock’n’Roll, R&B, Soul, Funk und allem
dazwischen – und nach Abschluss ihrer
„Tina!: 50th Anniversary Tour“ – zog sie
sich 2009 zurück und lebte mit ihrem zweiten
Ehemann Erwin Bach in Küsnacht, Schweiz.
Tina, die „Queen of Rock’n’Roll“, verstarb
am 24. Mai 2023
Die Stadt
Moers hat ein Amtsblatt veröffentlicht.
Alle veröffentlichten
Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter
Amtsblatt Nr. 22 vom 30.10.2025 (193.41
KB)
Stellungnahme zum
Referentenentwurf des
Bundesgesundheitsministeriums zum Entwurf
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Apothekenversorgung
Stellungnahme der
unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) vom 31.10.2025 zum
Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit Entwurf eines Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Apothekenversorgung
(Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz
– ApoVWG)
I. Allgemeines Mit
dem Entwurf eines Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Apothekenversorgung
(ApoVWG) verfolgt das Bundesministerium für
Gesundheit das Ziel, die wirtschaftlichen
und strukturellen Rahmenbedingungen der
öffentlichen Apotheken zu verbessern und
deren Beitrag zur wohnortnahen
Gesundheitsversorgung zu stärken.
Im
Mittelpunkt stehen Maßnahmen zum
Bürokratieabbau, zur Stärkung der
Eigenverantwortung von Apothekeninhaberinnen
und -inhabern sowie zur Ausweitung
pharmazeutischer Tätigkeiten, insbesondere
im Bereich der Prävention und der direkten
Patientenversorgung. Darüber hinaus sollen
neue Abgabemöglichkeiten und Aufgaben den
Handlungsspielraum der Apotheken erweitern
und so zur Sicherung eines flächendeckenden
Apothekennetzes – insbesondere in ländlichen
Regionen – beitragen.
Zugleich wirft
die vorgesehene Erweiterung der
Abgabekompetenzen nach den neuen §§ 48a und
48b AMG eine Reihe von grundsätzlichen und
systematischen Fragen auf – insbesondere im
Hinblick auf den Anspruch der Versicherten
nach § 31 SGB V, die Einbindung in die für
die wirtschaftliche Versorgung mit
Arzneimitteln geltenden übergeordneten
Regelungen sowie die Abgrenzung zur
ärztlichen Versorgung.
Die
hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nehmen
entsprechend der Betroffenheit des G-BA zu
dem zugrundeliegenden Referentenentwurf im
nachfolgenden Umfang Stellung. Zu weiteren
Aspekten wird aufgrund einer allenfalls
mittelbaren Betroffenheit des G-BA auf eine
Stellungnahme verzichtet. Prof. Josef Hecken
Karin Maag (Unparteiischer Vorsitzender)
(Unparteiisches Mitglied) Dr. med. Bernhard
van Treeck (Unparteiisches Mitglied)
2 II. Einzelbemerkungen Zu Artikel 6
„Änderung des Arzneimittelgesetzes“ Zu
Nummer 2: § 48a AMG – Abgabe zur
Anschlussversorgung Inhalt der Regelung: Mit
dem neuen § 48a AMG wird Apotheken
ermöglicht, in eng begrenzten Fällen eine
Anschlussversorgung mit
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auch
ohne ärztliche oder zahnärztliche
Verschreibung vorzunehmen. Voraussetzung
ist, dass Patientinnen und Patienten das
betreffende Arzneimittel bereits über
mindestens vier Quartale hinweg regelmäßig
ärztlich verordnet erhalten haben und die
Fortführung der Therapie keinen Aufschub
erlaubt.
Die Abgabe darf nur
einmalig und in der kleinsten Packungsgröße
erfolgen. Ausgenommen sind Arzneimittel mit
hohem Missbrauchs- oder
Abhängigkeitspotenzial, solche, die nach
Fachinformation eine ärztliche Kontrolle vor
der Weiterverordnung erfordern, sowie
Off-Label-Anwendungen. Der Nachweis der
bisherigen Verschreibungen soll vorrangig
über die elektronische Patientenakte
erfolgen. Bewertung: Derzeit richtet sich
die Abgabe von Arzneimitteln durch Apotheken
hinsichtlich des Kriteriums „mit oder ohne
ärztliche Verschreibung“ allein nach den
Regelungen der Verordnung über die
Verschreibungspflicht von Arzneimitteln
(Arzneimittelverschreibungsverordnung -
AMVV).
Diese wird von den
zuständigen Bundesministerien nach Anhörung
des SachverständigenAusschusses für
Verschreibungspflicht mit Zustimmung des
Bundesrates auf Grundlage von § 48 Absatz 2
AMG beschlossen und regelmäßig
weiterentwickelt. § 48a fügt sich hier vor
allem im Hinblick auf die daraus
resultierenden Schlussfolgerungen für die
Leistungsansprüche der Versicherten nach §
31 SGB V nicht ein. Daher bleibt unklar, ob
und inwieweit der Gesetzgeber in den
genannten Ausnahmekonstellationen von einer
Abgabe zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung ausgeht, da sich keine
korrespondierenden Änderungen des SGB V
finden.
Nach § 48 Absatz 2 Satz 1
Nummer 5 AMVV kann die AMVV beispielsweise
bestimmen, ob und wie oft ein Arzneimittel
auf dieselbe Verschreibung wiederholt
abgegeben werden darf. Hiermit
korrespondiert wiederum § 31 Absatz 1b SGB
V, der dem generellen und auf § 15 SGB V
gründenden Verordnungsprinzip entsprechend
eine Kennzeichnung für die Möglichkeit
wiederholender Abgaben vorsieht und insoweit
die wirtschaftliche Versorgung und die
Verantwortungsübernahme dafür sicherstellt.
Sofern an der geplanten Änderung des AMG
festgehalten wird und diese dem Anspruch der
Versicherten nach § 31 SGB V unterfällt,
wird darauf hingewiesen, dass die Abgabe der
kleinsten Packungsgröße bei einer
chronischen Erkrankung zu Mehrkosten in der
Versorgung führt.
Davon unbenommen
sollten auch für die direkte und unabhängige
Versorgung der Versicherten mit
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 3
durch Apotheken die Regelungen einer
wirtschaftlichen Verordnungsweise gelten.
Demnach wäre eine gesetzliche Verknüpfung im
SGB V im Zusammenhang mit den
Leistungsansprüchen der Versicherten und die
Bindung der Apotheken an das
Wirtschaftlichkeitsgebot erforderlich. Zudem
erscheinen weitergehende Konkretisierungen
der in § 48a Absatz 2 genannten
Voraussetzungen, unter denen keine Abgabe
verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch
die Apotheke erfolgen darf, sinnvoll.
Denn beispielsweise die Einschätzung
eines hohen Missbrauchs- und
Abhängigkeitspotenzials oder eine nach
Fachinformation erforderliche ärztliche
Diagnostik oder Kontrolle zum Zeitpunkt vor
einer weiteren Verordnung sollte weder im
Einzelfall entschieden noch uneinheitlich
bewertet werden und so zu Unsicherheiten in
der Versorgung führen. Dies könnte vermieden
werden, indem in der AMVV die konkreten
„Abgabeverbote“ geregelt oder auch die „zur
Abgabe freigegeben Arzneimittel“ gelistet
werden.
4 - Zu Nummer 2: § 48b AMG –
Abgabe bei bestimmten akuten Erkrankungen
Inhalt der Regelung: Der neue § 48b AMG
erweitert die Kompetenzen von Apothekerinnen
und Apothekern, indem er die Abgabe
bestimmter verschreibungspflichtiger
Arzneimittel bei akuten, unkomplizierten
Erkrankungen ohne ärztliche Verschreibung
erlaubt.
Grundlage hierfür bildet
eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums
für Gesundheit, die auf Empfehlung des
Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) und unter
Beteiligung der Arzneimittelkommissionen der
Ärzte und der Apotheker sowie mit Zustimmung
des Bundesrates zu erlassen ist. Diese
Verordnung legt fest, für welche
Erkrankungen und Patientengruppen eine
Abgabe zulässig ist, welche Arzneimittel,
Wirkstoffe, Dosierungen und Packungsgrößen
umfasst sind und welche Anforderungen an
Beratung, Dokumentation und
Qualitätssicherung gelten.
Bewertung: Wie bereits ausgeführt, richtet
sich die Abgabe von Arzneimitteln durch
Apotheken hinsichtlich des Kriteriums „mit
oder ohne ärztliche Verschreibung“ derzeit
allein nach den Regelungen der
Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV).
Diese wird von den zuständigen
Bundesministerien nach Anhörung des
Sachverständigen-Ausschusses für
Verschreibungspflicht mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Auch hier stellt
sich aus rechtssystematischer Sicht die
Frage, weshalb die ausnahmsweise Abgabe
verschreibungspflichtiger Arzneimittel ohne
ärztliche Verschreibung nicht in der AMVV,
sondern in einer weiteren Rechtsverordnung
mit abweichenden Beteiligungsmöglichkeiten
geregelt wird.
Zudem bleibt unklar,
ob der Gesetzgeber in den beschriebenen
Ausnahmekonstellationen von einer Abgabe zu
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung
ausgeht. Vor dem Hintergrund, dass es sich
um die Akutversorgung nicht schwerwiegender
Erkrankungen handeln soll, ist zu
hinterfragen, ob eine solche Abgabe von
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
nicht vergleichbar mit der Versorgung mit
nicht-verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln nach § 34 Abs. 1 SGB V und
folglich von der Erstattungsfähigkeit zu
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung
auszuschließen ist.
Gruselzeit

Hellowen ganz
ausgeprägt


Zahl der unter Dreijährigen in
Kindertagesbetreuung 2025 um 5,6 % gesunken
• Zahl der betreuten Kinder
unter drei Jahren sinkt im zweiten Jahr in
Folge, Betreuungsquote steigt dennoch auf
37,8 %
• Erstmals sinkt auch die
Gesamtzahl der betreuten Kinder,
demgegenüber weiterhin Zuwachs bei Kitas und
Beschäftigten
• Zahl der Tagesmütter und
-väter geht im fünften Jahr in Folge zurück
WIESBADEN –
Die Zahl der Kinder unter
drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum
Stichtag 1. März 2025 gegenüber dem Vorjahr
um rund 47 100 oder 5,6 % auf insgesamt 801
300 Kinder gesunken. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm die Zahl
der unter Dreijährigen in
Kindertagesbetreuung damit im zweiten Jahr
in Folge ab (2024: -8 200 Kinder bzw. -1,0 %
zum Vorjahr).
Dennoch stieg die
Betreuungsquote unter Dreijähriger leicht
auf 37,8 % (2024: 37,4 %). Der Anstieg der
Betreuungsquote trotz rückläufiger
Betreuungszahlen ist darauf zurückzuführen,
dass die Gesamtzahl der Kinder unter drei
Jahren stärker zurückging als die Zahl der
betreuten Kinder dieser Altersgruppe.
Die Ursache dafür sind die sinkenden
Geburtenzahlen der vergangenen drei Jahre.
Auch die Zahl der insgesamt betreuten Kinder
ist gesunken, während die Zahl der Kitas und
die Zahl der Beschäftigten in
Kindertagesstätten weiter anstiegen.
Insgesamt 0,8 % weniger Kinder in
Kindertagesbetreuung
Insgesamt waren am
1. März 2025 bundesweit 4 059 400 Kinder in
Kindertagesbetreuung. Das waren 33 800 oder
0,8 % weniger als im Vorjahr. Damit war die
Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals
seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006
rückläufig, nachdem sie zuvor kontinuierlich
um durchschnittlich 60 500 Kinder pro Jahr
(+1,7 %) gestiegen war.
Bereits im
Jahr 2024 war der Anstieg nur gering
(+0,1 %).
Von den insgesamt betreuten
Kindern wurden 3 913 400 (96,4 %) in einer
Kindertageseinrichtung betreut.
146 000 Kinder (3,6 %) wurden in einer
öffentlich geförderten Kindertagespflege,
etwa durch Tagesmütter oder -väter, betreut.
Betreuungsquoten unter Dreijähriger im
Osten nach wie vor höher als im Westen
Bei den Betreuungsquoten unter dreijähriger
Kinder gibt es nach wie vor deutliche
Unterschiede zwischen den östlichen und
westlichen Bundesländern. So waren in den
östlichen Bundesländern (einschließlich
Berlin) zum Stichtag 1. März 2025
durchschnittlich mehr als die Hälfte aller
Kinder unter drei Jahren in einer
Tagesbetreuung (54,9 %).
In den
westlichen Bundesländern war die
Betreuungsquote mit 34,5 % nach wie vor
deutlich geringer. 0,6 % mehr Kitas, jedoch
5,9 % weniger Tagesmütter und -väter als im
Vorjahr Am 1. März 2025 gab es bundesweit
rund 61 000 Kindertageseinrichtungen. Das
waren etwa 400 oder 0,6 % mehr als im
Vorjahr. Die Zahl der dort als pädagogisches
Personal oder als Leitungs- und
Verwaltungspersonal beschäftigten Personen
stieg um 17 500 oder 2,2 % auf 795 700.
Damit wuchs die Zahl der Beschäftigten
in Kindertageseinrichtungen weiter, obwohl
die Zahl der betreuten Kinder zurückging.
Auch wenn der Anteil der Männer, die in der
Kindertagesbetreuung tätig sind, relativ
gering ist, steigt dieser stetig an. Am
1. März 2025 waren 67 400 Männer im
pädagogischen, Leitungs- und
Verwaltungsbereich in einer Kita
beschäftigt.
Im Vergleich zum
Vorjahr waren dies 2 600 oder 4,0 % mehr.
Der Männeranteil – bezogen auf alle tätigen
Personen in diesen Bereichen – lag damit bei
8,5 %. Im Gegensatz zum Kita-Personal sank
die Zahl der Tagesmütter und -väter im
fünften Jahr in Folge, und zwar um 2 300 auf
37 400 (-5,9 %).
Da die Zahl der
Tagesväter nahezu unverändert blieb
(-0,2 %), ist der Rückgang fast
ausschließlich auf die Tagesmütter
zurückzuführen. Der Männeranteil bei den
Tagespflegepersonen lag bei 4,5 %.
NRW: 2023 war jedes zwölfte
Unternehmen eine Neugründung
*
Gründungsrate in NRW mit 8,6 % über
Bundesschnitt.
* Regionale Gründungsrate
variiert von 6,6 % im Kreis Olpe bis zu
10,7 % in Herne.
* Höchste Gründungsrate
im Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung und
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen.
Von den insgesamt 665.434 in
Nordrhein-Westfalen aktiven Unternehmen sind
57.336 im Jahr 2023 neu gegründet worden;
rein rechnerisch handelte es sich damit um
8,6 % bzw. jedes zwölfte Unternehmen in NRW.
Wie das Statistische Landesamt anhand der
Ergebnisse der Unternehmensdemographie
mitteilt, lag die Gründungsrate im Land mit
8,6 % über dem für das gesamte Bundesgebiet
ermittelten Wert (8,4 %). Als Gründungsrate
wird der Anteil der in einem Jahr
gegründeten Unternehmen am gesamten
Unternehmensbestand desselben Jahres
bezeichnet.
Bezogen auf den
Gesamtbestand der aktiven
nordrhein-westfälischen Unternehmen
(665.434) ergibt sich eine Schließungsrate
von 8,8 %. Regionale Unterschiede bei
Unternehmensgründungen Insgesamt gab es die
meisten Neugründungen in den beiden größten
NRW-Städten Köln (5.054) und Düsseldorf
(3.487). Die höchste Gründungsrate konnte
Herne mit 10,7 % verzeichnen.
Auf den
weiteren Plätzen folgten Leverkusen (10,6 %)
und Duisburg (10,1 %). Die
geringsten Gründungsraten gab es im Kreis
Höxter und im Hochsauerlandkreis (mit
jeweils 6,9 %) sowie im Kreis Olpe (mit
6,6 %).
Gründungsraten variieren je
nach Wirtschaftszweig
Die höchste
Gründungsrate (11,1 %) wies der Bereich
Kunst, Unterhaltung, Erholung und Erbringung
von sonstigen Dienstleistungen auf. An
zweiter und dritter Stelle rangierten die
Wirtschaftszweige Information und
Kommunikation mit 10,9 % und Gastgewerbe mit
10,0 %. In allen drei aufgeführten Bereichen
lag die Anzahl der Gründungen über der
Anzahl der Schließungen.
Die
niedrigsten Gründungsraten fanden sich mit
6,0 % im Bereich Erziehung und Unterricht
sowie Gesundheits- und Sozialwesen und mit
6,7 % im Bergbau, Verarbeitenden Gewerbe,
Energie und Wasserversorgung. 14,4 % mehr
Gründungen als Schließungen in dem Bereich
Kunst, Unterhaltung, Erholung und Erbringung
von sonstigen Dienstleistungen.
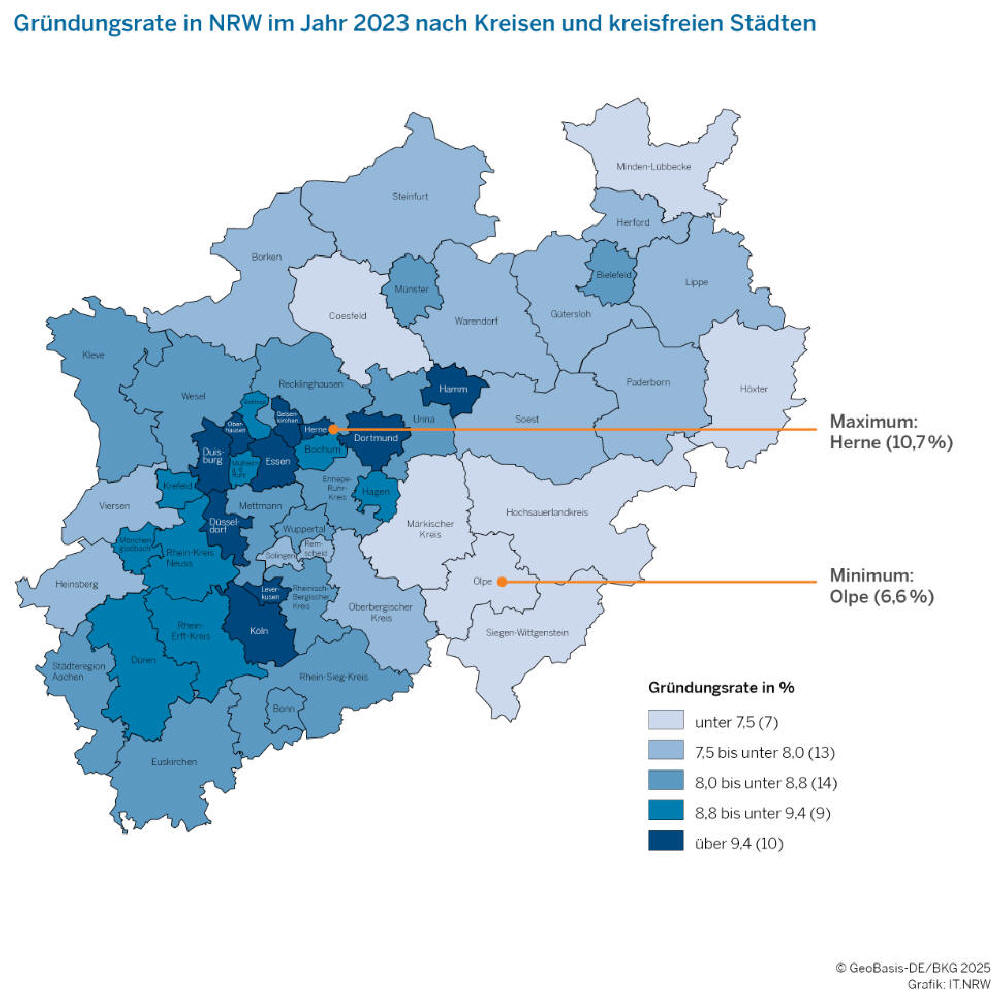
Der prozentuale Unterschied zwischen
Gründungen und Schließungen war im Bereich
Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Energie und
Wasserversorgung am größten: Hier gab es mit
23 % mehr Schließungen als Neugründungen. Im
Wirtschaftszweig Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks-
und Wohnungswesen, lag die Zahl der
Gründungen rund 21 % über der Zahl der
Schließungen.
„Wirtschaftsfaktor
Fachkräftemangel – Vereinbarkeit: Schlagwort
oder Maßnahme?“ Auftaktveranstaltung in
Wesel
Das Thema
lebensphasenorientierte Vereinbarkeit
gewinnt als Wirtschafts- und Standortfaktor
für Unternehmen im Kreis Wesel zunehmend an
Bedeutung. Um mit ansässigen Betrieben über
Chancen und Ansätze einer modernen
Personalpolitik ins Gespräch zu kommen, lädt
die Fachstelle Frau und Beruf des Kreises
Wesel Geschäftsleitungen und
Personalverantwortliche am Mittwoch, 12.
November 2025, von 13.45 bis 16.00 Uhr in
die FOM Hochschule Wesel ein.
Betriebswirtschaftliche Studien belegen,
dass eine an den Lebensphasen orientierte
Personalpolitik zum wirtschaftlichen Erfolg
beiträgt – gerade angesichts des anhaltenden
Arbeits- und Fachkräftemangels.
„Unternehmen, die auf die individuellen
Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden eingehen,
verzeichnen meist eine geringere Fluktuation
und sparen dadurch kostenintensive Maßnahmen
bei der Personalgewinnung und
-einarbeitung“, erläutert Landrat Ingo
Brohl.
„Zugleich fällt es solchen
Unternehmen leichter, neue Fachkräfte zu
gewinnen, wenn sie mit einer
vereinbarkeitsorientierten
Unternehmenskultur punkten können“, ergänzt
Lukas Hähnel, Leiter der EntwicklungsAgentur
Wirtschaft des Kreises Wesel. Im Rahmen der
Auftaktveranstaltung werden
Best-Practice-Beispiele vorgestellt und
diskutiert. „Oft sind es schon kleine
Stellschrauben, die eine große Wirkung
entfalten können. Zugleich gibt es nicht die
eine Lösung für alle“, betont Stefanie
Werner, Leiterin der Fachstelle Frau und
Beruf des Kreises Wesel.
Nach dem
Grußwort des Landrats hält Nadine Schöttler,
Gründerin des Institut Schöttler und
Trainerin für gesundes Arbeiten &
Vereinbarkeit, den Impulsvortrag „Systeme
verbinden – Warum Vereinbarkeit Teil der
Unternehmenskultur sein muss“.
Praxisbeispiele präsentieren Claudia Kuczera
(Gleichstellungsbeauftragte der LINEG
Kamp-Lintfort) und Silvia Sikkinga
(Personalleiterin Thermo Fisher Scientific
Wesel).
Mit der Veranstaltung soll
der Startschuss für das neue Netzwerk
„Unternehmenskultur: Vereinbarkeit im Kreis
Wesel“ gegeben werden. Es knüpft an das
frühere Netzwerk „Familienfreundlichkeit im
Unternehmen lohnt sich“ an und trägt den
Bedürfnissen moderner Belegschaften
Rechnung. „Unternehmen können bei diesem
Thema enorm voneinander profitieren – wenn
sie miteinander ins Gespräch kommen“, so
Stefanie Werner weiter.
Interessierte Unternehmen können sich über
folgenden Link anmelden:
https://beteiligung.nrw.de/k/1015726 Im
Anschluss an die Veranstaltung wird in der
FOM Wesel zudem die 14-tägige Ausstellung
„Väter am Niederrhein“ eröffnet. Die von der
Hochschule Rhein-Waal gemeinsam mit weiteren
Partnerinnen und Partnern initiierte
Wanderausstellung thematisiert die Übernahme
von Sorgearbeit durch Männer.
Sie ist
bis zum 25. November 2025 während der
Öffnungszeiten der FOM (Mo.–Fr., 10.00–18.00
Uhr) zu sehen. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen unter www.fom.de/wesel
Stadt Kleve am 11.
November 2025 vormittags geschlossen
Am 11. November 2025 findet die
Personalversammlung der Stadt Kleve statt.
Am Dienstag, 11. November 2025, wird die
Stadt Kleve aufgrund einer
Personalversammlung lediglich eingeschränkt
erreichbar sein.

Am Vormittag bleiben die meisten
Dienststellen bis 14:00 Uhr geschlossen.
Davon sind das Klever Rathaus samt
Bürgerbüro und Standesamt, die Stadtbücherei
und die Außenstelle Lindenallee 33 samt
Stadtarchiv betroffen.
Bereits
vereinbarte Termine in der Dienststelle an
der Lindenallee bei den Fachbereichen Arbeit
und Soziales – Jobcenter sowie Jugend und
Familie finden allerdings statt. Lediglich
die Volkshochschule Kleve sowie das Museum
Kurhaus Kleve werden vormittags zu den
regulären Zeiten öffnen. Damit einhergehend
sind die Mitarbeitenden der Stadt Kleve
vormittags auch telefonisch nur
eingeschränkt erreichbar und für die Zeit
der Personalversammlung kann die allgemeine
Telefonzentrale unbesetzt sein.
Nachmittags gelten wieder die regulären
Öffnungszeiten. Das bedeutet auch, dass das
Rathaus der Stadt Kleve wie gewohnt
dienstagnachmittags geschlossen bleibt. Die
Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt
Kleve GmbH samt Tourist-Info ist von der
Schließung nicht betroffen.
Kleve: Ideen zur Innenstadt-Umgestaltung
können jetzt besichtigt werden
Ausstellungseröffnung
Innenstadt-Umgestaltung
Seit
Dienstag ist die Ausstellung der Entwürfe
zur Modernisierung und Umgestaltung der
Klever Fußgängerzone eröffnet. Bürgermeister
Wolfgang Gebing begrüßte im Rahmen der
Eröffnungsveranstaltung neben Vertreterinnen
und Vertretern des siegreichen
Landschaftsarchitekturbüros, des
Wettbewerbsmanagements, aus Politik und
Wirtschaft auch zahlreiche interessierte
Bürgerinnen und Bürger in der Klever
Stadthalle.

Die Ausstellungseröffnung stieß am
Dienstagabend auf reges Interesse.
Dort sind noch bis nächste Woche Dienstag
alle 13 eingereichten Entwürfe der Büros
ausgestellt, die am Planungswettbewerb
teilgenommen haben. Neben Übersichtsplänen
und Detailansichten finden sich auf den
einzelnen Stellwänden auch textliche
Erläuterungen zu den Entwürfen sowie die
schriftliche Urteilsbegründung der Fachjury.
Bereits am Montag waren die
Einzelhändlerinnen und Einzelhändler zu
einem exklusiven ersten Blick auf die
Entwürfe eingeladen. Bürgermeister Gebing
und Verena Rohde, Geschäftsführerin der WTM
GmbH, machten deutlich, dass eine enge
Absprache mit den Innenstadtakteuren
besonders wichtig ist und diese stets in den
weiteren Planungsprozess eingebunden werden.
Zur Präsentation ihres prämierten
Entwurfes war am Dienstagabend auch ein Team
der wbp Landschaftsarchitekten GmbH
anwesend. Nachdem sie die Urkunde zum ersten
Platz im Planungswettbewerb von
Bürgermeister Gebing erhalten hatten,
erläuterten die Fachleute Herausforderungen
der gegenwärtigen Innenstadtgestaltung und
ihre kreativen Lösungen dafür.

Auch alle übrigen eingereichten Entwürfe
sind in der Stadthalle ausgestellt.
Die Planungen sehen vor, den Grünanteil in
der City deutlich zu erhöhen. Erreicht wird
das durch grüne Bänder aus
Verdunstungsbeeten mit schmalkronigen,
klimaresistenten Bäumen. Auch
Sitzgelegenheiten, Fahrradständer und
Straßenlaternen werden darin integriert.
Im Gegensatz zum aktuellen Baumbestand
werden die Bäume größer und raumwirksamer
sein und damit mehr kühlenden Schatten
spenden. Anstelle der in die Jahre
gekommenen Straßenbeleuchtung setzt der
Siegerentwurf auf moderne Lichtstelen mit
Strahlern für eine stimmungsvolle und
gezielte Beleuchtung.
Der bestehende
Klinkerbelag wird im Fischgrätverband neu
verlegt und im Bereich der Plätze durch
hellere Klinkersteine aufgelockert. Weiter
ergänzt wird der Klinker durch eingefärbten
Beton, der sowohl als Material für die
Entwässerungsrinnen dienen wird als auch für
Trittsteine in Gebäudeeingängen.
Aus
demselben Beton werden neue Wasserbecken für
den Elsa- und den Kavarinerbrunnen
gefertigt, die mit Sitzkanten zum Verweilen
einladen. Ein völlig neues Wasserbecken ist
um die Kurfürsten-Statue auf dem
Dr.-Heinz-Will-Platz vorgesehen und wird
ebenfalls dieser Gestaltungslinie folgen.
Der Koekkoekplatz wird zudem durch ein
Baumdach aufgewertet.
Anschließend
bot die Veranstaltung gute Gelegenheiten
dazu, mit den Anwesenden in den Austausch
über die anstehende Umgestaltung der
Innenstadt zu kommen. Gebing zog am Abend
ein durchweg positives Fazit des
durchgeführten Planungswettbewerbes: „Der
Siegerentwurf schafft es, Kleves Innenstadt
neu zu gestalten, ohne jedoch die Identität
und den Charakter der Stadt zu verfälschen.
So kann ich mir die Zukunft Kleves
vorstellen und so kann sich die Stadt auch
stolz den Besucherinnen und Besuchern der
Landesgartenschau präsentieren“, so der
Bürgermeister.
Und weiter: „Ich war
selbst Preisrichter in dem Wettbewerb und
war von der Vielfalt der Arbeiten
begeistert. Es ist beeindruckend zu sehen,
wie sich Kleve in einigen Jahren
präsentieren kann.“
Neben den
genannten Planungen bietet die Ausstellung
der Entwürfe noch viele weitere Einzelheiten
zu entdecken. Zu den folgenden Zeiten kann
die Ausstellung in der Klever Stadthalle
besucht werden:
Donnerstag, 30.10.2025
17:00 – 19:00 Uhr
Freitag, 31.10.2025
15:00 – 17:00 Uhr
Samstag, 01.11.2025
14:00 – 16:00 Uhr
Montag, 03.11.2025
17:00 – 19:00 Uhr
Dienstag, 04.11.2025
17:00 – 19:00 Uhr
Experimentelle Druckwerkstatt in der vhs
Moers – Kamp-Lintfort
Experimentelles Drucken mit Stempeln,
Frottage (Abreibtechnik) und Materialdruck –
das bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort in
einem Workshop am Samstag, 8. November, an.
Ab 13 Uhr können Interessierte in den Räumen
der vhs, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, mit
eingefärbten Materialien Papier und Stoff
mit Motiven und Mustern gestalten.
Vorkenntnisse sind nicht unbedingt
erforderlich. Eine Materialliste gibt es bei
der Anmeldung, die bis zum 4. November
möglich ist. Eine vorherige Anmeldung ist
erforderlich und telefonisch unter 0 28 41 /
201- 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.
Moers: Workshop KEN-DAO –
Schwertkunst in Achtsamkeit
Präzision, Schnelligkeit und Kraft, aber
auch Konzentration sind bei der Schwertkunst
mit einem Bokken (jap. Holzschwert)
gefordert. Interessierte können am Samstag,
8. November, beim Kennenlernworkshop
‚KEN-DAO‘ der vhs Moers – Kamp-Lintfort die
Grundlagen der Schwerttechnik üben. Dabei
werden dynamische als auch meditative
Trainingsmethoden vorgestellt.
Der
Kurs beginnt um 14 Uhr in der Turnhalle des
Gymnasiums Adolfinum (Zugang über
Seminarstraße). Die Teilnahme ist ab 16
Jahren möglich. Bokken werden gestellt.
Interessierte können sich für den Workshop
telefonisch unter 0 28 41/ 201 – 565 oder
online unter www.vhs-moers.de anmelden.
DiscoverEU
feiert 40 Jahre Schengen mit 40.000 Tickets
für junge Reisende
Junge
Europäerinnen und Europäer erhalten ab heute
die nächste Chance auf ein kostenloses
Zug-Reiseticket. Da in diesem Jahr das
40-jährige Bestehen des Schengener Abkommens
gefeiert wird, also die Grundlage für das
heutige grenzfreie Reisen, stellt die
Europäische Kommission gleich 40.000
Reisetickets zur Verfügung.
Um sich
für ein Reiseticket zu bewerben, müssen
junge Menschen, die zwischen dem 1. Januar
2007 und dem 31. Dezember 2007 geboren sind,
ein kurzes Quiz über die EU auf dem
Europäischen Jugendportal ausfüllen.
Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber
haben die Möglichkeit, zwischen dem 1. März
2026 und dem 31. Mai 2027 bis zu 30 Tage
lang kostenlos zu reisen und erhalten eine
Ermäßigungskarte für öffentliche
Verkehrsmittel, Kultur, Unterkunft, Essen,
Sport und andere Dienstleistungen in 36
europäischen Ländern.
Vorschläge
für Reiserouten: Städte des Neuen
Europäischen Bauhauses und grüne Hauptstädte
Europas Junge Reisende können ihre eigenen
Routen planen oder sich von bestehenden
Routen wie der Route
des Neuen Europäischen Bauhauses inspirieren
lassen, die im Einklang mit der Initiative
des Neuen
Europäischen Bauhauses Haltestellen in
schönen, nachhaltigen und inklusiven Städten
umfasst.
Eine weitere ist die „Green
Route“ von DiscoverEU, die junge
Reisende zu einigen der nachhaltigsten und
umweltfreundlichsten Reiseziele auf dem
gesamten Kontinent führt, wie den
Gewinnerstädten der
Auszeichnung „Grüne Hauptstädte Europas“ und
„Grüne Hauptstädte“ oder den Städten,
die die Mission
„Klimaneutrale und intelligente Städte“ leiten.
Die besten grünen
Reisetipps von DiscoverEU helfen den Teilnehmern
bei der Planung ihrer grünen Routen.
So läuft die Bewerbung: Die
DiscoverEU-Aufforderung wird am 30. Oktober
um 12:00 Uhr MEZ eröffnet und läuft bis zum
13. November 2025 um 12:00 Uhr MEZ. Es steht
Bewerbern aus der Europäischen Union und mit
dem Programm Erasmus+ assoziierten
Drittländern offen. Teilnehmer mit
Behinderungen oder gesundheitlichen
Problemen werden auf ihren Reisen im
Einklang mit den Werten des Programms
Erasmus+ und der DiscoverEU-Inklusionsaktion
unterstützt.
Dazu gehört auch die
Möglichkeit, mit Begleitpersonen zu reisen.
Das Jugendinformationsnetzwerk Eurodesk
beantwortet alle Fragen zu DiscoverEU und
informiert auch über Alternativen. Eurodesk
Deutschland hat ein Infoblatt über
DiscoverEU und über weitere Reisestipendien
für junge Menschen produziert. Die
Infoblätter können hier kostenlos
angefordert werden. Eurodesk-Telefon: 0228
9506 250, E-Mail: rausvonzuhaus@eurodesk.eu.
Hintergrund
Die Kommission hat DiscoverEU im
Juni 2018 auf Initiative des Europäischen
Parlaments ins Leben gerufen. Heute ist es
Teil des Programms
Erasmus+ 2021-2027.Seit 2018 haben sich
mehr als 1,6 Millionen junge Menschen für
391.000 Reisepässe beworben. DiscoverEU hat
jungen Menschen ein besseres Verständnis
anderer Kulturen und der europäischen
Geschichte vermittelt und ihre
Sprachkenntnisse verbessert.
Verfassungsbeschwerde gegen das
Polizeibeauftragtengesetz NRW eingegangen
Die Deutsche Polizeigewerkschaft NRW hat
Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz über
die unabhängige Polizeibeauftragte oder den
unabhängigen Polizeibeauftragten des Landes
Nordrhein-Westfalen
(Polizeibeauftragtengesetz NRW) beim
Verfassungsgerichtshofs in Münster
eingelegt.
Sie rügt eine Verletzung
der verfassungsmäßigen Rechte ihrer
Mitglieder und sieht sich auch in ihrer
Koalitionsfreiheit betroffen. Weiter macht
sie geltend, dass das Gesetz gegen das
Prinzip der Gewaltenteilung verstoße. Es
ermögliche in verfassungswidriger Weise
doppelte Ermittlungsakte, indem es dem
unabhängigen Polizeibeauftragten gestatte,
abgeschlossene Verfahren bzw. selbstständig
neben strafrechtlichen Verfahrenshandlungen
eigene Ermittlungen aufzunehmen. Außerdem
sei die Unabhängigkeit des
Polizeibeauftragten nicht gewährleistet.
Aktenzeichen: VerfGH 84/25.VB-3
Arbeiten im Ruhestand verbreitet –
55 Prozent der mitbestimmten Betriebe
beschäftigen Rentner*innen oder
Pensionär*innen
Die
Beschäftigung von Rentner*innen und
Pensionär*innen ist in vielen Betrieben und
öffentlichen Dienststellen verbreitet. Das
zeigt eine neue Auswertung der Betriebs- und
Personalrätebefragung des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Mehr als die
Hälfte der befragten knapp 3.700 Betriebs-
und Personalräte berichtet, dass in ihren
Einrichtungen Menschen über das Renten- oder
Pensionsalter hinaus tätig sind. Diese
Beschäftigung folgt oft einem stabilen
Muster: 82,5 Prozent der Betriebs- und
Personalräte, in deren Betriebe
Ruheständler*innen arbeiten, berichten, dass
die Betroffenen bereits vor Renten- oder
Pensionsbeginn in derselben Einrichtung
tätig waren. Und wenn sie weiterbeschäftigt
werden, führen sie auch in der Regel ihre
bisherige Tätigkeit fort.
Rentner*innen und Pensionär*innen gehen
ihrer Arbeit jedoch meist mit reduzierter
Stundenzahl und ganz überwiegend in Minijobs
nach. „Offensichtlich ist also unter den
bestehenden Rahmenbedingungen bereits viel
möglich und die Beschäftigung dieser
Personengruppe folgt auch den Wünschen und
Fähigkeiten der Betreffenden und den
Einsatzmöglichkeiten in Branchen und
Betrieben“, schreiben die Studienautoren Dr.
Florian Blank und Dr. Wolfram Brehmer. Die
Befunde sind auch vor dem Hintergrund
aktueller politischer Diskussionen
interessant.
Die Bundesregierung
will über Steuererleichterungen
(„Aktivrente“) sowie vereinfachte
Befristungsmöglichkeiten die Beschäftigung
im Rentenalter fördern. Die Wissenschaftler
warnen vor Nebenwirkungen der Pläne: Im
ungünstigsten Fall könnten Arbeitgeber die
geplante Förderung missbrauchen, um Ältere
auszunutzen und Löhne zu drücken. Die
WSI-Befragung ist repräsentativ für Betriebe
und Dienststellen mit mehr als 20
Beschäftigten und Betriebs- oder
Personalrat.
Die Daten von 2023
zeigen, dass rund 55 Prozent der
mitbestimmen Betriebe Menschen beschäftigen,
die eine Altersrente oder Pension beziehen.
Dabei unterscheiden sich Privatwirtschaft
und öffentlicher Dienst kaum voneinander. In
den genannten Betrieben machen Beschäftigte
im Rentenalter 1,4 Prozent der Belegschaft
aus. Überdurchschnittlich häufig arbeiten
sie in kleineren Betrieben und in
Dienstleistungsbranchen.
In der
Befragung sollten Betriebs- und Personalräte
auch angeben, aus welchen Gründen Ältere
weiterbeschäftigt werden. 86 Prozent sagten,
Wissen und Fähigkeiten der Älteren würden im
Betrieb weiter gebraucht. Knapp 57 Prozent
gaben zu Protokoll, dass keine anderen
Arbeitskräfte verfügbar gewesen seien und
fast ebenso viele, dass sich Rentner*innen
und Pensionär*innen flexibel einsetzen
ließen.
Andere Gründe – Jüngere
einarbeiten, Kostenersparnisse – spielten
eine geringere Rolle. 89 Prozent gaben zudem
an, dass mit der Weiterbeschäftigung den
Interessen der Rentner*innen entsprochen
werde. Ruheständler*innen werden am
häufigsten in Form von Minijobs
weiterbeschäftigt. Dies gilt vor allem für
die private Wirtschaft. In aller Regel
arbeiten Ruheständler*innen, die im alten
Betrieb weiterbeschäftigt sind, auch in
ihrem alten Tätigkeitsbereich.
Dabei
genießen sie üblicherweise keine
Vergünstigungen in Form von weniger
anstrengenden Aufgaben oder weniger
Verantwortung. Sie werden „eingesetzt und
behandelt wie jüngere Beschäftigte“, so die
Forscher. Im Vergleich zu Jüngeren haben sie
aber meist eine geringere Wochenarbeitszeit,
können ihre Arbeitszeiten relativ stark
selbst bestimmen und müssen keine Nacht- und
Schichtarbeit leisten.
Es sei schwer
zu sagen, ob die „Aktivrente“ und
erleichterte sachgrundlose Befristungen zu
noch mehr Beschäftigung im Rentenalter
beitragen könnten, schreiben Blank und
Brehmer. Zumal viele Beschäftigte lieber
früher als später in den Ruhestand wechseln
möchten und auch viele Unternehmen
Möglichkeiten für einen früheren Ausstieg
aus dem Arbeitsleben anbieten.
Die
Wissenschaftler sehen aber eine gewisse
Gefahr darin, dass die geplanten
Gesetzesänderungen einen neuen
„zweitklassigen Arbeitnehmer*innenstatus“
schaffen könnten, mit älteren Beschäftigten,
die arbeitsrechtlich weniger geschützt sind
als ihre jüngeren Kolleg*innen. „Im
schlimmsten Fall würde die Verbindung aus
der Rente beziehungsweise Pension und der
Steuererleichterung im Sinne eines
Kombilohns wirken“, erklären Blank und
Brehmer. Dann liefe es auf eine
Subventionierung von Unternehmen hinaus, die
Ältere – die dank Rente weniger auf den
Verdienst angewiesen sind – mit geringeren
Löhnen abspeisen könnten.
Das könnte
wiederum Druck auf die Einkommen der regulär
Beschäftigten ausüben. „Anstelle der
geplanten Änderungen, deren Wirkungen völlig
unklar sind und die für den Staatshaushalt
eine deutliche Belastung darstellen können,
sollte der Fokus auf gute Arbeit, auf die
Gesundheit der Beschäftigten und auf
Anerkennung ihrer Leistungen gelegt werden“,
sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die
wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Davon
würden alle Beschäftigten, jüngere wie
ältere, profitieren und sicher würden auch
die Fähigkeit und die Bereitschaft steigen,
länger zu arbeiten.“
Neukirchen-Vluyn: Interne
Schulung für das Beraterteam - Geänderte
Servicezeiten in den Enni-Kundenzentrum
Das Beraterteam der
Enni-Unternehmensgruppe kommt am Freitag, 7.
November, zwischen elf und 13 Uhr, zu einer
internen Schulungsmaßnahme zusammen. Dadurch
endet die Servicezeit im Neukirchen-Vluyner
Kundenzentrum ausnahmsweise bereits um zehn
Uhr. Im Moerser Kundenzentrum sind die
Beratungskräfte in der Steinstraße von 14
bis 18 Uhr erreichbar.
Die
Servicetelefone bleiben auch an diesem Tag
durchweg von zehn bis 18 geschaltet. Wie
immer gilt zudem, dass ein
Bereitschaftsdienst für besondere Notfälle
unter der Moerser Rufnummer 02841/104-114
jederzeit erreichbar ist.
Recycling von IT-Geräten
Studie: Mit gebrauchten IT-Geräten
Treibhausgase reduzieren
Fraunhofer UMSICHT untersuchte für
Interzero, wie nachhaltig der Einsatz
gebrauchter IT-Geräte ist. Die Ergebnisse
zeigen: Erhalten Smartphones, Tablet- & Co. ein
zweites Leben, lassen sich bis zu 37 Prozent
Treibhausgase einsparen.
© Fraunhofer UMSICHT Wie nachhaltig ist der
Einsatz gebrauchter IT-Geräte? Wie nachhaltig
ist der Einsatz gebrauchter Technik wirklich?
Dieser Frage sind der
Kreislaufwirtschaftsdienstleister Interzero und
Fraunhofer UMSICHT nachgegangen. Das Ergebnis:
Vor allem die Wiederaufbereitung gebrauchter
Smartphones trägt entscheidend zur Vermeidung
von Treibhausgasemissionen bei. Die Studie
»Treibhausgaseinsparungen durch Wiedernutzung
ausgewählter IKT-Geräte« fokussiert aktuelle
Daten zur Umweltwirkung wiederverwendeter
IT-Geräte und nimmt dafür den ökologischen
Fußabdruck von Smartphone, Tablet & Co. bei
konventioneller und verlängerter Nutzung in den
Blick.
Besonders im Fokus stehen dabei
die Treibhausgasemissionen. Reused Smartphones
mit größtem Einsparpotenzial Die Ergebnisse
verdeutlichen erneut die Relevanz zirkulärer
Lösungen im Elektroniksektor: Je nach Gerätetyp
lassen sich durch Reuse oder Refurbishment
zwischen 18 und 37 Prozent der
Treibhausgasemissionen einsparen. Mit 34,7 kg
THG-Emissionen fallen die Einsparungen durch die
verlängerte Produktlebensdauer bei Smartphones
besonders hoch aus.
Im Vergleich zu
einem einmaligen konventionellen Lebenszyklus
verursacht die erneute Nutzung eines Smartphones
rund 37 Prozent weniger THG-Emissionen. Erneut
genutzte Tablets sparen rund 34 Prozent (59,4 kg
THG-Emissionen). Gelangt ein Laptop ins
Refurbishment, liegen die Einsparungen bei rund
31 Prozent (107 kg) und bei Desktop-PCs bei
circa 18 Prozent (163 kg) gegenüber der
konventionellen Lebensdauer.
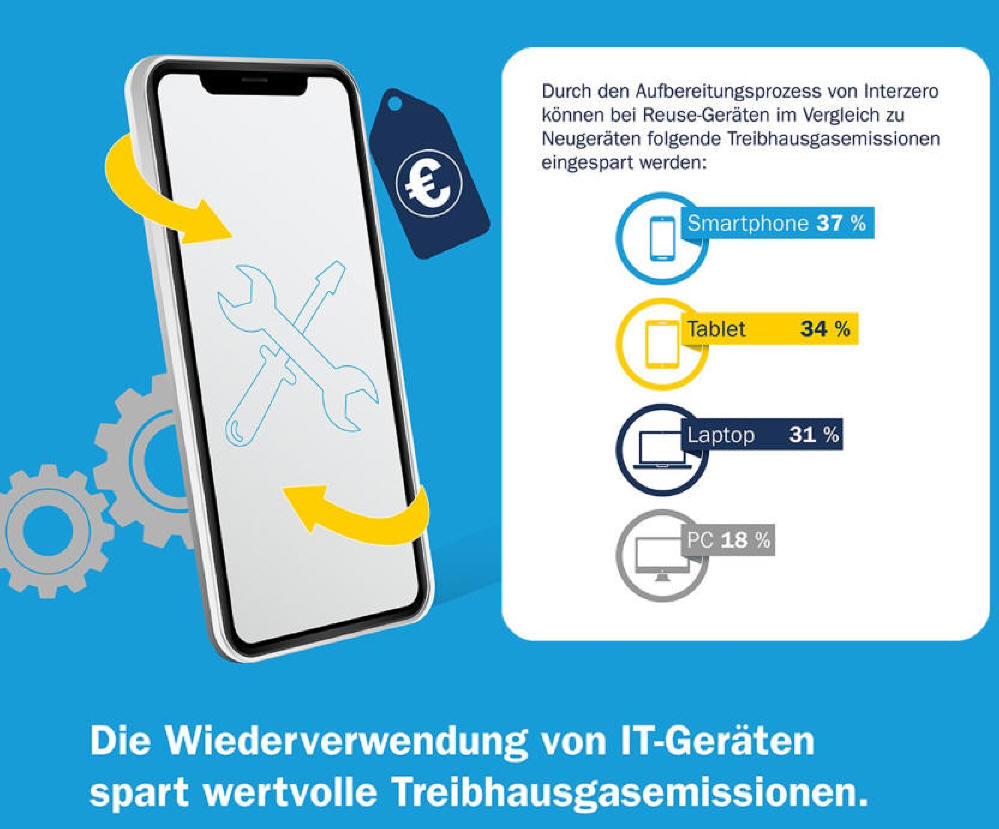
© Fraunhofer UMSICHT
»Die
Studienergebnisse machen deutlich, dass
nachhaltiges Wirtschaften und wirtschaftliche
Chancen Hand in Hand gehen können. Refurbishment
und Reuse schaffen neue Wertschöpfungspotenziale
und tragen gleichzeitig maßgeblich zur Schonung
unseres Planeten bei«, erklärt Philipp
Rittershaus, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei
Fraunhofer UMSICHT.
Über die Studie
Die Untersuchung »Treibhausgaseinsparungen durch
Wiedernutzung ausgewählter IKT-Geräte« basiert
auf einer Lebenszyklusanalyse, bei der alle
Phasen (Ressourcengewinnung, Produktion,
Distribution, Nutzung, Entsorgung) des
Produktlebenszyklus berücksichtigt wurden, sowie
auf Primärdaten von Interzero zu allen Aufwänden
der Aufbereitung.
Es
wurden zwei Nutzungsszenarien analysiert: Reuse
(Berücksichtigung weiterer Schritte wie
Aufbereitung, Transport und einer zweiten
Nutzungsphase) und Refurbishment
(Berücksichtigung des Austausches einzelner
Komponenten zusätzlich zu Reuse). Die
ermittelten Einsparungen orientieren sich an den
jeweiligen Aufbereitungsprozessen von Interzero.
Analysiert wurden die Produktlebenszyklen von
Smartphones und Tablets mit Fokus auf das
Reuse-Nutzungsszenario sowie die von Notebooks
und Desktop-PCs mit Fokus auf das
Refurbishment-Nutzungsszenario.
Kleve: Spiel
und Theater – Eine Entdeckungsreise für die
Kleinsten
Di., 04.11.2025 -
16:45 Uhr
Lust auf eine spannende
Entdeckungsreise in die Welt des Theaters?
Dann ist der Kinderkurs „Spiel und Theater“
genau das Richtige! Jeden Dienstag tauchen
die Kleinen zusammen mit Dozentin Sarah
Aballo in eine bunte Welt voller Fantasie,
Bewegung und Schauspiel ein. Hier können die
Kinder Kreativität ausleben, ihre
Vorstellungskraft stärken und ganz nebenbei
auch Teamarbeit und Kommunikation lernen.
Was erwartet die Kinder?
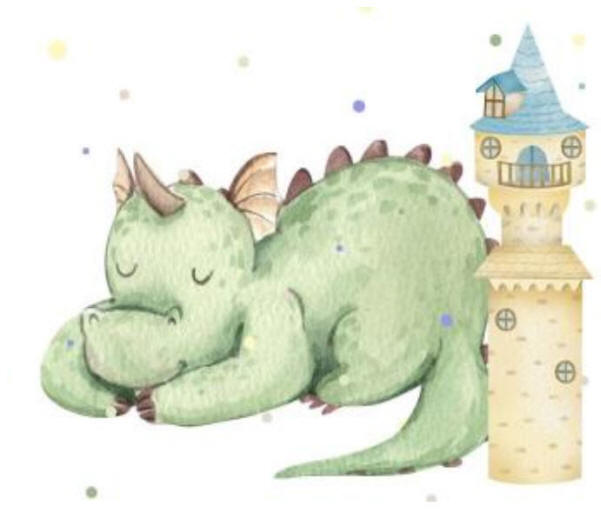
• Spaßige Theaterübungen • spielerisches
Erforschen von Rollen und Geschichten •
Improvisation und kreative Ausdrucksformen
• eine bunte Mischung aus Bewegung und
Schauspiel
Schulausschuss
beschließt aktualisierte
Distanzunterrichtsverordnung
Der Schulausschuss des
nordrhein-westfälischen Landtags hat eine
Änderungsverordnung des Schulministeriums
zum Distanzunterricht beschlossen. Ziel der
Anpassung ist es, den Anspruch aller Kinder
und Jugendlichen auf schulische Bildung und
Erziehung auch dann sicherzustellen, wenn
vorübergehend kein Unterricht in Präsenz
möglich ist. Dabei bleibt der
Präsenzunterricht weiterhin zentraler
Bestandteil des schulischen Bildungsauftrags
und behält seinen Vorrang.
Schulministerin Dorothee Feller hob hervor,
dass sich viele Schulen die mit der
Änderungsverordnung verbundene Klarstellung
auch gewünscht hätten: „Mit der
Aktualisierung der
Distanzunterrichtsverordnung stellen wir
sicher, dass Schülerinnen und Schüler auch
in besonderen Ausnahmesituationen nicht auf
ihre schulische Bildung verzichten müssen.
Gleichzeitig halten wir am Grundsatz
fest: Präsenzunterricht ist und bleibt die
beste Form des Lernens und sozialen
Miteinanders. Distanzunterricht bleibt auf
das notwendige Maß begrenzt und dient der
kurzfristigen Überbrückung, wenn eine
Nutzung des Schulgebäudes vorübergehend
nicht möglich ist.“
Die neue
Verordnung erweitert die bisherigen
Anwendungsfälle – epidemisches
Infektionsgeschehen und Extremwetterlagen –
um zwei weitere Situationen: Zum einen kann
Distanzunterricht künftig stattfinden, wenn
das Schulgebäude aufgrund einer religiösen,
wissenschaftlichen oder kulturellen
Veranstaltung von landes- oder bundesweiter
Bedeutung vorübergehend nicht zur Verfügung
steht.
Zum anderen ist
Distanzunterricht möglich, wenn ein
unvorhersehbares Ereignis wie ein Großbrand,
Hochwasser, eine akute Bedrohungslage oder
ein anderer Katastrophenfall eine konkrete
Gesundheitsgefahr darstellt und keine
kurzfristige Ausweichmöglichkeit besteht. In
solchen Fällen ist der Distanzunterricht in
der Regel auf fünf Tage begrenzt; eine
Verlängerung kann durch die obere
Schulaufsichtsbehörde gewährt werden.
In beiden neu geregelten Fällen ist die
Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde
einzuholen, um eine einheitliche Anwendung
zu gewährleisten. Schulministerin Feller
abschließend: „Die Änderungen wahren somit
den Vorrang des Präsenzunterrichts und
schaffen zugleich mehr Handlungssicherheit,
damit die schulische Bildung auch in
Ausnahmesituationen zuverlässig fortgeführt
werden kann.“
Telefonischer
Rat bei Inkontinenz - Ärzt:innen der
Frauenklinik Bethanien beantworten am 06.
November 2025 Fragen zu Inkontinenz bei
Frauen
Frauen, die von
Inkontinenz betroffen sind, haben mit einer
Telefonsprechstunde am Donnerstag, 06.
November 2025, von 14 bis 17 Uhr die
Möglichkeit, ihre Fragen direkt an
Ärzt:innen der Klinik für Gynäkologie,
Geburtshilfe, Gynäkologische Onkologie &
Senologie am Krankenhaus Bethanien zu
richten.
Durch das telefonische
Beratungsangebot unter der Telefonnummer +49
(0) 2841 200 20526 möchten Chefarzt Dr.
Peter Tönnies, die Leitende Oberärztin Dr.
Almut Raabe, Oberärztin Michèle Hamers und
Oberarzt Amjad Shihabi über das
vermeintliche Tabuthema aufklären. Unter
Inkontinenz zu leiden, sei oft mit Scham
behaftet. Die Telefonsprechstunde stelle
eine gute Möglichkeit für Frauen dar, sich
anonym von zu Hause aus beraten zu lassen,
so die Spezialist:innen.
„Keine Frau
muss mit ungewolltem Urinverlust leben“,
erklärt Chefarzt Dr. Peter Tönnies. Auch
sehr häufiges Wasserlassen oder Druck- bzw.
Fremdkörpergefühl im Scheidenbereich seien
typische Beschwerden. „Es gibt eine Vielzahl
konservativer und operativer
Behandlungsmethoden mit sehr guten Erfolgen.
Oft ist keine oder nur eine minimal-invasive
Operation nötig und führt zur deutlichen
Verbesserung der Lebensqualität.“
Gemeinsam informieren die vier Expert:innen
über die Erkrankung, mögliche Ursachen sowie
Behandlungsmöglichkeiten und beraten
Anruferinnen aller Altersklassen
individuell. Die Klinik für Gynäkologie,
Geburtshilfe, Gynäkologische Onkologie &
Senologie am Krankenhaus Bethanien ist von
der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e. V.
als spezielle Inkontinenz-Beratungsstelle
zertifiziert.

Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Klinik für
Gynäkologie, Geburtshilfe, Gynäkologische
Onkologie & Senologie, Oberarzt Amjad
Shihabi, Oberärztin Michèle Hamers und Dr.
Almut Raabe, Leitende Oberärztin der Klinik
(v. l.), beantworten telefonisch Fragen zum
Thema Inkontinenz bei Frauen.
Unternehmenskommunikation & Marketing
Telefon: 2702

NRW-Inflationsrate liegt im
Oktober 2025 bei 2,3 %
* Preise
für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
im Vergleich zu Oktober 2024 um 2,1 %
gestiegen.
* Molkereiprodukte und Eier
wurden um 2,8 % teurer, Speisefette und -öle
um 13,0 % günstiger.
Die
Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen –
gemessen als Veränderung des
Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat –
liegt im Oktober 2025 bei 2,3 %. Wie
Information und Technik Nordrhein-Westfalen
als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg
der Preisindex gegenüber dem Vormonat
(September 2025) um 0,4 %. Der
Verbraucherpreisindex unter Ausschluss der
Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln und
Energie – oftmals auch als Kerninflation
bezeichnet – ist zwischen Oktober 2024 und
Oktober 2025 um 2,6 % gestiegen.
Vorjahresvergleich: Obst wurde teurer,
Gemüse günstiger Zwischen Oktober 2024 und
Oktober 2025 sind die Preise für
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um
2,1 % gestiegen. Überdurchschnittliche
Preissteigerungen verzeichneten z. B.
Bohnenkaffee (+23,1 %), Obst (+3,7 %) sowie
Molkereiprodukte und Eier (+2,8 %).
Günstiger als im Vorjahresmonat wurden u. a.
Speisefette und -öle (−13,0 %) sowie Gemüse
(−4,4 %) angeboten.
Bei den
Haushaltsenergien wurden Strom (+3,0 %) und
Fernwärme (+0,5 %) teurer. Heizöl (−8,1 %)
und Gas (−0,1 %) verzeichneten rückläufige
Preise. Verkehrsteilnehmende mit Auto, Bus
und Bahn mussten im Oktober 2025 mehr
ausgeben als noch im Oktober 2024. So
stiegen z. B. die Preise für
Dieselkraftstoff (+1,3 %), Benzin (+0,8 %)
und für kombinierte
Personenbeförderungsleistungen (+11,6 %).
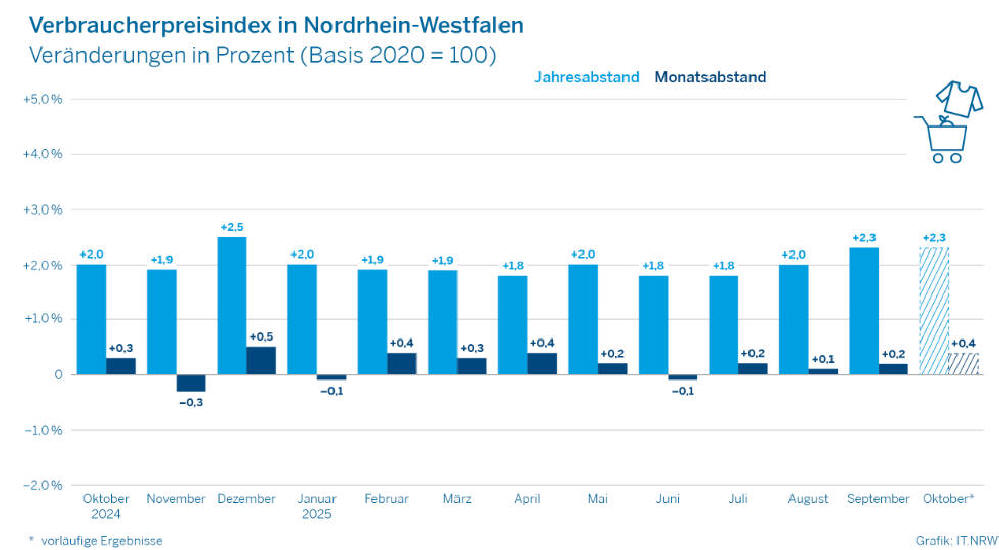
Überdurchschnittlich hohe
Preissteigerungen bei Dienstleistungen
wurden für Übernachtungen (+5,2 %) und
Versicherungsdienstleistungen (+5,5 %)
ermittelt. Vormonatsvergleich: Äpfel um 13,5
% günstiger als im September 2025.
Zwischen September 2025 und Oktober 2025
sanken im Lebensmittelbereich z. B. die
Preise für Äpfel um 13,5 %, Gurken um 10,5 %
und Butter um 10,0 %. Alkoholfreies Bier
inklusive Malzbier (+6,9 %), Tomaten
(+6,2 %), Obstkonserven (+6,1 %) und
Schokoladentafeln (+4,6 %) wurden
beispielsweise binnen Monatsfrist teurer
angeboten.
72 000 Menschen
ohne Krankenversicherungsschutz
• Weniger als 0,1 % der
Gesamtbevölkerung im Jahr 2023 betroffen
• 11 % der Versicherten sind privat
krankenversichert
Im Jahr 2023 waren
in Deutschland rund 72 000 Menschen nicht
krankenversichert und hatten auch keinen
sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
auf der Grundlage eines alle vier Jahre
erhobenen Zusatzmoduls im Mikrozensus
mitteilt, waren damit weniger als 0,1 % der
Bevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz.
Betroffen waren überwiegend Männer
(61 % beziehungsweise 44 000). Drei Viertel
(75 % oder 54 000) aller Personen ohne einen
entsprechenden Schutz waren
Nichterwerbspersonen wie Rentnerinnen und
Rentner oder Studierende ab dem 26.
Lebensjahr. In Deutschland besteht eine
Krankenversicherungspflicht für alle
Personen mit Wohnsitz im Inland.
Weitere 198 000 Menschen waren zwar nicht
krankenversichert, hatten aber dennoch einen
Anspruch auf Krankenversorgung. Dazu können
beispielsweise Asylsuchende, Empfängerinnen
und Empfänger von Sozialhilfe, sowie
freiwillige Wehrdienstleistende gehören.
Familienangehörige etwas häufiger privat
mitversichert Jede neunte Person (11 %) in
Deutschland war im Jahr 2023 privat
krankenversichert.
Das waren gut
9,0 Millionen Menschen, darunter knapp
2,4 Millionen Familienversicherte.
Demgegenüber waren 89 % beziehungsweise
73,3 Millionen Menschen gesetzlich
versichert, darunter 16,8 Millionen als
familienversicherte Angehörige.
Familienangehörige werden im Vergleich zu
Versicherten insgesamt etwas häufiger privat
mitversichert als gesetzlich: Bei ihnen
betrug der Anteil der privat Versicherten
12 %. Knapp 5,1 Millionen Menschen waren
freiwillig gesetzlich versichert – das
betrifft zum Beispiel Selbständige oder
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem
Bruttoeinkommen über der sogenannten
Jahresarbeitsentgeltgrenze. Sie machten 7 %
der gesetzlich Versicherten aus.
Baumschulen 2025: Rund 11 % weniger
Betriebe und Flächen als 2021
-
Anbaufläche von Bäumen für Parks, Alleen und
Straßen steigt entgegen dem Gesamttrend um
rund 16 %
- Anteil von Laubbäumen steigt
bei der Anzucht von Forstpflanzen auf über
57 % - Niedersachsen weiterhin Bundesland
mit den meisten Baumschulen
Im Jahr
2025 bewirtschaften in Deutschland 1 368
landwirtschaftliche Betriebe zusammen rund
15 350 Hektar Baumschulfläche. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
waren das 10,9 % oder 168 Betriebe weniger
als bei der vorherigen Erhebung im Jahr
2021. Die Baumschulfläche ging in diesem
Zeitraum um 10,5 % oder 1 810 Hektar zurück.
Gegenüber 2017 sank die Zahl der
Baumschulen um 20,2 % oder 346 Betriebe und
die bewirtschaftete Fläche um 17,5 %
oder 3 260 Hektar. Das Anbauspektrum der
Baumschulen umfasst unter anderem die
Kultivierung von Jungpflanzen der
Anbaugruppen Ziersträucher und Bäume,
Heckenpflanzen, Forstpflanzen, Obstgehölze,
Rosen und sonstige Gehölze wie
beispielsweise Koniferen, zu denen beliebte
Weihnachtsbaumarten zählen.
Dabei
liegen 97,8 % (15 010 Hektar) der
Baumschulfläche im Freiland. Knapp die
Hälfte der Betriebe (46,1 % bzw. 630)
verfügen über Produktionsflächen unter Glas
oder hohen begehbaren Schutzabdeckungen, die
zusammen 2,2 % (350 Hektar) der gesamten
Baumschulfläche ausmachen.
Mehr
Bäume für Parks, Alleen und Straßen trotz
weniger Baumschulen
Die bedeutendste
Anbaugruppe sind mit 6 770 Hektar die
Ziersträucher und Bäume (ohne
Forstpflanzen). Sie wachsen im Jahr 2025 in
1 003 Baumschulbetrieben auf 45,1 % der
gesamten Freilandfläche heran. Die
Produktion von Bäumen für Parks, Alleen und
Straßen ist hierbei die wichtigste
Nutzungsart: Obwohl die Zahl der
produzierenden Betriebe seit 2021 um 9,3 %
auf 622 Betriebe abnahm, stieg die Fläche
für die Anzucht dieser Bäume um 16,3 % auf
3 410 Hektar.
Die Ziersträucher und
Laubgehölze (ohne Heckenpflanzen) bilden
eine weitere bedeutende Nutzungsart in
dieser Gruppe. 745 Betriebe erzeugen auf
1 650 Hektar diese Pflanzen, wobei sowohl
die Zahl der Betriebe als auch die
bewirtschaftete Fläche gegenüber 2021 stark
rückläufig ist (-13,2 % bzw. -20,1 %). Mit
1 850 Hektar oder 12,3 % der Gesamtfläche im
Freiland steht die Anzucht von Gehölzen für
die Forstpflanzung an zweiter Stelle der
Nutzungsartengruppen.
Die Zahl der
Betriebe blieb hier mit 251 im Jahr 2025
nahezu unverändert gegenüber 2021
(250 Betriebe), obwohl die Fläche in diesem
Zeitraum um 8,4 % abnahm. Hielt sich die
Anzucht von Laub- und Nadelbäumen im Jahr
2021 mit jeweils rund 1 000 Hektar nahezu
die Waage, liegt der Schwerpunkt im Jahr
2025 mit 57,6 % der Anzuchtfläche auf den
Laubbäumen (+6,5 % auf 1 070 Hektar).
Die Jungpflanzenzucht von Nadelbäumen
verkleinerte sich dagegen um fast ein
Viertel (-23,1 % auf 790 Hektar).
Heckenpflanzen werden im Jahr 2025 auf
1 650 Hektar oder 11,0 % der gesamten
Baumschulfläche im Freiland von insgesamt
734 Betrieben angebaut. Mit 52,6 % und
47,4 % entfallen dabei jeweils ähnliche
Flächenanteile auf die Anzucht von Nadel-
und Laubgehölz-Heckenpflanzen.
Über
ein Viertel der Baumschulfläche befindet
sich in Niedersachsen Unverändert befinden
sich im Jahr 2025 die meisten Baumschulen
mit 346 Betrieben in Niedersachsen auf einer
Fläche von 4 060 Hektar, was einem Anteil
von mehr als einem Viertel (26,4 %) der
gesamtdeutschen Baumschulfläche entspricht.
Danach folgen Nordrhein-Westfalen
(293 Betriebe und 3 230 Hektar) und
Schleswig-Holstein (200 Betriebe und
2 630 Hektar).
IHK: „Berlin
erkennt Ernst der Lage nicht“
Unternehmer
sprechen mit Rouenhoff (CDU), Özdemir (SPD)
und van Beek (SPD)
Bis Sommer
sollte es der Wirtschaft spürbar besser
gehen. Das verkündete die Bundesregierung im
Frühjahr. Dann war von einem Herbst der
Reformen die Rede. Ende Oktober sei von
einem Aufbruch nichts zu spüren, machten
Unternehmer vom Niederrhein deutlich. Im
Gespräch mit drei Bundestagsabgeordneten
forderte Werner Schaurte-Küppers, Präsident
der Niederrheinischen IHK: „Mit etwas
Kosmetik ist es nicht getan. Wir brauchen
entschlossenes Handeln.“
Zu Gast war
Stefan Rouenhoff (CDU), Parlamentarischer
Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium. Ebenso die
Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir (SPD)
und der neu gewählte Sascha van Beek (SPD).
Sie trafen sich in Duisburg auf Einladung
der IHK mit 50 Unternehmern. „Die Lage ist
dramatisch. Der Mittelstand ächzt unter
hohen Steuern und Bürokratie. Mancher
Familien-Unternehmer muss aufgeben. Die
Industrie muss tausende Stellen streichen“,
warnt Schaurte-Küppers.

50 Unternehmer diskutierten mit den
Bundespolitikern über die Lage der
Wirtschaft.
Fotos: Niederrheinische
IHK/Gruppe C Photography
Herbst
bringt Stellenabbau statt Reformen
Ein
halbes Jahr ist die schwarz-rote
Bundesregierung im Amt. Von weniger
Bürokratie sei nichts zu spüren, sagt der
IHK-Präsident. Unternehmen warten zum Teil
jahrelang auf eine Baugenehmigung.
„Unvorstellbar. Aber das ist die Realität in
Deutschland und zeigt, woran wir kranken“,
so Schaurte-Küppers. Auch die Energiekosten
seien nicht wettbewerbsfähig, finden die
Unternehmer.
An die Abgeordneten
appellieren sie: „Hier müssen Sie dringend
etwas tun, sonst ist unsere Industrie bald
komplett erledigt.“ Nicht zu vergessen die
marode Infrastruktur: „NRW braucht schnelle
Hilfe und viel Geld. Wir sind die
Verkehrs-Drehscheibe Europas. Die Debatte
über die Finanzierung der Infrastruktur
erweckt den Eindruck: In Berlin wird der
Ernst der Lage nicht erkannt“, sagte
Schaurte-Küppers.

v.l.: IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan
Dietzfelinger, Bundestagsabgeordneter Sascha
van Beek, Stefan Rouenhoff,
Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium, IHK-Präsident
Werner Schaurte-Küppers und
Bundestagsabgeordneter Mahmut Özdemir.
Stahlgipfel gehört nach Duisburg
Besonders kritisch ist die Lage in der
Stahlbranche. Schaurte-Küppers: „Wir
brauchen einen besseren Schutz der
Stahlindustrie vor Dumping-Importen“ Auch
der geplante Stahlgipfel der Bundesregierung
ist laut IHK eine dringend nötige
Initiative. „Noch gibt es keinen Termin.
Klar ist aber: Der Gipfel gehört nach
Duisburg, wo Stahl gelebt wird“, betonte
Schaurte-Küppers. Sascha van Beek knüpfte
an: „Ich kann das nur unterstützen. Hier bei
uns in der Region geht es ja nicht nur um
ein paar Stahlhütten. Es geht um eine ganze
Region, um Arbeitsplätze und Familien, um
eine Wertschöpfungskette, die tief im
Mittelstand und Handwerk am gesamten
Niederrhein verwurzelt ist.“
Mahmut
Özdemir ergänzte: „Die Regierungskoalition
muss jetzt schnell die sozialen Fragen
unseres Landes mit der Förderung des
Wohlstandes beantworten. Dazu zählen für
mich das Halten von Arbeitsplätzen durch
einen günstigen Industriestrompreis, den
Hochlauf von Wasserstoff sowie die
Unabhängigkeit bei Grundstoffen in Stahl und
Chemie.“
Rouenhoff will Hürden
ausräumen
Stefan Rouenhoff räumte ein:
„Es ist in den letzten Jahren viel
liegengeblieben. Es gibt einen Reformstau in
unserem Land. Die neue Bundesregierung hat
sich auf den Weg gemacht, Deutschland nach
Jahren der Stagnation und Rezession wieder
auf Wachstumskurs zu bringen.
Das
Gebot der Stunde lautet: Bürokratie abbauen,
Planungs- und Genehmigungsverfahren
beschleunigen, Energiekosten auf ein
verträgliches Maß bringen, die
Innovationskraft im Mittelstand stärken,
unsere Handelsbeziehungen diversifizieren.“
Daran will der Parlamentarische
Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit
der IHK und anderen Wirtschaftsverbänden
arbeiten.
Die Niederrheinische IHK
vertritt das Gesamtinteresse von rund 70.000
Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel
und Dienstleistungen in Duisburg und den
Kreisen Wesel und Kleve. Sie versteht sich
als zukunftsorientierter Dienstleister und
engagiert sich als Wirtschaftsförderer und
Motor im Strukturwandel.
Moers: Bis zum 30. November Kita-Platz
online anmelden
Eltern, die ab dem 1. August
2026 einen Platz in einer Moerser
Kindertageseinrichtung benötigen, sollten
sich den 30. November 2025 im Kalender
markieren: Bis zu diesem Tag läuft die
Anmeldefrist über das Online-Portal
Kita-Online.

Hier können Familien bis zu drei
Wunscheinrichtungen angeben – und sollten
diese vorher unbedingt persönlich besuchen.
Die Besichtigung ist verpflichtend. Die
Platzvergabe erfolgt ausschließlich auf
Basis der Angaben in Kita-Online. Auch
bestehende Vormerkungen müssen bis zum 30.
November aktualisiert werden.
Wichtig: Wenn ein Kind bisher für den
U3-Bereich (unter drei Jahre) gemeldet war,
zum neuen Kindergartenjahr aber bereits drei
Jahre oder älter ist, muss der Eintrag neu
angelegt werden. Das Online-Tool bietet
außerdem viele Informationen zu den
einzelnen Kitas, ihren pädagogischen
Konzepten und Betreuungszeiten.
Wer
Unterstützung beim Ausfüllen benötigt, kann
sich gerne an die Mitarbeitenden der Stadt
Moers wenden. Sie helfen bei Fragen rund um
das Verfahren weiter. Kontakt unter Telefon
0 28 41 / 201- 353, 201-761 und 201-398.
Moers: Hier laufen die
‚Martinskinder‘
Auch in diesem Jahr ziehen die kleinen
und großen und Martinssängerinnen und
-sänger wieder singend „durch die Straßen
auf und nieder".
Hier die bisher aufgelisteten 37
angemeldeten Martinszüge.
Den
Auftakt machen die Regenbogenschule in
Meerfeld und die evangelische Kita in
Hülsdonk am Monta

Foto: pst
vhs Moers –
Kamp-Lintfort: Workshop ‚Samba Percussion
Band‘
Wer in die brasilianische
Rhythmuswelt eintauchen möchte, ist am
Samstag, 8. November, bei der vhs Moers –
Kamp-Lintfort richtig: Von 12 bis 16 Uhr
können Interessierte mit verschiedenen
Instrumenten gemeinsam zur ‚Samba Percussion
Band‘ zusammenwachsen.
Ausprobiert
werden können Surdotrommeln, Tamburins,
Ganzas (Rasseln), Apito (Trillerpfeife) und
Agogo-Glocken. Musiziert wird in den Räumen
der vhs Moers an der
Wilhelm-Schroeder-Straße 10. Sämtliche
Sambainstrumente (sowie Ohrstöpsel) können
beim Dozenten für 3 Euro geliehen werden.
Bitte unbedingt Turnschuhe mitbringen.
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich
und telefonisch unter 0 28 41/ 201 – 565
sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
Dinslaken: Konstituierende
Sitzung des neuen Rates am 6. November
Am Donnerstag, 6. November
2025, tritt der neu gewählte Rat der Stadt
Dinslaken zu seiner konstituierenden Sitzung
zusammen. Beginn ist um 17 Uhr in der
Kathrin-Türks-Halle. Die Sitzung ist
öffentlich, Interessierte sind herzlich
eingeladen. In dieser ersten Sitzung nach
der Kommunalwahl wird der Rat offiziell
seine Arbeit für die neue Wahlperiode
aufnehmen.
Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem die Verpflichtung der
60 Stadtverordneten, die Vereidigung des
neuen Bürgermeisters Simon Panke sowie die
Wahl der stellvertretenden
Bürgermeister*innen bzw. Bürgermeister. Auch
die Verabschiedung der Stadtverordneten, die
dem neuen Rat nicht mehr angehören, steht
auf der Tagesordnung.
Ein weiterer
Tagesordnungspunkt ist die Geschäftsordnung
des Rates und seiner Gremien. Den Vorsitz
der Sitzung führt gemäß der Gemeindeordnung
zunächst Heinz Brücker als dienstältestes
Ratsmitglied. Die vollständige Tagesordnung
ist im Ratsinformationssystem der Stadt
Dinslaken einsehbar: https://ris.dinslaken.de
Kleve:
Ausstellungseröffnung zur
Innenstadt-Umgestaltung
Mi.,
29.10.2025 - 00:00 - Di., 04.11.2025 - 00:00
Uhr
Bis zur Landesgartenschau im Jahr
2029 soll die Klever Innenstadt attraktiver
und klimaresilienter werden. Mit diesem Ziel
hatte die Stadt Kleve über den Sommer einen
Planungswettbewerb unter
Landschaftsarchitekturbüros veranstaltet, um
moderne Ideen für das Areal im Herzen der
Schwanenstadt zu sammeln.

Seit Anfang Oktober steht fest, welcher der
13 eingereichten Entwürfe die Grundlage für
die zukünftige Gestaltung der Klever
Innenstadt bildet – jetzt können sich alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger in der
Stadthalle über die konkreten Planungen
informieren.
Mittwoch, 29.10.2025,
17:00 – 19:00 Uhr, Donnerstag, 30.10.2025,
17:00 – 19:00 Uhr
Freitag, 31.10.2025,
15:00 – 17:00 Uhr, Samstag, 01.11.2025,
14:00 – 16:00 Uhr
Montag, 03.11.2025,
17:00 – 19:00 Uhr, Dienstag, 04.11.2025,
17:00 – 19:00 Uhr
Informative
Veranstaltung zur Brustgesundheit im
Mehrgenerationenhaus Bogen in Wesel: „Nichts
sollte Ihnen näher am Herzen liegen“
Am vergangenen Freitag, 24. Oktober 2025,
organisierten die Gleichstellungsbeauftragte
Regina Schmitz-Lenneps und die
Integrationsbeauftragte der Stadt Wesel,
Lotte Goldschmidtböing, einen spannenden
Vortrag zum Thema Brustgesundheit.

Frau Dr. med. Daniela Rezek, Chefärztin der
Senologie/Ästhetischen Chirurgie im
Brustkrebszentrum Wesel und Vorsitzende des
Vereins „Aktion B, Brustgesundheit am
Niederrhein“, teilte ihr umfangreiches
Fachwissen mit den interessierten
Teilnehmerinnen. Brustkrebs ist die
häufigste Krebserkrankung bei Frauen
weltweit, mit jährlich etwa 70.550 neuen
Fällen in Deutschland.
Trotz dieser
alarmierenden Zahlen gibt es Hoffnung.
Früherkennung und medizinische Fortschritte
haben die Heilungschancen erheblich
verbessert. Der Vortrag stieß auf großes
Interesse und fand bei den Anwesenden großen
Anklang. Es wurde deutlich, wie wichtig das
Thema Brustgesundheit ist und wie
entscheidend es ist, sich aktiv mit diesem
Thema auseinanderzusetzen. Links
Frauen und Gleichstellung
Winterdienst
auf den Kreisstraßen des Kreises Wesel
Damit die Verkehrsteilnehmenden
auch in der kalten Jahreszeit sicher ans
Ziel kommen, ist der Bauhof des Kreises
Wesel auf alle Wetterlagen gut vorbereitet.
Auf insgesamt 192 Kilometer Fahrbahn und 183
Kilometer Radweg ist der Kreis Wesel für den
Winterdienst auf den Kreisstraßen des
Kreises Wesel zuständig. Hierfür stehen dem
Kreisbauhof 20 einsatzbereite Mitarbeitende,
sechs speziell ausgerüstete Fahrzeuge,
60.000 Liter Sole und 400 Tonnen Streusalz
zur Verfügung.
In einem gemeinsamen
Notlager mit der Stadt Wesel befinden sich
zudem weitere 600 Tonnen Streusalz. Jens
Kampen, Leiter des Kreisbauhofs: „Unsere
Mitarbeitenden beginnen ab drei Uhr mit den
Streu- und Räumfahrten, um die Fahrbahnen
vor dem Berufsverkehr sicher befahrbar zu
halten. Bei sogenannten Großwetterlagen
erfolgt der Streu- und Räumeinsatz rund um
die Uhr. Natürlich muss sich aber auch jeder
Verkehrsteilnehmer und jede
Verkehrsteilnehmerin auf die jeweiligen
Witterungsverhältnisse einstellen und
entsprechend verhalten.“
Bei den
Streueinsätzen wird systematisch nach
definierten Dringlichkeitsstufen
vorgegangen. Hierbei werden unter anderem
besondere Gefahrenstellen und besondere
Verkehre, wie z.B. der Schülerverkehr,
berücksichtigt und so geplant, dass
zusätzliche Winterdienst-Fahrten möglichst
vermieden werden.
Bei den
Streueinsätzen kommt ein leistungsstarkes
Feuchtsalz zum Einsatz, einem Gemisch aus 70
Prozent Streusalz und 30 Prozent
Calciumchloridlösung. Hierbei behält der
Kreis Wesel auch die Umwelt im Blick. Getreu
der Devise „so wenig wie möglich aber so
viel wie nötig“ wird die Streumenge den
vorliegenden örtlichen Gegebenheiten jeweils
individuell angepasst. Dadurch werden die
Auswirkungen für die Umwelt auf ein Minimum
reduziert.
Der Kreis Wesel arbeitet
interkommunal mit einer Vielzahl an
Kommunen, Kreisen und Straßen NRW im
Winterdienst zusammen. Im Regelfall ist
hierbei ein Streckentausch zum gegenseitigen
Vorteil vereinbart. Bei aller guten
Vorbereitung ist aber auch klar, dass der
Kreisbauhof nicht alle Wetterlagen
beherrschen kann.

Sparquote in Deutschland mit
10,3 % im 1. Halbjahr 2025 leicht unter
Vorjahresniveau -
Hierzulande wird anteilig deutlich mehr
gespart als im EU-Durchschnitt
Die privaten Haushalte in Deutschland haben
saisonbereinigt im 1. Halbjahr dieses Jahres
10,3 % ihres Einkommens gespart. Damit war
die Sparquote geringer als im ersten
Halbjahr 2024 mit 11,1 %, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) zum
Weltspartag am 30. Oktober mitteilt.
Langfristig betrachtet entspricht die
Sparquote mit aktuell 10,3 % in etwa dem
durchschnittlichen Niveau der Jahre seit
2000.
Die Jahre 2020 und 2021 wurden
hierbei ausgeklammert, da in diesen beiden
durch die Corona-Pandemie geprägten Jahren
die Sparquote mit durchschnittlich 15,1 %
wesentlich höher lag. Im Jahr 2024 betrug
sie 11,2 %.
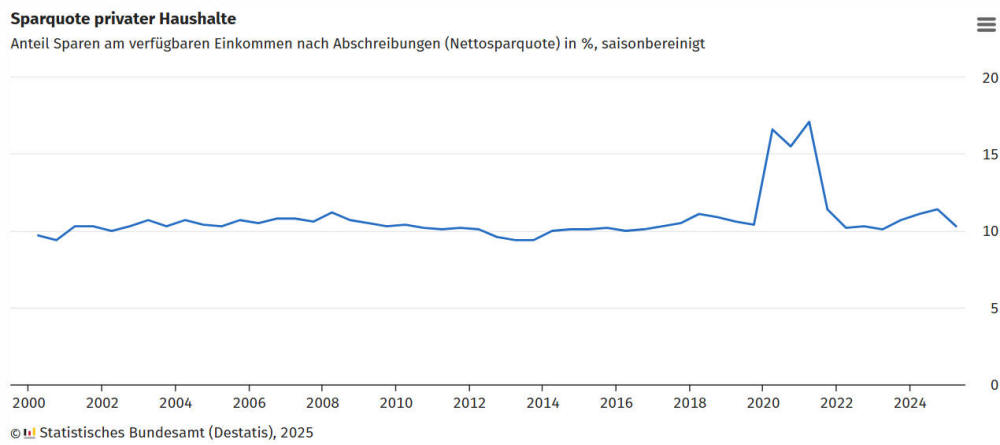
Eine Sparquote von 10,3 % bedeutet, dass
die privaten Haushalte je 100 Euro
verfügbarem Einkommen im Durchschnitt 10,30
Euro sparten. Monatlich entspricht dies
einem Betrag von durchschnittlich knapp 270
Euro je Einwohnerin und Einwohner. Dieser
Durchschnittswert lässt aber keine
Rückschlüsse auf einzelne Haushalte zu.
Abhängig von Einkommenshöhe, Lebenslage
und Sparneigung gibt es sehr deutliche
Unterschiede. Während einige Haushalte viel
Geld auf die Seite legen können, bleibt bei
anderen am Ende des Monats wenig oder nichts
übrig. Aus den hier zugrundeliegenden Daten
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
kann nur das gesamtwirtschaftliche Sparen
aller privaten Haushalte ermittelt und ein
rechnerischer Durchschnittswert bestimmt
werden.
Insgesamt belief sich das
Sparvolumen im 1. Halbjahr 2025 nach Abzug
von Abschreibungen auf 134,6 Milliarden
Euro. Deutschlands Bruttosparquote im
internationalen Vergleich
überdurchschnittlich hoch Für internationale
Vergleiche wird üblicherweise die Sparquote
vor Abzug von Abschreibungen beispielsweise
auf Wohneigentum privater Haushalte
herangezogen, die sogenannte
Bruttosparquote. Diese lag für Deutschland
im Jahr 2024 bei 20,0 % – ein im
internationalen Vergleich hoher Wert.
So betrug die durchschnittliche
Bruttosparquote der privaten Haushalte in
der Europäischen Union lediglich 14,6 %.
Nach Angaben der europäischen
Statistikbehörde Eurostat sparten die
privaten Haushalte in Frankreich brutto
17,9 % ihres verfügbaren Einkommens, in
Österreich 17,3 %, in den Niederlanden
16,8 % und in Italien 11,9 %. Einen deutlich
höheren Wert als Deutschland wies die
Schweiz mit 26,1 % aus. In den USA lag die
Bruttosparquote laut OECD bei 10,8 % und
damit wie schon seit vielen Jahren deutlich
unter dem Niveau der meisten europäischen
Länder.
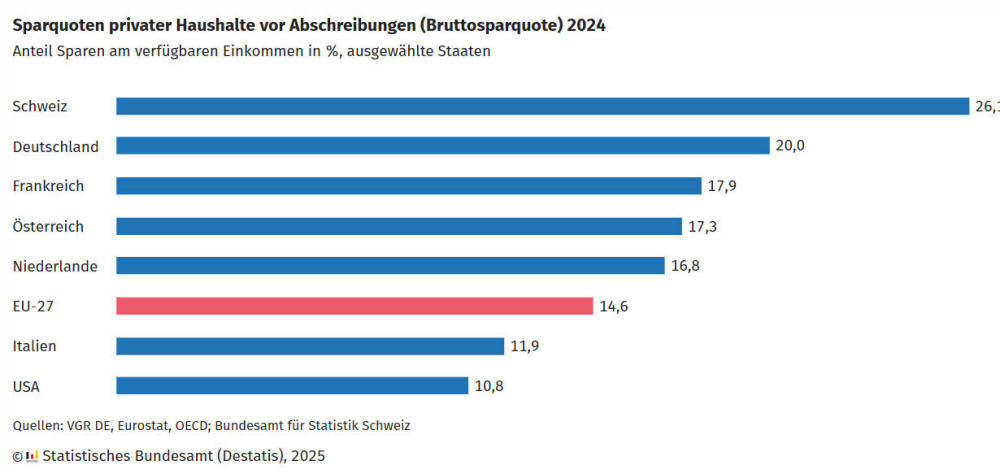
NRW: Zahl der ausländischen
Schülerinnen und Schüler hat sich in den
letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt
* Rund 441.000 Schülerinnen und
Schüler an allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen hatten im Schuljahr
2024/25 nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit.
* Von den
ausländischen Schülerinnen und Schülern
hatte fast ein Drittel im Schuljahr 2024/25
die syrische oder ukrainische
Staatsangehörigkeit.
* Rund 71 % weniger
Schülerinnen und Schüler mit türkischer
Staatsangehörigkeit als vor zehn Jahren.
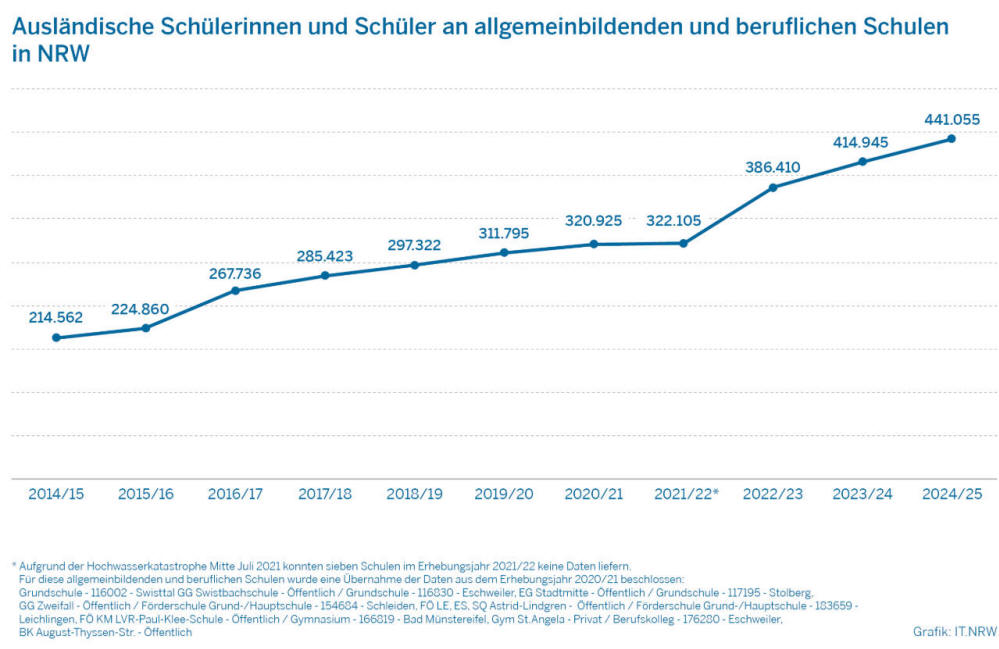
Die Zahl der ausländischen Schülerinnen
und Schüler an den allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen in NRW hat sich in den
letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Wie
das Statistische Landesamt mitteilt, stieg
die Zahl von rund 214.600 im Schuljahr
2014/15 auf rund 441.100 im Schuljahr
2024/25. Die Zahl der Schülerinnen und
Schüler insgesamt stagnierte im gleichen
Zeitraum nahezu bei rund 2,5 Millionen.
Während anteilig vor 10 Jahren 8,4 %
aller Schülerinnen und Schüler keine
deutsche Staatsangehörigkeit hatten, waren
es zuletzt 17,5 % der Schülerschaft. Fast
ein Drittel der ausländischen Schülerinnen
und Schüler hatte die syrische oder
ukrainische Staatsangehörigkeit.
Die
Verteilung der Staatsangehörigkeiten hat
sich in diesem Zeitraum ebenfalls deutlich
verändert. Der starke Anstieg der
ausländischen Schülerzahl geht besonders auf
die zunehmende Zahl syrischer und
ukrainischer Schülerinnen und Schüler
infolge der Fluchtbewegungen aus diesen
Ländern zurück.
Nachdem im Schuljahr
2014/15 nur wenige tausend Kinder und
Jugendliche mit diesen Staatsangehörigkeiten
eine Schule in NRW besucht hatten, stellten
sie im Schuljahr 2024/25 die beiden größten
Gruppen in der ausländischen Schülerschaft.
So gab es fast 88.000 syrische und rund
56.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler
an den allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen in NRW; das war damit fast ein
Drittel aller ausländischen Schülerinnen und
Schüler.
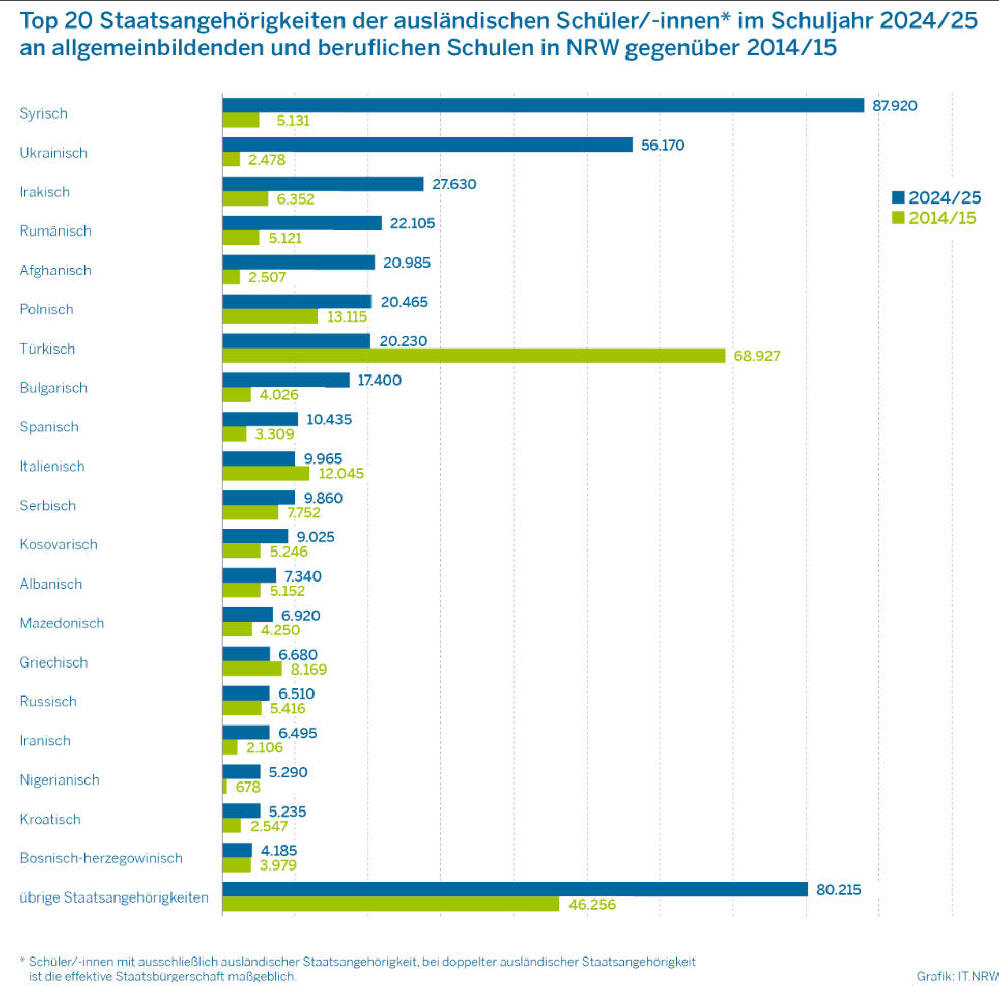
Zudem stieg auch die Zahl der
Schülerinnen und Schüler mit irakischer und
afghanischer Staatsangehörigkeit in den
letzten zehn Jahren deutlich an; auch aus
diesen Ländern hatte es in den letzten
Jahren Fluchtbewegungen gegeben. Wesentlich
mehr Schülerinnen und Schüler mit
rumänischer und bulgarischer
Staatsangehörigkeit Zudem besuchten
wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler mit
rumänischer, polnischer und bulgarischer
Staatsangehörigkeit nordrhein-westfälische
Schulen als noch vor 10 Jahren.
So
hat sich z. B. die Zahl der Schülerinnen und
Schüler mit rumänischer und bulgarischer
Staatsangehörigkeit in den vergangenen zehn
Jahren mehr als vervierfacht; zusammen
stellten sie zuletzt etwa 39.500
Schülerinnen und Schüler. Im Zuge der
Osterweiterung waren Rumänien und Bulgarien
als vorletzte Staaten in die EU aufgenommen
worden.
Rückgang früher häufig
vertretener Staatsangehörigkeiten
Andere
Staatsangehörigkeiten waren dagegen im
Schuljahr 2024/25 seltener vertreten als vor
10 Jahren. Im Schuljahr 2024/25 besuchten
70,6 % weniger türkische Schülerinnen und
Schüler die Schulen in NRW als im Schuljahr
2014/15; damals hatten sie noch die größte
Gruppe gebildet. Die italienische
Staatsangehörigkeit besaßen 17,3 % weniger
Schülerinnen und Schüler als vor zehn
Jahren.
Kostenlose Online-Gartenwoche 2025 - Impulse
für naturnahe Hausgärten
Der
gemeinnützige Verband Wohneigentum lädt vom
3. bis 7. November 2025 ein zur kostenfreien
Online-Gartenwoche. Ein Webinar-Event für
Verbraucher und Verbraucherinnen, die ihren
Garten naturnah bewirtschaften und gestalten
möchten – ganz gleich ob Neuling oder Profi.

Tipps, Ideen und Fachwissen, um Inspiration
für das nächste Gartenjahr zu sammeln: Jeden
Abend ab 18 Uhr startet ein neues
Live-Seminar, das praxisnahe und fundierte
Tipps rund um Gartenarbeit, Nachhaltigkeit
und Garten-Ökologie vermittelt. Nach den
Vorträgen können Fragen gestellt werden.
Unsere Themen:
- Montag, 3. November:
„Saatgut selbst herstellen“ – vom Ernten bis
zur Lagerung des Saatguts
- Dienstag, 4.
November: „Naturnaher Pflanzenschutz im
Hausgarten“ – wie man Pflanzen gesund hält
und gleichzeitig die Artenvielfalt schützt.
- Mittwoch, 5. November: „Sträucher
schneiden für Wachstum und Blütenpracht“ –
Schnittmethoden für Obst- und Ziersträucher
im Fokus.
- Donnerstag, 6. November:
„Heilpflanzen & Kräuterwissen für den
Hausgarten“ – altbewährte Kräuter, Gewürze
und deren Nutzen in Garten und Küche.
-
Freitag, 7. November: „Garten als Lebensraum
für Wildtiere gestalten“ – wie Garten &
Natur in Einklang gebracht werden können.
Anmeldung & Informationen
Weitere
Details und die Anmeldung finden sich auf
der Website des Verbands. Die Webinare sind
offen für alle und kostenlos.
Mehr
Online-Seminare? Onlinewoche rund ums Haus
Im Anschluss an die Online-Gartenwoche
startet gleich die nächste Infowoche von dem
größten Verband selbstnutzender
Wohneigentümer*innen, diesmal dreht sich
alles rund ums Haus: Kostenlose Infowoche
für Wohneigentümer.
Chip-Knappheit trifft Wirtschaft am
Niederrhein IHK: „Wir brauchen resiliente
Lieferketten“
Die Chipkrise
macht der Wirtschaft am Niederrhein Sorgen.
Das zeigt eine laufende Umfrage der
Niederrheinischen IHK. Die Betriebe sehen
ein erhöhtes Risiko für verzögerte
Lieferungen und Preissteigerungen.
Produktionsausfälle sehen sie derzeit nicht.
Wenn die Lieferengpässe beim
niederländischen Chip-Hersteller Nexperia
weiter anhalten, erwarten 60 Prozent
Verzögerungen bei ihren Lieferzeiten.
Eine Ursache ist, dass es weniger
Lagerbestände in den Unternehmen gibt:
„Plötzliche Lieferprobleme bei einem
Hersteller wie Nexperia wirken sich rasant
aus. Das spüren nicht nur Automobil- und
Maschinenbaukonzerne, sondern auch viele
mittelständische Betriebe hier vor Ort.
Die Chipkrise um Nexperia ist mehr als ein
Lieferproblem – sie ist ein Weckruf für
Deutschland. Wir brauchen resiliente
Lieferketten und müssen die Abhängigkeit von
wenigen Herstellern reduzieren. Die
Produktion von Schlüsseltechnologien wie
Halbleiter-Chips muss in Deutschland und
Europa beschleunigt und auch gefördert
werden, damit kritische Bauteile nicht mehr
von extern bezogen werden müssen“, betont
Jürgen Kaiser, Geschäftsführer der
Niederrheinischen IHK.

Foto: Niederrheinische
IHK/Jacqueline Wardeski
Chip-Knappheit: IHK fragt nach
Stimmungsbild
Die Umfrage der
Niederrheinischen IHK läuft noch bis zum 31.
Oktober. Mitmachen können Unternehmen aus
Duisburg, dem Kreis Kleve oder Kreis Wesel.
Die IHK will damit einen besseren Überblick
erhalten, wie die Region betroffen ist.
Neu_Meerbeck:
Kreispolizei informiert kostenlos zur
Kriminalprävention
Wie man sich
am besten vor Trickdiebstahl, dem
Enkeltrick, Schockanrufen oder ‚falschen
Polizeibeamten‘ schützt, darüber informiert
im Rahmen des Stadtteiltreffs Neu_Meerbeck
am Mittwoch, 12. November, ab 16.30 Uhr,
Richard Devers, Kriminalhauptkommissar der
Kriminalprävention Wesel.
Der
Vortrag findet im Gemeindehaus der ev.
Kirche Rheinkamp an der Bismarckstraße 35b
in Meerbeck statt. Es besteht auch
Gelegenheit, Fragen zu stellen sowie sich
auszutauschen. Die Veranstaltung ist
kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung wird
gebeten telefonisch unter 0 28 41/ 201 – 530
oder per E-Mail unter stadtteilbuero.meerbeck@moers.de
Seminar vhs Moers –
Kamp-Lintfort: ‚Was ist Kunst? Und wozu ist
sie gut?‘
Was macht Kunst
eigentlich aus und was darf sie? Ein Kurs
der vhs Moers – Kamp-Lintfort, der am
Dienstag, 4. November, startet, geht diesen
Fragen aus philosophischer Sicht nach.
Insgesamt sechsmal, jeweils dienstags ab 19
Uhr, versuchen die Teilnehmenden den
Kurstitel ‚Was ist Kunst? Und wozu ist sie
gut?‘ zu beantworten.
Veranstaltungsort ist die vhs Moers,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10. Vorkenntnisse
für das Seminar sind nicht erforderlich.
Allerdings sollte die Bereitschaft vorhanden
sein, sich auf unterschiedliche Positionen
einzulassen und diese zu diskutieren. Alle,
die mitdiskutieren möchten, können sich
rechtzeitig telefonisch unter 0 28 41 / 201
– 565 oder online unter www.vhs-moers.de anmelden.
Moers:
Wasserwirtschafts-Silvester mit vhs und
LINEG am 4. November
Wieviel
Niederschlag gefallen ist und wie voll der
Grundspeicher ist – das fasst die LINEG in
ihrer jährlichen Bilanz Ende Oktober
zusammen. Am Dienstag, 4. November, um 17
Uhr heißt es deshalb ‚Sekt oder Selters! –
Wasserwirtschafts-Silvester feiern mit der
LINEG‘.
Bei der
Kooperationsveranstaltung mit der vhs Moers
– Kamp-Lintfort wird der Grundwasserstand
gemessen und anschließend auf das neue
Wasserwirtschaftsjahr angestoßen.
Treffpunkt ist an der LINEG-Verwaltung in
Kamp-Lintfort, Friedrich-Heinrich-Allee 64.
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine
rechtzeitige Anmeldung entweder telefonisch
unter 0 28 41 / 201- 565 oder online unter www.vhs-moers.de ist
erforderlich.
Geflügelpest
in Rees bestätigt, Überwachungszone im Kreis
Wesel
Der Kreis Wese
bittet alle Geflügelhalterinnen und
Geflügelhalter im Kreis, die eigenen
Biosicherheitsmaßnahmen zu hinterfragen und
zu verbessern, sowie ungewöhnliche
Krankheitserscheinungen und erhöhte
Todeszahlen beim Fachdienst Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung zu melden:
„Geflügelpest in Rees bestätigt,
Überwachungszone im Kreis Wesel.
Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat den
Verdacht des Ausbruchs der Geflügelpest in
einem Putenbetrieb in Rees im Kreis Kleve
bestätigt. Festgestellt wurde der Virustyp
H5N1. Für den Virustpen sind alle Vögel
empfänglich. Nach derzeitigem Kenntnisstand
geht von dem Virustyp keine Gefahr für
Menschen und andere Säugetiere aus. Das FLI
beobachtet die Entwicklung intensiv.
Um den betroffenen Betrieb werden eine
Schutz- und Überwachungszone eingerichtet.
Die Überwachungszone mit einem Radius von
zehn Kilometern reicht bis in den Kreis
Wesel und betrifft Teile von Hamminkeln und
Xanten. In der Überwachungszone gilt ab dem
24. Oktober 2025 eine Aufstallungspflicht
für gehaltenes Geflügel. Als Aufstallung
gilt eine Haltung in geschlossenen Ställen
oder unter einer Vorrichtung, die aus einer
überstehenden, nach oben gegen Einträge
gesicherten dichten Abdeckung und mit einer
gegen das Eindringen von Wildvögeln
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.
Wildvögel dürfen keinen Zugang zu
Futter-,Tränke- und Badestellen haben. Zudem
dürfen gehaltene Vögel weder in einen
tierhaltenden Betrieb hinein- noch
hinausgebracht werden. In der Zone ist die
Durchführung von Geflügelausstellungen,
Geflügelmärkten oder Veranstaltungen
ähnlicher Art verboten. Es gibt weitere
Beschränkungen für das Verbringen von Eiern
und Fleisch.
Die Überwachungszone
wird mit einer Allgemeinverfügung vom
heutigen Tag angeordnet und tritt am
25.10.2025 um 0 Uhr in Kraft. Sie ist im
Amtsblatt des Kreises veröffentlicht und
unter folgendem Link einzusehen: https://www.kreis-wesel.de/system/files/2025-10/241025%20Amtsblatt%20Nummer%2047.pdf
Die festgelegten Zonen können im Internet
unter dem folgendem Link als interaktive
Karte eingesehen werden:
https://visualgeoserver.fli.de/visualize-this-map/118722926FD7342AE3E3A39AB34AD73EAE17DA1E322D54C9259C16CB32804546
Tierhalterinnen und Tierhalter
können über den Link prüfen, ob die eigene
Tierhaltung im betroffenen Gebiet liegt In
der Überwachungszone im Kreis Wesel befinden
sich neben einem größeren Putenmastbestand
mit ca. 8.500 Tieren überwiegend Klein- und
Hobbyhaltungen. Einen Teil der Betriebe wird
der amtstierärztliche Dienst in den
kommenden Wochen nach festgelegten
Risikokriterien klinisch und in bestimmten
Fällen über Tupfer- oder Blutproben näher
untersuchen.
Hintergrund und
Handlungsempfehlung Das
Geflügelpestgeschehen ändert sich derzeit
sehr dynamisch. Besonders auffällig sind
aktuell die hohen influenzabedingten
Todesfälle bei den durchziehenden Kranichen.
Geflügelhalter und -halterinnen, die ihre
Tierzahlen bislang nicht bei der
Tierseuchenkasse NRW angemeldet haben,
sollten dies unverzüglich nachholen.
Die größte Gefahr geht von einem
Viruseintrag aus der Wildvogelpopulation
aus. Daher ist eine Aufstallung
unverzichtbar. Aufgrund der Erfahrungen aus
den Vorjahren muss im Laufe der kommenden
Wochen und Monate mit einer
Aufstallungspflicht für das gesamte
Kreisgebiet gerechnet werden.
Der
Kreis Wesel bittet alle Geflügelhalterinnen
und Geflügelhalter im Kreis, die eigenen
Biosicherheitsmaßnahmen zu hinterfragen und
zu verbessern, sowie ungewöhnliche
Krankheitserscheinungen und erhöhte
Todeszahlen beim Fachdienst Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung zu melden. Totfunde
von Wildvögeln, insbesondere Wassergeflügel
und Greifvögeln sollten dem Veterinäramt
gemeldet werden. Für Fragen und Meldungen
steht der Fachdienst Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung unter
VET.LM@kreis-wesel.de und 0281 207 7021 bzw.
7022 zur Verfügung.“
Neues
Amtsblatt
Am 27. Oktober 2025
ist ein neues Amtsblatt der Stadt Dinslaken
erschienen. Es enthält zwei öffentliche
Zustellungen. Die
städtischen Amtsblätter können auch auf der
städtischen Homepage eingesehen werden.
Dachsanierung am Rathaus Wesel
Da Wasser ins Rathaus tropft,
wird die undichte Stelle des Daches
repariert. Die Dachsanierung dauert
voraussichtlich bis Weihnachten. Dazu wurde
ein Gerüst im Rathausinnenhof aufgestellt.
Während der Arbeiten können die Fahrradbügel
neben dem Eingang des Rathauses nicht
genutzt werden. In unmittelbarer Nähe (im
Durchgang zum Centrum) befinden sich jedoch
auseichend Abstellmöglichkeiten.
Krimizeit mit Erwin Kohl in der
Stadtbücherei Kleve!
Am
Donnerstag, 30. Oktober 2025 ist ab 19:30
Uhr (Einlass: 19:00 Uhr) Krimizeit in der
Stadtbücherei Kleve! Erwin Kohl liest aus
seinem neuesten Krimi. Es wird wieder
spannend am Niederrhein. Diesmal geht es für
Detektiv und Dauercamper Lukas Born um „Jede
Menge Kies“: "Eigentlich sollte
Privatermittler Lukas Born herausfinden, wer
dem Bauern Gerd Heitkamp ans Leder will.

Doch kaum hat er den Auftrag angenommen,
liegt sein Klient auch schon mausetot auf
der Wiese - genau dort, wo Heitkamp am
Vorabend gegen die Auskiesung von Ackerland
demonstriert hat. Warum wollte er mitten in
der Nacht nach Hause laufen? Wem ist er
unterwegs begegnet? Und vor allem: Welches
Geheimnis hat er mit in den Tod genommen?"
(Verlagstext).
Erwin Kohl lebt in
Alpen, dem Ort, in dem er 1961 geboren
wurde. Den Niederrhein hat er seitdem nie
wirklich verlassen. Hier holt er sich die
Inspirationen für seine Geschichten.
Eintrittskarten gibt es aktuell bereits im
Vorverkauf für 5€ in der Stadtbücherei
Kleve, Wasserstraße 30, 47533 Kleve.
Wesel:
Stadt Land zu Fuß: Bewegen, Begegnen,
Entdecken
Der Countdown läuft:
Am 1. November geht es los! Die vierte
Ausgabe von "Stadt Land zu Fuß" findet vom
1. bis 21. November 2025 statt. „Wir
möchten möglichst viele Bürgerinnen und
Bürger motivieren, sich an der Aktion zu
beteiligen. Mitmachen können alle, die zu
Fuß unterwegs sind – Wanderer und Läufer,
Walker und Spaziergänger, auf dem Weg zur
Schule oder Arbeit, Brötchen holen, in der
‚Bewegten Pause‘ oder mit dem Hund“, erklärt
Landrat Ingo Brohl. „Es besteht die
Möglichkeit, Teams zu bilden und so
gemeinsam das Kilometerkonto zu füllen und
sich mit anderen Teams zu messen.“
Der Kreis Wesel beteiligt sich von Beginn an
und setzt sich das Ziel, erneut eine
Spitzenposition einzunehmen. Unter www.kreis-wesel.de/stadt-land-zu-fuss finden
Interessierte umfassende Informationen zur
Aktion sowie eine Anleitung
zur Teilnehmerregistrierung. Die Anmeldung
wurde für Gruppen vereinfacht, bei denen die
Mitlaufenden oft keine eigene E-Mail-Adresse
haben, wie z. B. Grundschulen oder
Wandergruppen.
Hier reicht es aus, wenn eine
verantwortliche Person die Kilometer
einträgt und die Teilnehmerzahl angibt. Der
Wertungsmodus bleibt davon unberührt, da er
sich auf die gelaufenen Kilometer pro
Einwohner (nicht pro Teilnehmenden)
bezieht. Weitere Infos gibt es bei der
Fachstelle Europa & nachhaltige
Kreisentwicklung unter 0281/207-3016 oder
per E-Mail an enke@kreis-wesel.de.
Direktorenführung „More Than
Ever! The Collection“ im Museum Kurhaus
Kleve
Am Mittwoch, den 29.
Oktober 2025 um 19.30 Uhr führt Direktor
Harald Kunde durch die neue
Sammlungspräsentation „More Than Ever! The
Collection“. Die Neupräsentation der
Sammlung integriert hochrangige Erwerbungen,
Schenkungen und Leihgaben der vergangenen
Jahre in die vorhandenen exemplarischen
Bestände und initiiert ein vielstimmiges
Gespräch über Zeiten, Räume und
künstlerische Individualitäten.

Dabei werden die für das Haus
identitätsstiftenden Konvolute der
spätgotischen Skulptur, der barocken
Landschaften und Porträts, die Werkblöcke
von Ewald Mataré und Joseph Beuys ebenso
präsent sein wie signifikante Beispiele der
Klassischen Avantgarden und der Kunst der
Gegenwart. Veranstalter ist der
Freundeskreis Museum Kurhaus und
Koekkoek-Haus Kleve e.V.
Die
Teilnahme an der Führung ist frei.
Willkommen sind nicht nur die Mitglieder des
Vereins, sondern alle, die sich für das
Museum und seine Kunst interessieren. Im
Anschluss an die Führung wird es bei einem
geselligen Beisammensein im Café Moritz auf
der Dachterrasse des Museum Kurhaus Kleve
Gelegenheit zum persönlichen Austausch und
zu Gesprächen geben.
Moers:
2. Bastelwerkstatt „Geister, Gespenster und
Co“ für Kinder ab 4 Jahren
Gespenster, Hexen, Fledermäuse und andere
„gruselige“ Kleinigkeiten können an diesem
Nachmittag gebastelt werden. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich, für das Material
wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro erhoben.
Nähere Infos und Anmeldung unter
Tel.: 0 28 41 / 201-751, unter jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek Moers.
Veranstaltungsdatum 28.10.2025 - 15:00
Uhr - 16:00 Uhr. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.

NRW: Bauproduktion im August um
3,1 Prozent gesunken
*
NRW-Bauproduktion im Hochbau und Tiefbau
gesunken.
* Hochbau: Nur Wohnungsbau mit
geringem Plus.
* Tiefbau: Rückgang der
Bauproduktion in allen Bausparten.
*
Anstieg der Bauproduktion gegenüber dem
Monatsergebnis des Jahres 2019.
Die
Produktion im nordrhein-westfälischen
Bauhauptgewerbe war im August 2025 um
3,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.
Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war
die Produktion im Hochbau um 4,3 Prozent und
im Tiefbau um 1,9 Prozent niedriger als im
August 2024. Hochbau: Wohnungsbau mit
geringem Plus Im Bereich des Hochbaus
ermittelten die Statistiker im August 2025
unterschiedliche Entwicklungen in den
einzelnen Bausparten: Im Wohnungsbau war ein
Anstieg der Bauproduktion gegenüber dem
vergleichbaren Vorjahresmonat zu
konstatieren (+0,3 %).
Im
öffentlichen Hochbau (−1,8 %) sowie im
gewerblichen und industriellen Hochbau
(−9,4 %) fiel die Bauproduktion niedriger
als im August 2024 aus. Tiefbau: Stärkster
Rückgang beim Straßenbau Innerhalb des
Tiefbaus konnten im August 2025 durchweg
negative Entwicklungen der Bauproduktion in
den einzelnen Bausparten beobachtet werden:
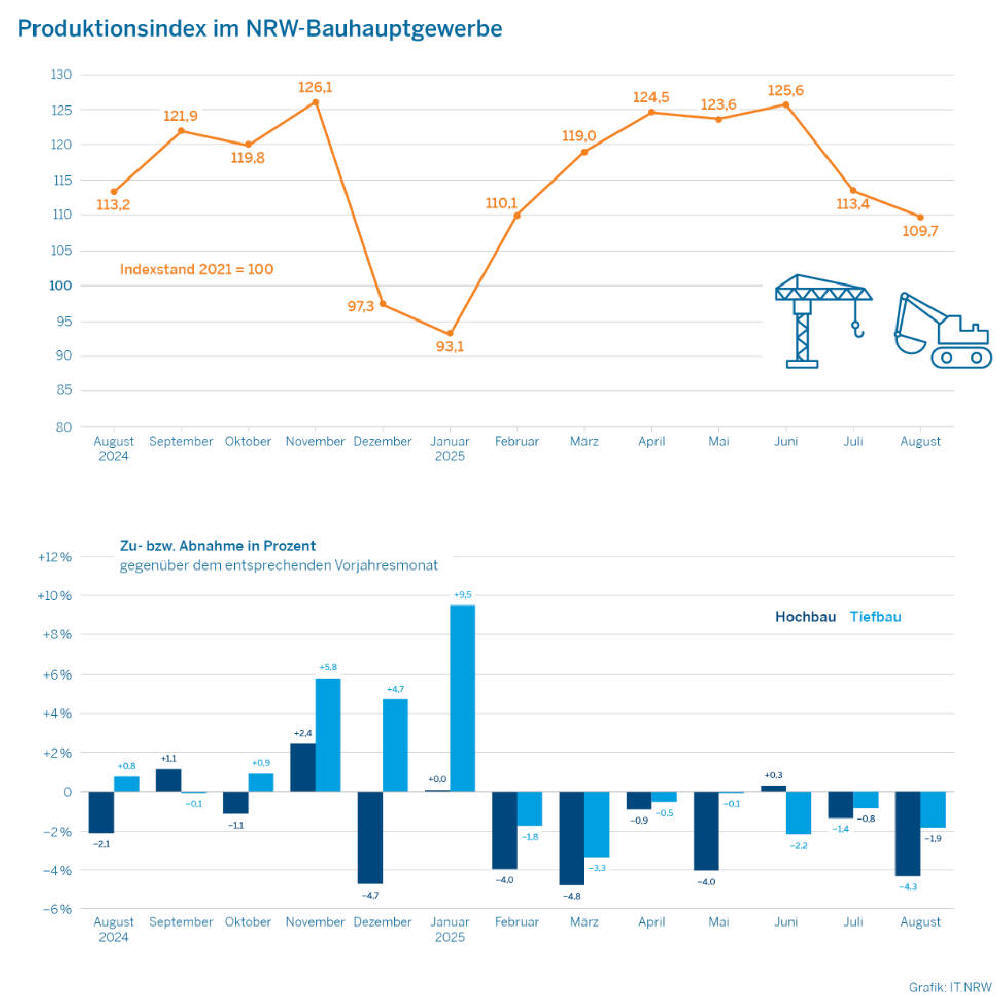
Den stärksten Rückgang gegenüber dem
vergleichbaren Vorjahresmonat erzielte der
Straßenbau (−3,4 %), gefolgt vom sonstigen
öffentlichen Tiefbau (−2,1 %) und vom
gewerblichen und industriellen Tiefbau
(−0,8 %). Anstieg der Bauproduktion
gegenüber dem Monatsergebnis des Jahres 2019
Im August 2025 ermittelten die Statistiker
im Vergleich zum entsprechenden
Monatsergebnis des Jahres 2019 einen Anstieg
der Bauproduktion im Bauhauptgewerbe
(+21,6 %).
Sowohl im Hochbau
(+15,1 %) als auch im Tiefbau (+28,9 %) lag
die Bauproduktion über dem Niveau von August
2019. Zu diesem Produktionsergebnis haben
die einzelnen Bausparten ausnahmslos positiv
beigetragen. In den Bausparten waren
Zuwachsraten zwischen 9,8 % (gewerblicher
und industrieller Hochbau) und 43,2 %
(gewerblicher und industrieller Tiefbau) zu
beobachten. Das kumulierte Ergebnis der
Bauproduktion für die ersten acht Monate des
Jahres 2025 war um 1,5 % niedriger als in
der entsprechenden Vergleichsperiode 2024.
13 % der Rentnerinnen und
Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren sind
erwerbstätig
Die sogenannte
„Aktivrente” soll das Arbeiten für
Rentnerinnen und Rentner ab dem nächsten
Jahr durch Steuervorteile attraktiver machen
und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
Bereits jetzt arbeiten in Deutschland viele
Menschen, während sie eine gesetzliche
Altersrente beziehen.
Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
Erstergebnissen des Mikrozensus 2024
mitteilt, waren 13 % der Rentnerinnen und
Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren
hierzulande erwerbstätig. Männer mit einer
Altersrente (16 %) gingen dabei häufiger
einer Arbeit nach als Frauen (10 %).
Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen
und Rentner sinkt mit Alter und steigt mit
Bildungsniveau
Der Anteil der
erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner
nimmt mit zunehmendem Alter kontinuierlich
ab. So arbeitete von den 65- bis 66-jährigen
Rentenbeziehenden knapp ein Fünftel (18 %),
von den 73- bis 74-jährigen Rentnerinnen und
Rentnern gingen noch 8 % einer Arbeit nach.
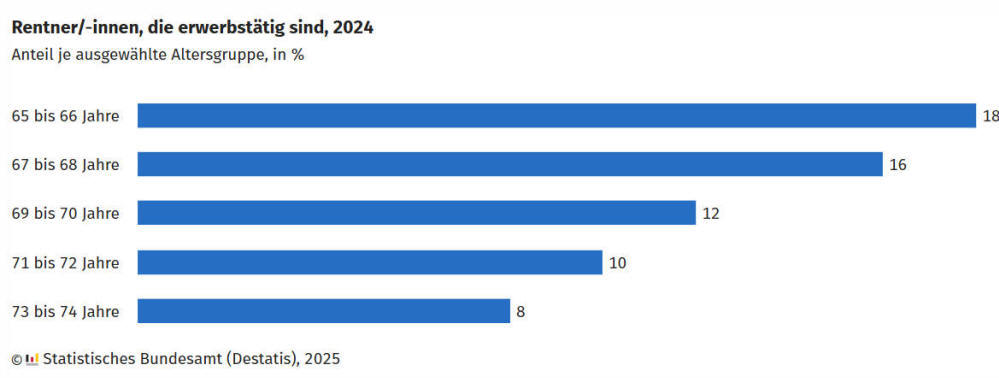
Auch zwischen dem Bildungsniveau und der
Erwerbstätigkeit im höheren Alter gibt es
einen Zusammenhang: Während 18 % der
Rentenbeziehenden mit höherem Bildungsniveau
erwerbstätig waren, lag der Anteil unter
Rentnerinnen und Rentnern mit niedrigerem
oder mittlerem Bildungsniveau bei 10 %
beziehungsweise 11 %.
Die Hälfte der
erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner ist
geringfügig beschäftigt
Die Hälfte
(50 %) der Rentnerinnen und Rentner, die
parallel zum Rentenbezug einer
Erwerbstätigkeit nachgingen, gab an,
geringfügig beschäftigt zu sein. Insgesamt
arbeiteten 71 % der erwerbstätigen
Rentnerinnen und Rentner als abhängig
Beschäftigte, 29 % waren selbstständig
tätig.
Für letztere ist die
„Aktivrente“ nicht vorgesehen. 14 % der
erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mit
mehr als 40 Wochenarbeitsstunden In der
Regel arbeiten Rentnerinnen und Rentner mit
reduziertem Stundenumfang: 39 % gingen
normalerweise weniger als 10 Stunden in der
Woche einer Erwerbstätigkeit nach. Gut ein
Viertel (26 %) arbeitete 10 bis unter
20 Wochenarbeitsstunden.
12 % der
Rentenbeziehenden mit einer Arbeit übten
diese 20 bis unter 30 Stunden in der Woche
aus. Bei 9 % waren es 30 bis unter
40 Stunden. 14 % der erwerbstätigen
Rentnerinnen und Rentner hatten eine
Arbeitswoche mit mehr als 40 Stunden.
Selbstständige Rentnerinnen und Rentner
(28 %) arbeiteten dabei häufiger mehr als
40 Stunden in der Woche als abhängig
beschäftigte Rentenbeziehende (8 %).
Digital älter werden in
Moers: Nutzen Sie schon die App "Gut
versorgt in Moers"? 50+
In
Kooperation mit der Leitstelle Älter werden
Ziele und Wege Im Alter digital! Die
vergangenen Jahre haben uns gezeigt, wie
wichtig und notwendig auch bedienbare
digitale Angebote für ältere Menschen sind.
Darum stellt die Leitstelle Älterwerden der
Stadt Moers die kostenlose App vor und
unterstützt Sie bei der Installation und der
Bedienung.
Entdecken Sie mit uns in
der App die vielseitigen Themen und
nützlichen Informationen rund ums
Älterwerden in Moers. Lassen Sie uns
zusammen Hürden abbauen, damit Sie in
Zukunft keine Information mehr verpassen.
Das Angebot richtet sich an Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Moers ab 55 Jahren.
Bitte bringen Sie Ihr Tablet oder Smartphone
mit. Referentin: Pia Kegel Eine Anmeldung
ist erforderlich unter www.vhs-moers.de
Kurs-Nr.: G10253 Gebühr: unentgeltlich Event
details Veranstaltungsdatum 29.10.2025 -
10:00 Uhr - 12:00 Uhr.
Moers:
Wander- und Fahrradtouren planen mit Komoot
Ob Wandern oder
Radfahren: Entdecken Sie mit uns die Welt
digitaler Routenplanung auf Ihrem
Smartphone! Der Kursleiter zeigt Ihnen
praxisnah die Outdoor-App Komoot, die
Planung vorab und die Navigation unterwegs.
Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich
der digitalen Reiseplanung!
Bitte
bringen Sie Ihr eigenes Smartphone (Apple
iPhone oder Android-Smartphone)
betriebsbereit (aktiviert, vollständig
aufgeladen, inkl. Passwörter/Pins) mit.
Referent: Heinz Gellings Kurs-Nr.: G10916
Gebühr: 12 Euro Event details
Veranstaltungsdatum 29.10.2025 - 15:00
Uhr - 16:30 Uhr. Veranstaltungsort
Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum. Adresse
Wilhelm-Schroeder-Straße 10. 47441 Moers.
Moers: Gesetzliche Erbfolge,
Pflichtteil und Testamente
Niemand denkt gern an den Tod. Aber das
Schicksal ist, egal ob bei Alten oder
Jungen, unberechenbar. Im Mittelpunkt der
Veranstaltung stehen die Regelungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches zum Verwandten-
und Ehegattenerbrecht und zum
Pflichtteilsrecht.
Anhand von
Beispielen und Übersichten werden die
wesentlichen erbrechtlichen Grundlagen
leicht verständlich dargestellt. Auch werden
die Grundlagen und Möglichkeiten einer
selbstbestimmten Erbregelung durch
Testament, Erbvertrag oder Verfügung zu
Lebzeiten mit Beispielen thematisiert.
Referent: Adalbert Soika Kurs-Nr.:
G10328 Gebühr: 7 Euro Event details
Veranstaltungsdatum 29.10.2025 - 18:30
Uhr - 20:00 Uhr. Veranstaltungsort
Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, Adresse
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Moers: Burak Yılmaz:
Ehrensache – Kämpfen gegen Judenhass
Er durchkreuzt mit seiner
Arbeit unterschiedliche Milieus:
Gefängnisse, Theaterhäuser, Parlamente.
Yilmaz wurde für seine Arbeit mit dem
Julius-Hirsch Preis des DFB ausgezeichnet
und bekam 2021 für sein Engagement gegen
Rassismus und Antisemitismus das
Bundesverdienstkreuz verliehen.

(Foto: Marvin Ruppert)
Zusammen mit
Malte Küppers und Kader Abdul Chahin widmet
er sich in dem Podcast „Brennpunkt“
wöchentlich den heißen Themen unserer Zeit.
Ab der Spielzeit 24/25 hostet er alle 2
Monate die „Late Night Real Talks“ im
Werkraum der Münchner Kammerspiele. Der
Eintritt ist frei!
Gefördert durch
das Ministerium für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen und
Soziokultur NRW. Veranstaltungsdatum
29.10.2025 - 19:00 Uhr - 21:00 Uhr.
Veranstaltungsort Zum Bollwerk 107, 47441
Moers. Veranstalter Jugend-Kultur-Zentrum
'Bollwerk 107', 47441 Moers
Unternehmer aus Südamerika erkunden
Wirtschaft am Niederrhein - Fokus auf duale
Ausbildung und Wasserstoff
Gute internationale Beziehungen
sind in der aktuellen Weltlage wichtig. Auf
Einladung der Niederrheinischen IHK erkunden
30 Unternehmer aus Ecuador die Wirtschaft am
Niederrhein. Sie knüpfen Kontakte zu
Betrieben und lernen das System der dualen
Ausbildung in Deutschland kennen.
„Wir freuen uns über den Besuch aus
Südamerika. Delegationsreisen sind ein
Türöffner. Sie ermöglichen es den
Unternehmern, ein Land unmittelbar
kennenzulernen. Sich ein Bild zu machen. So
entstehen Kontakte und neue Geschäftsideen“,
erklärt Dr. Stefan Dietzfelbinger,
Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen
IHK. „Da unsere Kombination aus Theorie und
Praxis in der Ausbildung weltweit
einzigartig ist, möchten wir die Vorteile
über Ländergrenzen hinweg bewerben.“

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan
Dietzfelbinger (links) begrüßte Jörg Zehnle,
Geschäftsführer der Auslandshandelskammer
Ecuador, zum fünftägigen Austausch.
Auf dem Programm für den viertägigen
Besuch stehen Gespräche mit Thyssenkrupp
über Wasserstoff als Energieträger. Eine
Besichtigung des Duisburger Hafens ist Teil
des Austausches. Und es geht auch in
Hightech-Werkstatt „FabLab“ der Hochschule
Rhein-Waal. Dort erleben die Geschäftsleute
aus Südamerika, wie Studenten und Gründer
ihre Ideen mittels 3D-Druck verwirklichen.
Auslandshandelskammer unterstützt
Austausch
Im April war bereits eine
Delegation der Niederrheinischen IHK in
Südamerika, um Kontakte für Kooperationen zu
knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Die
Reisen finden in Zusammenarbeit mit der
Auslandshandelskammer (AHK) Ecuador statt.
„Duisburg und der Niederrhein werden als
innovativer Standort wahrgenommen. Besonders
bei den Themen Wasserstoff und duale
Ausbildung. Mit unserer Reise möchten wir
den Grundstein für gemeinsame Projekte
legen“, so Jörg Zehnle, Geschäftsführer der
AHK Ecuador.
Die AHKs
unterstützen deutsche Unternehmen im In- und
Ausland. Sie helfen ihnen, sich auf
internationalen Märkten zu positionieren und
mit und lokalen Geschäftspartnern zu
vernetzen. Außerdem werben sie für das duale
Ausbildungssystem nach deutschem Vorbild.
Auf diese Weise schaffen sie nachhaltige
Partnerschaften im Bereich Fachkräfte. Das
Netzwerk umfasst weltweit 150 Standorte in
90 Ländern.

Auf Einladung der Niederrheinischen IHK
erkunden 30 Unternehmer aus Ecuador die
Wirtschaft am Niederrhein. Im Fokus steht
die duale Berufsausbildung, die auf
besonderes Interesse stößt. Fotos
Niederrheinische IHK/Hendrik Grzebatzki
vhs Moers: PC-Grundlagen am eigenen
Laptop für die Generation 60+
Viele aus der Generation 60+ möchten gerne
mit einem Notebook arbeiten, aber ihnen
fehlen die grundlegenden Kenntnisse. Der
Kurs ‚PC-Grundlagen am eigenen Laptop – 60+‘
der vhs Moers – Kamp-Lintfort, der ab
Montag, 3. November, startet, bietet hier
Unterstützung.
In einer Gruppe von
max. 8 Teilnehmenden geht es um die
wichtigsten Kompetenzen: Ordner anlegen,
Dateien kopieren und löschen, einen Text in
Word erstellen, das Surfen im Internet,
E-Mails schreiben und vieles mehr.
Der Kurs findet insgesamt fünfmal jeweils
montags ab 18 Uhr in den Räumen der vhs
Moers an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10
statt. Mitzubringen ist ein eigenes Notebook
inklusive Netzgerät. Für Apple-Geräte ist
das Seminar nicht geeignet.
Eine
vorherige Anmeldung für den Kurs ist
erforderlich und telefonisch unter 0 28 41
/201 – 565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
vhs Moers lädt zum Spieleabend
am 3. November ein
Brett- und
Karten-, Glücks- und Strategiespiele – es
gibt unzählige verschiedene Arten von
Spielen und ständig kommen neue auf den
Markt. Beim vhs-Abend ‚Spielen – Mehr als
Gewinnen oder Verlieren‘ am Montag, 3.
November, verschafft ein Spielekritiker und
(Mit-)Autor einiger Spiele einen Überblick
über das reichhaltige Angebot. Außerdem
stellt er Neuerscheinungen vor, die
ausprobiert werden können.
Das
Seminar startet um 17.30 Uhr in den Räumen
der vhs Moers an der
Wilhelm-Schroeder-Straße 10. Auf Wunsch
werden mitgebrachte Spiele erläutert. Die
Veranstaltung ist besonders für Lehrpersonal
sowie Erzieherinnen und Erzieher geeignet.
Knabbereien und Getränke stehen für einen
gemütlichen Abend bereit. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich und kann
telefonisch unter 0 28 41/201 -565 sowie
online unter www.vhs-moers.de erfolgen.
Ehrenamt bewegt:
Info-Vormittag im Stadtteilbüro Neu_Meerbeck
Verantwortung übernehmen,
Kontakte knüpfen und das eigene Viertel
mitgestalten – ehrenamtliches Engagement hat
viele Gesichter. Wer sich einbringen möchte,
aber noch nicht genau weiß, wie und wo, ist
am Mittwoch, 5. November, im Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck richtig. Zwischen 10 und 12 Uhr
informiert dort die Freiwilligenzentrale
Moers der Grafschafter Diakonie rund um das
Thema Ehrenamt.
Ob
Nachbarschaftshilfe, Unterstützung bei
Stadtteilprojekten oder kreatives Mitwirken
im Quartier – die Freiwilligenzentrale zeigt
vielfältige Möglichkeiten auf, aktiv zu
werden. Interessierte erfahren, wo ihre
Erfahrungen, Ideen und Talente gebraucht
werden, und erhalten Anregungen, wie
Engagement ganz individuell aussehen kann.
Das Stadtteilbüro Neu_Meerbeck
bietet mit dem Info-Vormittag eine
unkomplizierte Gelegenheit, ins Gespräch zu
kommen, Fragen zu stellen und erste Kontakte
zu knüpfen. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich – einfach vorbeischauen und
sich inspirieren lassen. Rückfragen und
weitere Informationen: Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck, Telefon: 0 28 41 / 201-530,
E-Mail: stadtteilbuero.meerbeck@moers.de.
Wesel:
Öffentliche Wahl des Seniorenbeirats am 31.
Oktober 2025
Die Stadt Wesel
lädt alle Interessierten zur öffentlichen
Wahl des neuen Seniorenbeirates ein. Die
Wahl findet am Freitag, 31. Oktober 2025,
10:00 Uhr, im Ratssaal der Stadt Wesel
(Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) statt.
Das Gremium wird für eine Amtszeit von fünf
Jahren von Delegierten verschiedener
Institutionen gewählt.
Der
Seniorenbeirat ist ein bedeutendes Gremium,
das die Interessen der älteren Generation
vertritt. Der Beirat wirkt aktiv an der
Kommunalpolitik mit. Themen wie Mobilität im
Alter, barrierefreies Wohnen, Gesundheit,
Pflege, Digitalisierung und
gesellschaftliche Teilhabe stehen im Fokus
seiner Arbeit.
Im Rahmen der Wahl
wird der bisherige Seniorenbeirat auch über
seine Arbeit in den vergangenen Jahren
berichten. Dabei wird er Einblicke in
abgeschlossene sowie laufende Projekte
geben. Der Seniorenbeirat besteht aus 13
Mitgliedern. Für die neue Amtszeit haben
sich 21 Personen zur Kandidatur
bereiterklärt.
Kleve:
Vorbeikommen und informieren -
Ausstellungseröffnung zur
Innenstadt-Umgestaltung
Gewinnerentwurf Blick Klosterplatz zum
Kavarinerplatz
Ein erster Blick auf den
Gewinnerentwurf der wbp
Landschaftsarchitekten GmbH aus Bochum.
Bis zur Landesgartenschau im Jahr 2029
soll die Klever Innenstadt attraktiver und
klimaresilienter werden. Mit diesem Ziel
hatte die Stadt Kleve über den Sommer einen
Planungswettbewerb unter
Landschaftsarchitekturbüros veranstaltet, um
moderne Ideen für das Areal im Herzen der
Schwanenstadt zu sammeln.

Seit Anfang Oktober steht fest, welcher der
13 eingereichten Entwürfe die Grundlage für
die zukünftige Gestaltung der Klever
Innenstadt bildet – und in Kürze können sich
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
in der Stadthalle über die konkreten
Planungen informieren.
Am Dienstag,
28. Oktober 2025, wird um 18:00 Uhr im Foyer
der Klever Stadthalle die Siegerehrung des
Wettbewerbes durchgeführt und gleichzeitig
eine umfangreiche Ausstellung zu allen
eingereichten Entwürfen eröffnet. Zu der
öffentlichen Veranstaltung begrüßt Kleves
Bürgermeister Wolfgang Gebing alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger.
Vor Ort werden Vertreterinnen und Vertreter
der wbp Landschaftsarchitekten GmbH ihren
Entwurf für die Klever Innenstadt
vorstellen, der im Rahmen des Wettbewerbes
einstimmig mit dem ersten Platz
ausgezeichnet wurde. Ergänzend wird ein
Vertreter des Preisgerichtes die
Juryentscheidung erläutern und alle
prämierten Entwürfe kommentieren.
Die
Veranstaltung wird darüber hinaus die
Gelegenheit bieten, mit den Verantwortlichen
sowie anderen Interessierten über die
anstehende Innenstadt-Umgestaltung ins
Gespräch zu kommen. Neben dem Siegerentwurf
können auch der zweit- und der
drittplatzierte Entwurf sowie alle übrigen
eingereichten Entwürfe begutachtet werden.
In den Tagen nach der Eröffnung kann die
Ausstellung zu den folgenden Zeiten
kostenfrei und ohne Anmeldung in der
Stadthalle angesehen werden:
Mittwoch,
29.10.2025 17:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag,
30.10.2025 17:00 – 19:00 Uhr
Freitag,
31.10.2025 15:00 – 17:00 Uhr
Samstag,
01.11.2025 14:00 – 16:00 Uhr
Montag,
03.11.2025 17:00 – 19:00 Uhr
Dienstag,
04.11.2025 17:00 – 19:00 Uhr

NRW: Produktion von
Nahrungsergänzungsmitteln seit 2020 um über
60 % gestiegen
* Produktion
stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 7 %.
* Nominaler Absatzwert um 86 % höher als
im Jahr 2020.
* Über 20 % des
bundesweiten Absatzwertes entfiel auf
Betriebe in NRW.
In
Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2024 in 11
Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes
26.500 Tonnen Nahrungsergänzungsmittel
hergestellt worden. Das waren 6,8 % mehr als
ein Jahr zuvor und 61,5 % mehr als im Jahr
2020. Rein rechnerisch könnte mit der im
Jahr 2024 in NRW produzierten Menge jede
Einwohnerin und jeder Einwohner des Landes
monatlich mit 122 Gramm
Nahrungsergänzungsmitteln, wie
Vitaminkapseln oder Calciumbrausetabletten,
versorgt werden.
Wie das
Statistische Landesamt weiter mitteilt,
stieg die Produktionsmenge damit das vierte
Jahr in Folge. Nominaler Absatzwert um 86 %
über dem Wert von 2020 Der Absatzwert lag
2024 bei 415,3 Millionen Euro und war damit
nominal um 5,3 % höher als im Jahr 2023. Im
Vergleich zum Jahr 2020 stieg der Absatzwert
nominal sogar um 86,3 %.
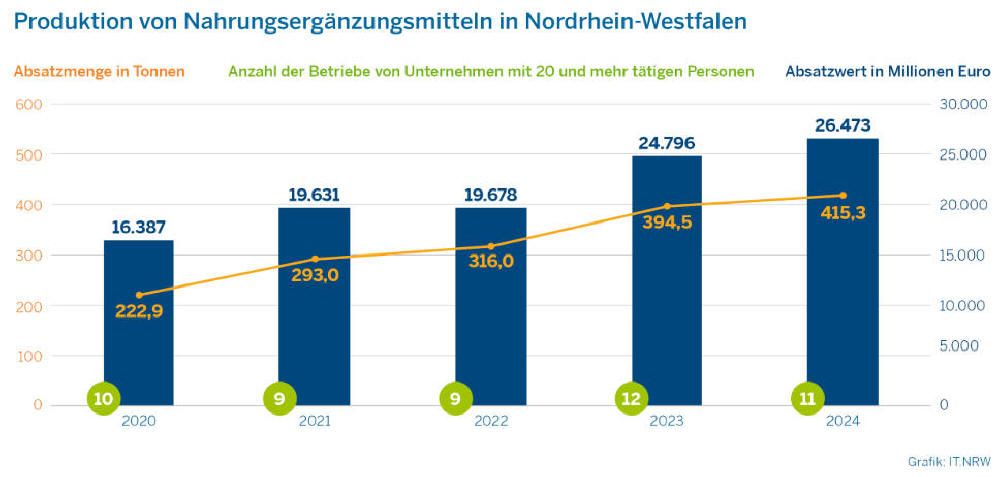
NRW-Betriebe erwirtschafteten mehr als
ein Fünftel des bundesweiten Absatzwertes
Deutschlandweit wurden im letzten Jahr
237.000 Tonnen Nahrungsergänzungsmittel im
Wert von 1,9 Milliarden Euro zum Absatz
produziert. Davon entfielen 11,2 % der
Absatzmenge und 22,4 % des Absatzwertes auf
nordrhein-westfälische Betriebe.
Produktion auch in der ersten Jahreshälfte
2025 gestiegen
Im ersten Halbjahr 2025
wurden in NRW nach vorläufigen Ergebnissen
14.000 Tonnen Nahrungsergänzungsmittel mit
einem nominalen Absatzwert von
215,8 Millionen Euro hergestellt. Das waren
6,1 % bzw. 7,2 % mehr als im entsprechenden
Vorjahreszeitraum.
Zahl der
Auszubildenden zur Bestattungsfachkraft
binnen zehn Jahren verdoppelt
•
Zahl der Beschäftigten und Umsätze im
Bestattungshandwerk gestiegen
• 2024
rund 1 Million Sterbefälle in Deutschland –
16 % mehr als 2014
• Preise für
Bestattungen überdurchschnittlich gestiegen
Allerheiligen, Allerseelen,
Volkstrauertag und Totensonntag – der
November gilt gemeinhin als der Monat des
Gedenkens und des Friedhofbesuchs. Der
Alterungseffekt der Bevölkerung führt zu
einer tendenziell steigenden Zahl der
Sterbefälle und hat damit auch Auswirkungen
auf die Bestattungsbranche.
Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
befanden sich zum Jahresende 2024 insgesamt
890 Personen in einer dualen Ausbildung zur
Bestattungsfachkraft – so viele wie nie
zuvor. Damit hat sich die Zahl der
Auszubildenden in den vergangenen zehn
Jahren mehr als verdoppelt.
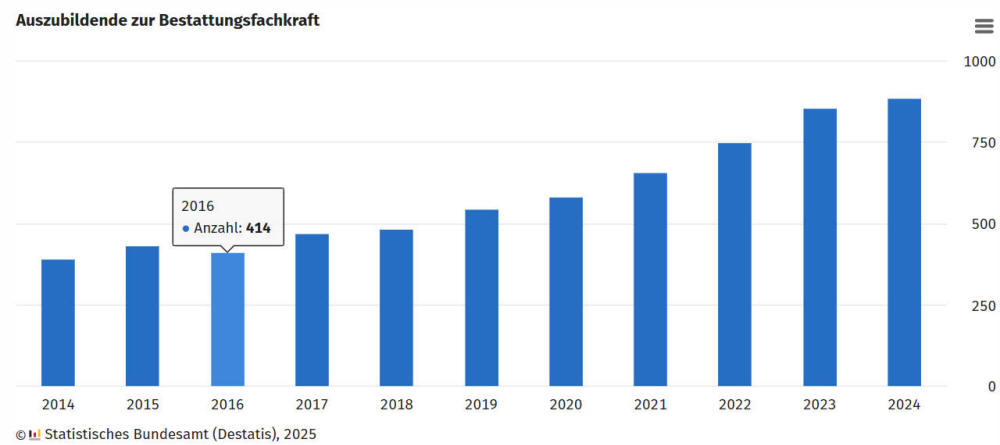
2014 gab es über alle Ausbildungsjahre
hinweg noch insgesamt 390 Auszubildende.
Eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft
wird mittlerweile etwas häufiger von Frauen
gewählt: 2024 waren 57 % der Auszubildenden
in diesem Bereich Frauen, der Männeranteil
lag bei 43 %. Zehn Jahre zuvor lag der
Frauenanteil noch bei 45 %.
26 300 Personen im Jahr 2023 im
Bestattungshandwerk tätig Der zunehmende
Bedarf schlägt sich auch in gestiegenen
Beschäftigtenzahlen und Umsätzen nieder. Im
Jahr 2023 waren rund 26 300 Personen bei den
hierzulande ansässigen 4 200 Unternehmen im
Bestattungshandwerk tätig, das waren 2,5 %
mehr als noch ein Jahr zuvor.
Der
Anteil der geringfügig entlohnten
Beschäftigten ist bei den Bestattern mit
rund einem Drittel (31,2 %) deutlich höher
als im Handwerk insgesamt (12,0 %). Auch die
erwirtschafteten nominalen Umsätze sind 2023
gegenüber dem Vorjahr gestiegen: von rund
2,26 Milliarden Euro auf rund
2,32 Milliarden Euro.
2024 starben
mit rund 1,0 Million Menschen 16 % mehr als
zehn Jahre zuvor
Die Nachfrage nach
Bestattungsdienstleistungen und damit auch
nach Fachkräften in dieser Branche steigt
stetig an – auch aufgrund des zunehmenden
Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung
in Deutschland. Im Jahr 2024 starben
hierzulande rund 1,0 Million Menschen – das
waren 16 % mehr als noch zehn Jahre zuvor.
Im Jahr 2014 gab es rund
868 000 Sterbefälle.
Friedhöfe
erstrecken sich auf 0,1 % der Bodenfläche
Deutschlands
Die Friedhofsflächen
umfassten bundesweit im Jahr 2024 rund
38 500 Hektar – das waren rund 0,1 % der
gesamten Bodenfläche Deutschlands. Nicht
eingerechnet bei den klassischen
Friedhofsflächen sind
Waldbestattungsflächen. Diese erstreckten
sich im Jahr 2024 auf rund 2 500 Hektar.
In Deutschland regeln die
Bestattungsgesetze der Länder die
Bestattungspflicht und den Friedhofszwang.
In einigen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz
oder Schleswig-Holstein gab es Reformen, um
die traditionellen Vorgaben zu lockern.
Knapp neun von zehn importierten
Holzsärgen stammten 2024 aus Polen
Die
Bestattungsbranche hierzulande setzt auch
auf Waren aus dem Ausland. Im Jahr 2024
wurden rund 451 000 Särge aus Holz im Wert
von insgesamt 40,5 Millionen Euro nach
Deutschland importiert. Das waren
mengenmäßig 4,1 % mehr als noch ein Jahr
zuvor. Im Jahr 2023 waren es
433 000 Holzsärge im Wert von
40,9 Millionen Euro.
Knapp neun von
zehn importierten Särgen stammten 2024 aus
Polen (85,1 %). Aus Deutschland exportiert
wurden dagegen im Jahr 2024 rund 1 260 Särge
aus Holz im Wert von 77 000 Euro. Preise für
Bestattungen gestiegen Verbraucherinnen und
Verbraucher mussten für Bestattungen 2024
mehr ausgeben als im Jahr zuvor.
Die
Preise für Särge, Urnen, Grabsteine o.a.
Begräbnisartikel sind im Jahr 2024 um 3,9 %
gegenüber 2023 und die Preise für
Bestattungsleistungen und Friedhofsgebühren
um 4,6 % gestiegen. Zum Vergleich: Die
Verbraucherpreise insgesamt stiegen im
selben Zeitraum um 2,2 %. 8,3 % weniger
Ausgaben für staatliche Kostenübernahme für
Bestattungen als zehn Jahre zuvor.
Nicht immer sind die Hinterbliebenen mit
Mitteln aus dem Nachlass, eigenem Einkommen
oder Vermögen in der Lage, die Kosten einer
Bestattung zu tragen. Im Jahr 2024 haben die
Sozialhilfeträger in Deutschland
54,2 Millionen Euro brutto für sogenannte
Sozialbestattungen ausgegeben – das waren
8,3 % weniger als zehn Jahre zuvor (2014:
59,1 Millionen Euro).
Im Jahr 2024
gab es rund 16 300 Empfängerinnen und
Empfänger wie Angehörige oder
testamentarisch eingesetzte Erben, die zur
Bestattung verpflichtet waren und bei denen
die beantragten Bestattungskosten übernommen
wurden. Zehn Jahre zuvor waren es rund
23 000 Empfängerinnen und Empfänger.
929,8 Millionen Euro kommunale Einnahmen
durch Gebühren und Entgelte im Friedhofs-
und Bestattungswesen im Jahr 2023
Für die kommunalen Kassen sind Bestattungen
aber auch eine Einnahmequelle. Die
Kernhaushalte der Städte und Gemeinden in
den Flächenländern (ohne Stadtstaaten)
erzielten im Jahr 2023 Einnahmen von
929,8 Millionen Euro aus Verwaltungs- und
Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten
im Friedhofs- und Bestattungswesen. Das
waren 1,3 % mehr als im
Jahr 2022 (918 Millionen Euro) und gut ein
Viertel (27,4 %) mehr als zehn Jahre zuvor
(2013: 730 Millionen Euro).
Unseriöse Anbieter unter Handwerkern
erkennen
Jeder vierte Mieter
oder Hauseigentümer mit intransparenten
Rechnungen oder „Wucherpreisen“ konfrontiert
/ Wie sich Verbraucher vor dubiosen
Geschäftemachern schützen können
Mehr
als 1000 Euro für einen einfachen
Schlüsselnotdienst? Mehrere Tausend Euro für
die Beseitigung einer Rohrverstopfung?
Überzogene Preise und dubiose Geschäfte, bei
denen oftmals Menschen in Notlagen
ausgenutzt werden, sind offenbar weit
verbreitet. Zu Ärger führen häufig auch
Rechnungen, die für den Kunden nicht
nachvollziehbar sind. In einer Umfrage der
ADAC Zuhause Versicherung gab jeder vierte
Hauseigentümer oder Mieter an, schon einmal
mit intransparenten Rechnungen oder gar
„Wucherpreisen“ konfrontiert worden zu sein.
Die Versicherung des ADAC z.B. bietet
seit dem letzten Jahr einen Schutzbrief für
Haus und Wohnung an, der häufige
Notfalldienstleistungen abdeckt und damit
auch verhindert, dass unseriöse Anbieter aus
diesen Notlagen Kapital schlagen können.
Verbraucher, die sich selbst auf die Suche
nach Handwerkern begeben müssen, sollten zu
ihrer Sicherheit folgende Tipps beachten:
Internetsuche: Vorsicht bei Notdiensten
und Handwerkern mit dem Kürzel „AAA“ vor dem
Firmennamen oder Einträgen. Sie täuschen
eine führende Position oder örtliche Nähe
oft nur vor. Manche Webseiten werden mit
Unterseiten gezielt auf Städte oder
Stadtteile optimiert (z. B. „Installateur
Berlin“, „Installateur Hamburg“ usw.),
agieren aber von einem zentralen Standort
aus.
So können hohe Kosten für eine
weite Anfahrt entstehen. Bei seriösen Firmen
beinhaltet das Impressum eine vollständige
Adresse und einen Handelsregister- oder
Handwerkskammer-Eintrag. Zudem sollten
Anbieter unter einer regionalen Ortswahl
erreichbar sein, nicht unter einer teuren
0900-Nummer oder nur über Mobilfunk.
- Preisauskunft: Seriöse Anbieter nennen
nach Schilderung der Sachlage auf Anfrage
die Gesamtkosten für die zu erbringende
Leistung, einschließlich der Anfahrt und
etwaiger Zuschläge. Wird keine Preisauskunft
erteilt, gibt es Grund, misstrauisch zu
sein. Das gilt erst recht, wenn Dienste mit
„Sofort-Rabatten“ drängen. Wenn möglich,
sollten Verbraucher einen schriftlichen
Kostenvoranschlag einholen.
- Zeugen
hinzuziehen: Je nach Schaden in Haus oder
Wohnung kann es sein, dass zusätzliche
Kosten entstehen. Auch bei Zusatzarbeiten
sollte vor der endgültigen Auftragserteilung
eine genaue Preisangabe eingeholt werden. Im
Idealfall ist eine dritte Person bei der
Auftragsvergabe anwesend. Ergibt sich keine
Einigung über den Preis, kann der
Auftraggeber kündigen.
- Nicht zur
Barzahlung drängen lassen: Unseriöse
Unternehmen bestehen häufig auf Barzahlung.
Gerade bei Problemen mit Notdiensten oder
auffällig hohen Rechnungen sollte man nicht
direkt vor Ort bezahlen. Barzahlungen an
Handwerker sind außerdem nicht steuerlich
absetzbar. Eine Zahlung per Überweisung ist
hier der bessere Weg.
- Rechnung
prüfen: In der Rechnung sollten der
Stundenlohn und die geleistete Arbeitszeit
transparent ausgewiesen sowie Material- und
Fahrtkosten separat aufgelistet sein. Zudem
lohnt ein genauerer Blick: Fehlen die
Steuernummer oder die laufende
Rechnungsnummer? Werden eventuell Leistungen
oder Materialien berechnet, die bei der
Auftragsklärung nicht vereinbart worden
sind?
Mit einem Schutzbrief für Haus
und Wohnung können Verbraucher unnötigem
Ärger und Stress von vornherein vorbeugen.
„Unsere Pannenhilfe für das Zuhause ist rund
um die Uhr erreichbar und organisiert bei
Notfällen – etwa in den Bereichen Elektro,
Heizung und Sanitär – schnell und
zuverlässig eine Fachkraft aus unserem
deutschlandweiten Handwerkernetzwerk. Durch
diesen Service entfällt die aufwändige Suche
nach Hilfe sowie möglicher Ärger über lange
Wartezeiten oder dubiose Geschäftspraktiken.
Mit den Handwerkern rechnen wir als
Versicherer ab, ohne dass der Kunde in
Vorleistungen gehen muss. Wir übernehmen die
Kosten bis zu 500 Euro“, erklärt Sascha
Herwig, Vorstandsvorsitzender der ADAC
Zuhause Versicherung. „Die rund 2900
qualifizierten Handwerksbetriebe und
Dienstleister des Netzwerks sind geprüft und
unterziehen sich regelmäßigen Audits im
Rahmen eines umfassenden
Qualitätsmanagements.“
Tipps
für den Reifenwechsel und sicheres Fahren
bei Eis und Schnee
Seit 2010
gilt in Deutschland eine situative
Winterreifenpflicht. Das heißt: Bei
Glatteis, Schnee oder Reifglätte dürfen nur
geeignete Reifen verwendet werden. Doch
welche Reifen gelten rechtlich als
Winterreifen - und welche Strafen drohen bei
Verstößen?
Zum Start der
Reifenwechsel-Saison beantwortet der ACV
Automobil-Club Verkehr sieben wichtige
Fragen.

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine
Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern /
Shutterstock
1. Was bedeutet
Winterreifenpflicht?
Die
Winterreifenpflicht sorgt oft für Verwirrung
- geregelt ist sie in § 2 Abs. 3a StVO.
Demnach dürfen Fahrzeuge bei Glatteis,
Schneematsch oder Reifglätte nur mit
geeigneter Bereifung unterwegs sein. Daher
spricht man von einer situativen Pflicht: Es
gibt keinen festen Zeitraum, in dem
Winterreifen vorgeschrieben sind. Autofahrer
müssen ihre Bereifung also immer dann
anpassen, wenn die Straßenverhältnisse es
erfordern.
Die bekannte
"O-bis-O-Regel" (Oktober bis Ostern) ist
lediglich eine Faustregel. Sie ist nicht
rechtsverbindlich, aber eine sinnvolle
Orientierung, da in dieser Zeit mit
winterlichen Bedingungen zu rechnen ist.
Als geeignet gelten nur Fahrzeuge, bei denen
alle vier Räder mit Winter- oder
Ganzjahresreifen mit Alpine-Symbol
ausgestattet sind. Ausnahmen bestehen
lediglich für bestimmte Sonderfahrzeuge (z.
B. Einsatzfahrzeuge), nicht für den normalen
Pkw-Verkehr.
Die Regelung gilt zudem
für alle Fahrzeuge, die in Deutschland
unterwegs sind - auch für solche mit
ausländischer Zulassung. Wer etwa mit
Sommerreifen aus dem Ausland in Deutschland
fährt und bei winterlichen
Straßenverhältnissen kontrolliert wird, muss
ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.
In
schneereichen Regionen oder bei Bergfahrten
können Schneeketten vorgeschrieben sein. Der
ACV empfiehlt, die Ketten passend zur
Reifengröße auszuwählen und das Anlegen
vorab zu üben - so gelingt die Montage im
Ernstfall schnell und sicher.
2.
Welche Reifen gelten rechtlich als
Winterreifen?
Seit dem 1. Oktober 2024
dürfen nur noch Reifen mit Alpine-Symbol
(3PMSF) als Winterreifen verwendet werden.
Für M+S-Reifen, die vor dem 1. Januar 2018
produziert wurden, endete zu diesem
Zeitpunkt die Übergangsfrist.
Auch
Ganzjahresreifen sind erlaubt, sofern sie
das Alpine-Symbol tragen. Sie ersparen den
saisonalen Wechsel, bieten aber weniger Grip
und längere Bremswege bei Schnee und Eis. In
milden Regionen sind sie eine praktische
Lösung, in schneereichen Gebieten bleiben
klassische Winterreifen die sicherere Wahl.
3. Wie viel Profil müssen Winterreifen
haben?
Gesetzlich vorgeschrieben ist eine
Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern.
Unterschreiten Reifen diesen Wert, drohen
Bußgelder, Punkte in Flensburg - und ein
deutlich erhöhtes Unfallrisiko.
Der ACV
empfiehlt, bereits ab 4 Millimetern neue
Winterreifen aufzuziehen. Denn die
Profiltiefe beeinflusst die Bremsleistung
erheblich:
Bei 50 km/h verlängert sich
der Bremsweg auf Schnee mit 1,6 Millimetern
Profil auf rund 38 Meter, während neue
Reifen mit 8 Millimetern Profil nur etwa 26
Meter benötigen.
4. Wie bleiben
Winterreifen sicher und leistungsfähig?
Neben Profil und Alter beeinflussen weitere
Faktoren die Sicherheit von Winterreifen.
Ein entscheidender Punkt ist der Luftdruck,
der sich bei Kälte automatisch verringert.
Zu niedriger Druck mindert die Haftung,
verlängert den Bremsweg und erhöht den
Kraftstoffverbrauch - daher sollte er
regelmäßig überprüft werden. Die
Herstellerangaben finden sich im Tankdeckel,
in der Bedienungsanleitung oder auf einem
Aufkleber im Türrahmen.
Um
gleichmäßigen Verschleiß zu fördern,
empfiehlt der ACV, die Reifen etwa alle
10.000 Kilometer zwischen Vorder- und
Hinterachse zu tauschen. So bleibt die volle
Leistungsfähigkeit länger erhalten.
E-Autos stellen durch ihr höheres Gewicht
besondere Anforderungen. Zwar sind keine
speziellen Winterreifen vorgeschrieben, der
ACV rät aber zu Reifen mit höherem
Tragfähigkeitsindex. Modelle mit niedrigem
Rollwiderstand können zudem die Reichweite
verbessern.
5. Wann müssen
Winterreifen ersetzt werden?
Auch das
Alter spielt eine Rolle: Nach spätestens
sechs bis acht Jahren sollten Winterreifen
ausgetauscht werden, da die Gummimischung
aushärtet und ihre Elastizität verliert -
selbst bei ausreichendem Profil.
Orientierung bietet die DOT-Nummer an der
Reifenflanke: Die letzten vier Ziffern
zeigen Produktionswoche und Jahr, etwa
"2218" für die 22. Woche 2018.
Beim
Neukauf lohnt sich ein Blick in aktuelle
Winterreifentests. Sie helfen, sichere und
preislich attraktive Modelle zu finden.
6. Welche Strafen drohen bei einem
Verstoß?
Wer bei winterlichen Bedingungen
mit Sommerreifen fährt, muss mit Bußgeldern
und einem Punkt im Fahreignungsregister
rechnen. Dank der Kennzeichnung lassen sich
Allwetter- und Winterreifen leicht
überprüfen.
Wichtig zu wissen: Allein
die Montage der Winterreifen nützt nicht
allzu viel, wenn die gesetzliche
Mindestprofiltiefe nicht eingehalten wird.
Auch diese wird von der Polizei
kontrolliert. Bei falscher Bereifung im
Winter drohen Bußgelder zwischen 60 und 120
Euro sowie jeweils ein Punkt in Flensburg,
abhängig von der Schwere des Verstoßes:
60 EUR für das Fahren mit Sommerreifen,
80 EUR bei Behinderung,
100 EUR bei
Gefährdung und
120 EUR bei Unfallfolge.
Bei zu geringer Profiltiefe werden 75
EUR und ein Punkt fällig. Ein Fahrverbot ist
in keinem Fall vorgesehen.
7. Wie
wirkt sich ein Verstoß auf den
Versicherungsschutz aus?
Ein Verstoß
gegen die Winterreifenpflicht kann nicht nur
Geldbußen, sondern auch Konsequenzen für den
Versicherungsschutz nach sich ziehen:
Kaskoversicherung: Leistungen können gekürzt
oder verweigert werden, wenn ein Unfall mit
Sommerreifen verursacht wurde.
Haftpflichtversicherung: Selbst ohne eigenes
Verschulden droht eine Mithaftung, da
Sommerreifen eine erhöhte Betriebsgefahr
darstellen. In der Praxis liegt diese oft
bei etwa 20 Prozent.
Verschuldensvermutung: Wer im Winter mit
Sommerreifen fährt, gilt grundsätzlich als
mitschuldig. Nur wenn der Unfall auch mit
Winterreifen unvermeidbar gewesen wäre,
entfällt diese Annahme.
Versicherungen
prüfen in solchen Fällen häufig auch auf
grobe Fahrlässigkeit. Wird diese angenommen,
kann der Leistungsumfang deutlich gekürzt
oder komplett gestrichen werden.
Dinslaken: Schaurig-schöne Lesestunde in der
Bücherstube Lohberg
In der
Bücherstube Lohberg wird es am Donnerstag,
30. Oktober 2025, gespenstisch gemütlich.
Von 16:00 bis 17:30 Uhr lädt das Team der
Bücherstube Kinder ab 5 Jahren zu einer
Grusel-Lesung unter dem Motto
„Schaurig-schöne Lesestunde“ ein. Inmitten
von Büchern und Gespenstern wird eine
passende Geschichte vorgelesen.
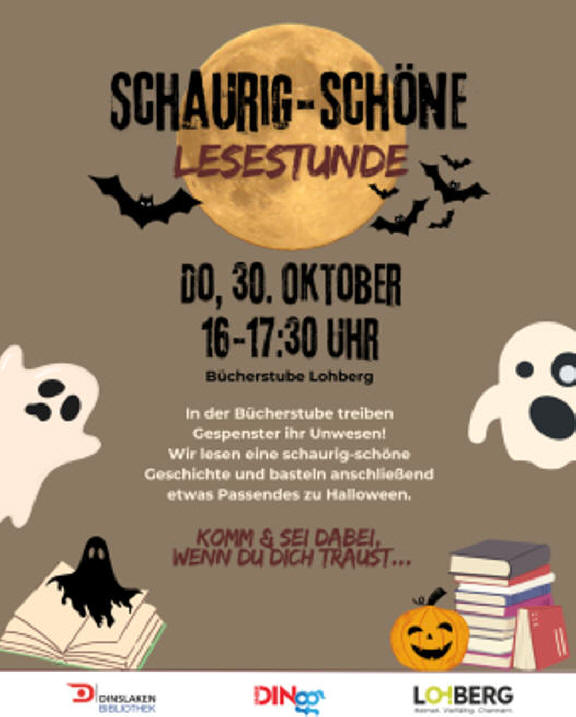
Im Anschluss können die kleinen
Besucherinnen und Besucher bei einer
Bastelaktion ihrer Kreativität freien Lauf
lassen. Wer möchte, darf gerne im
Halloweenkostüm kommen. Der Eintritt ist
frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Aktion ist Teil der Quartiersarbeit in
Lohberg und wird durch Landesmittel des
Programms „kinderstark – NRW schafft
Chancen“ gefördert. Anprechpartnerin: Elisa
Rickert, Stadtbibliothek Dinslaken
(elisa.rickert@dinslaken.de)
Moers: Illustrative Collagen aus
bemaltem Papier
Naturcollagen
mit ganz eigenem Charme fertigen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines
Workshops der vhs Moers – Kamp-Lintfort an.
Der Kurs startet am Donnerstag, 30. Oktober,
und findet dann insgesamt sechsmal
donnerstags statt.

Foto: Katja Jäger
Botanische
Formen, die auf Papier gebracht und
anschließend ausgeschnitten werden, sollen
als Schnipsel für Naturillustrationen
zusammengesetzt und geklebt werden. Die
Veranstaltung ‚Illustrative Collagen aus
bemaltem Papier‘ beginnt jeweils um 17 Uhr
in der vhs Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße
10. Eine vorherige Anmeldung ist
erforderlich und telefonisch unter 0 28
41/201 – 565 oder online unter www.vhs-moers.de möglich.
Notdienst am Feiertag: Enni
auch an Allerheiligen erreichbar
Die Unternehmen der Enni-Gruppe (Enni)
sind auch an Allerheiligen im Einsatz. Für
besondere Notfälle in der Energie- und
Wasserversorgung sowie der öffentlichen
Kanalisation oder auf den Moerser Straßen
können Kunden einen Bereitschaftsdienst rund
um die Uhr unter der Moerser Rufnummer
02841/104-114 erreichen.
Die
Kundenzentren und der
Kreislaufwirtschaftshof bleiben an dem
Feiertag naturgemäß geschlossen.
Moers: Herbstputz vor Allerheiligen
- Enni bereitet Friedhöfe auf
Feiertagsbesuche vor
Der Herbst
ist da und das jährliche Naturschauspiel
sorgt derzeit nicht nur bei Hobbygärtnern
für viel Arbeit. Auch auf den Moerser
Friedhöfen rieselt in diesen Tagen
tonnenweise Laub. So putzen die Ruhestätten
aktuell viele gewerbliche Friedhofsgärtner
und auch Tim Ketelaers, Teamleiter für die
Friedhofpflege bei der ENNI Stadt & Service
Niederrhein (Enni), gemeinsam mit seinem
rund 20-köpfigen Team für die großen
kirchlichen Feiertage heraus.
Denn
an Allerheiligen am 1. November und am
Totensonntag am 23. November werden wieder
viele Katholiken und Protestanten auf den
insgesamt 51 Hektar großen Anlagen erwartet,
die hier ihrer Verstorbenen gedenken. Auf
einigen Moerser Friedhöfen werden dabei auch
wieder Messen und Andachten stattfinden.
„Dann sollen die Friedhöfe ein würdevolles
Erscheinungsbild bieten“, sagt Ketelaers.
„Auch wenn etwas frisch gefallenes
Laub auf den Wegen sicher liegen wird. Unser
Ziel ist es, dass die Friedhöfe sich gut
präsentieren und sicher begehbar sind.“
Dem Friedhofsgärtner ist dabei wichtig, dass
neben den Wegen auch das Ehrengrab des
großen Moersers Hanns Dieter Hüsch und die
Kriegsgräber gepflegt sind. Die
Kriegsgräberstätten und deren Geschichte
sind ein unvergessener und wichtiger Teil
der Stadtgeschichte.
In den letzten
Jahren hatte Enni viele Kriegsgräber-Anlagen
mit einer hierauf spezialisierten Fachfirma
restauriert und dabei vor allem die alten
Steine mit ihren Inschriften überarbeitet.
„Bei diesen Instandsetzungsarbeiten an
immerhin mehr als 600 Grabsteinen haben wir
auch alle Anforderungen an den Denkmalschutz
berücksichtigt“, sagt Ketelaers.
Auch viele Moerserinnen und Moerser sind in
diesen Tagen bei der Pflege der Gräber ihrer
verstorbenen Angehörigen besonders aktiv.
„Das ist an den Abfallbehältern, die auf den
Anlagen verteilt sind, deutlich zu merken“,
so Ketelaers. Die Enni-Mitarbeiter leeren
sie derzeit häufiger, damit immer
ausreichend Platz für die Abfälle vorhanden
ist. „So vorbereitet steht dem Besuch der
Moerser Friedhöfe zu den anstehenden
Feiertagen nichts im Wege.“
Krimilesung mit Erwin Kohl in der
Stadtbücherei Kleve
Am
Donnerstag, 30. Oktober 2025 ist ab 19:30
Uhr (Einlass: 19:00 Uhr) Krimizeit in der
Stadtbücherei Kleve! Erwin Kohl liest aus
seinem neuesten Krimi. Es wird wieder
spannend am Niederrhein. Diesmal geht es für
Detektiv und Dauercamper Lukas Born um „Jede
Menge Kies“: "Eigentlich sollte
Privatermittler Lukas Born herausfinden, wer
dem Bauern Gerd Heitkamp ans Leder will.

Doch kaum hat er den Auftrag angenommen,
liegt sein Klient auch schon mausetot auf
der Wiese - genau dort, wo Heitkamp am
Vorabend gegen die Auskiesung von Ackerland
demonstriert hat. Warum wollte er mitten in
der Nacht nach Hause laufen? Wem ist er
unterwegs begegnet? Und vor allem: Welches
Geheimnis hat er mit in den Tod genommen?"
(Verlagstext).
Erwin Kohl lebt in
Alpen, dem Ort, in dem er 1961 geboren
wurde. Den Niederrhein hat er seitdem nie
wirklich verlassen. Hier holt er sich die
Inspirationen für seine Geschichten.
Eintrittskarten gibt es aktuell bereits im
Vorverkauf für 5€ in der Stadtbücherei
Kleve, Wasserstraße 30, 47533 Kleve.
Kleve: Berührend schöne
„Enigma-Variationen“ in der Kleinen Kirche
Wie klingt ein Stück für großes
Sinfonieorchester, reduziert auf nur zwei
Instrumente? Hört man das Duo Amabile,
bestehend aus Paula Breland (Klarinette) und
Anna-Katharina Schau (Akkordeon), hat man
die Antwort: berührend schön.

Das Duo Amabile. Foto: (c) Clara Evens
Am 2. November um 18 Uhr gastieren die
beiden jungen Musikerinnen im Rahmen der
„Besonderen Reihe“ in der Kleinen Kirche an
der Böllenstege. Edward Elgars
„Enigma-Variationen“, eines der spannendsten
Werke des 19. Jahrhunderts, erklingen dort
in einer Bearbeitung für Klarinette und
Akkordeon.
Sie werden umrahmt durch
zeitgenössische Kompositionen, inspiriert
von Elgars Musik und eigens komponiert für
dieses Projekt. Die Idee, ein bekanntes
romantisches Stück ins Zentrum eines
Konzertprogramms zu stellen und neue Werke
dazu in Auftrag zu geben, tragen die beiden
Musikerinnen schon länger mit sich herum.
Mit Michaela Catranis (*1985),
Martín Donoso Vera (*1991) und René Kuwan
(*1983) haben sie drei junge Komponist*innen
ausgewählt, die sich der Herausforderung auf
sehr unterschiedliche Weise gestellt haben.
Das rund einstündige Konzert erklingt ohne
Pause: Alte und neue Musik fließen
unmittelbar ineinander über, was zu
faszinierenden Effekten führt. Eindrucksvoll
raunen, flüstern und tosen die modernen
Stücke – immer wieder kontrastiert durch
einzelne Variationen aus Elgars Werk.
Die „Enigma-Variationen“ bilden den
Dreh- und Angelpunkt des klug durchdachten
Programmkonzepts, den „Fels in der
Brandung“, wie Paula Breland und
Anna-Katharina Schau es beschreiben. Die
beiden Musikerinnen sind übrigens nicht zum
ersten Mal in Kleve: Bereits 2023
begeisterten sie gemeinsam mit ihrer
Triopartnerin Jennifer Aßmus (Violoncello)
im Museum Kurhaus, damals als
frischgebackene Stipendiatinnen des
Deutschen Musikrats.
Konzertkarten
für 12 Euro (5 Euro für Schüler und
Studierende) gibt es an allen
Reservix-Vorverkaufsstellen (Buchhandlung
Hintzen, Niederrhein Nachrichten, Klever
Rathaus-Info) und
hier. Einlass ab 17.30 Uhr, freie
Platzwahl in der Kirche.
FERNGESPRÄCH in Moers: Familiengeschichten,
die ins Herz treffen
Für eine
besondere literarische Doppel-Lesung öffnet
die Bibliothek Moers am Montag, 3. November,
um 19.30 Uhr ihre Türen: Annika Büsing und
Anna Brüggemann präsentieren ihre Romane
‚Wir kommen zurecht‘ und ‚Wenn nachts die
Kampfhunde spazieren gehen‘.

Fotos Nils Schwarz, Lauree Thomas
Beide Familiengeschichten erzählen von
jungen Menschen, die versuchen, aus dem
langen Schatten ihrer Eltern herauszutreten
– leise, vielschichtig, humorvoll und
zutiefst menschlich. Durch die komplexen
Gefilde familiärer Reibungen führt Jan
Philipp Rudloff, Autor, Psychologe und
Podcaster (u. a. ‚Quarks‘, ‚Was los
Wissenschaft‘).
Ausgezeichnete
Autorinnen
Annika Büsing lebt und
arbeitet in Bochum. Ihr Debüt ‚Nordstadt‘
wurde u. a. mit dem Literaturpreis Ruhr
ausgezeichnet. Dieser und auch ihr
Folgeroman ‚Koller‘ wurden für die Bühne
adaptiert. Die Berlinerin Anna Brüggemann
ist Drehbuchautorin, Schriftstellerin und
Schauspielerin. Für ihr Debüt
‚Trennungsroman‘ erhielt sie 2021 den
Debütpreis der lit.COLOGNE.
Die
Lesung gehört zur Reihe FERNGESPRÄCH, einer
Aktion des Netzwerks literaturgebiet.ruhr,
gefördert von der Kunststiftung NRW. Sie
wird in Kooperation mit der vhs Moers –
Kamp-Lintfort durchgeführt. Tickets sind für
15 Euro in der Bibliothek erhältlich.
RuhrKultur.Card-Inhaber zahlen nur die
Hälfte (begrenztes Kontingent).
Reservierungen sind telefonisch unter
0 28 41 / 201‑753 oder per E-Mail an bibliothek@moers.de möglich
(bitte ggf. die RuhrKulturCard bei der
Reservierung angeben).
Moers: Saunatreffs im November im
Freizeitbad
Ist der November
zwar meist dunkel und trübe, können sich
Sauna-Fans in besonderem Maße auf den Monat
freuen: Denn die ENNI Sport & Bäder
Niederrhein (Enni) lädt zu gleich drei
Sauna-Treffs in das Freizeitbad
Neukirchen-Vluyn ein. Im 14-tägigen Turnus,
jeweils samstags von 18 Uhr bis Mitternacht,
zelebriert das Team des Frei-zeitbads
stündlich einmalige Aufguss-Zeremonien.
Der Sauna-Treff am Samstag, 1.
November, spürt unter dem Motto „Gruselzeit“
noch einmal Halloween nach. Wem der
Horrorspaß am vorangegangenen Abend noch
nicht genug war, kann bei dem dies-mal
leicht verrückten Sauna-Event unheimliche
und „eklige“ Aufguss-rituale erleben.
Duft-Kompositionen wie wilder Kürbis,
„Glibbergrüt-ze“, Slibowitz, Citrus-Orange
oder Latschenkiefer stehen auf dem Programm.
Extrem heiß wird der „Hexenkessel“
zelebriert und der „Gluthauch“ heizt allen
Sauna-Gästen richtig ein.
Das
Motto „Entspannung und Erholung“ weist für
den Samstag, 15. November, dann wieder auf
Saunieren in normaleren Bahnen hin.
Aufguss-Zeremonien wie Grüner Tee,
Holunderbeeren, Eis-Limone, Apfel und
Lemongras versprechen eine einmalig relaxte
Auszeit.
Der dritte Sauna-Treff
des Monats am Samstag, 29. November, stimmt
dann auf die bevorstehende Adventszeit ein.
Dabei greifen die Aufgüsse einige typische
Düfte auf. Bratapfel mit Amaretto,
Euka-Gold, Sibirische Birke, Wintermärchen
und Gewürzspekulatius beglei-ten die Gäste
in die besinnlichen Wochen der langsam
beginnenden Weihnachtszeit.
An
allen drei Abenden können die Besucher das
gesamte Freizeitbad Neukirchen-Vluyn
ausschließlich textilfrei nutzen. Weitere
Informatio-nen – auch zu den
Eintrittspreisen – gibt es unter
www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de
NRW: Gemeinden und Gemeindeverbände
konnten 2024 nur knapp 93 % ihrer
Auszahlungen durch Einzahlungen decken
* Deckungsgrad aller Gemeinden
und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens
zusammen das zweite Jahr in Folge deutlich
unter 100 %.
* Thüringen war das einzige
Flächenland Deutschlands, in dem die
Gemeinden und Gemeindeverbände in Summe ihre
Auszahlungen durch Einzahlungen decken
konnten. * Mehr als 4 von 5 Kreisen und
kreisfreien Städten in Deutschland wiesen
2024 mehr Aus- als Einzahlungen auf.
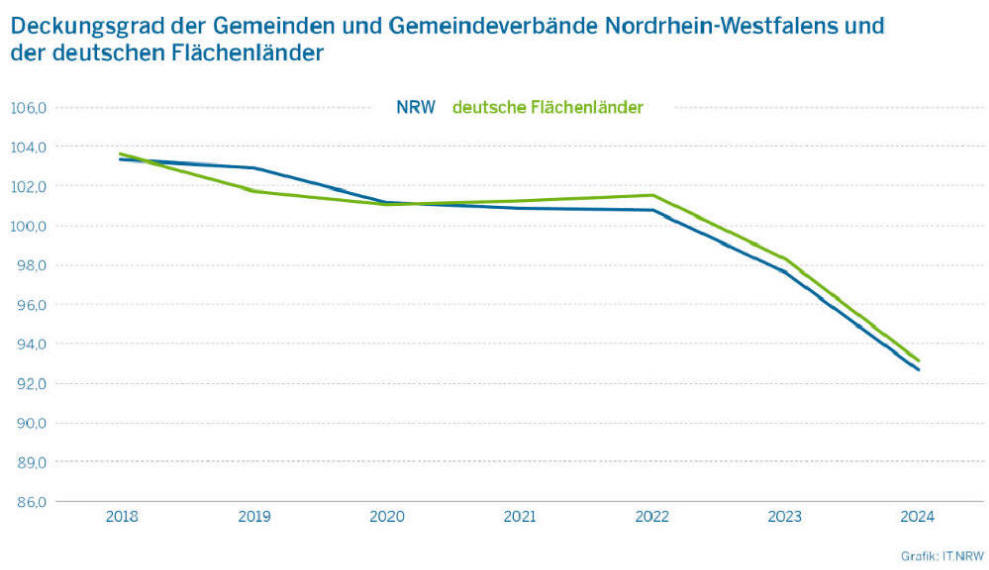
Die Gemeinden und Gemeindeverbände in
Nordrhein-Westfalen zusammengenommen konnten
2024 nur 92,8 % ihrer Auszahlungen durch
Einzahlungen decken. In absoluten Zahlen
ausgedrückt entsprach das einer Unterdeckung
in Höhe von 6,8 Mrd. Euro. Wie das
Statistisches Landesamt mitteilt, lag der
sogenannte Deckungsgrad somit das zweite
Jahr in Folge deutlich unter 100 %.
Im Jahr 2018 hatte er noch bei 103,5 %
gelegen, d. h. auf kommunaler Ebene haben
die Einzahlungen damals die Auszahlungen
übertroffen. Bundesweit lag der Deckungsgrad
2024 der Gemeinden und Gemeindeverbände
aller Flächenländer mit 93,3 % nur
geringfügig über dem Wert von NRW. Die
zeitliche Entwicklung verlief bundesweit
sehr ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen.
Thüringen mit höchstem und Niedersachsen
mit niedrigstem Deckungsgrad
In 12 von 13
deutschen Flächenländern konnten die
Gemeinden und Gemeindeverbände in Summe ihre
Auszahlungen nicht decken. Lediglich die
kommunale Ebene in Thüringen hatte 2024
einen Deckungsgrad von über 100 % (101,0 %)
und konnte diesen im Vergleich zu 2018
halten.
Bei den Gemeinden und
Gemeindeverbänden der anderen Flächenländer
ist diese Kennziffer unter 100 % gefallen.
In Niedersachsen war der Deckungsgrad der
kommunalen Ebene 2024 mit 89,5 % am
niedrigsten. Mehr als 4 von 5 Kreisen und
kreisfreien Städten der deutschen
Flächenländer 2024 mit Deckungsgrad unter
100 %
Die Betrachtung der einzelnen
kreisfreien Städte und Kreise
(einschließlich kreisangehöriger Gemeinden)
aller deutschen Flächenländer im Jahr 2024
zeigt, dass mehr als 4 von 5 von ihnen ihre
Auszahlungen nicht durch Einzahlungen decken
konnten.
Sie wiesen damit einen
Deckungsgrad unter 100 % auf. 2018 war es
umgekehrt, damals hatten mehr als 4 von 5
von ihnen einen Deckungsgrad von über 100 %.
92,5 % der nordrhein-westfälischen Kreise
und kreisfreien Städte hatten im Jahr 2024
einen Deckungsgrad unter 100 %. Lediglich
die Kreise Olpe, Soest und Minden-Lübbecke
sowie die kreisfreie Stadt Hagen konnten
ihre Auszahlungen noch durch entsprechende
Einzahlungen decken.
Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte
2024 in vielen Mangelberufen
überdurchschnittlich stark vertreten
• Anteile in der Schweiß- und
Verbindungstechnik 2024 bei 60 %, in der
Lebensmittelherstellung und bei Köchinnen
und Köchen je 54 %, im Gerüstbau bei 48 %
• Branchen: Mehr als die Hälfte (54 %)
der abhängig Beschäftigten in der
Gastronomie hat eine Einwanderungsgeschichte
• Anteil in der Gesamtwirtschaft bei
einem Viertel (26 %)
Ob in der
Produktion und Fertigung, der Gastronomie,
der Pflege oder im Personen- und
Güterverkehr: In vielen Engpassberufen sind
Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte
überdurchschnittlich stark vertreten. So
hatten 60 % der Beschäftigten in der
Schweiß- und Verbindungstechnik im Jahr 2024
eine Einwanderungsgeschichte, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
In der Lebensmittelherstellung sowie bei
Köchinnen und Köchen traf dies auf mehr als
die Hälfte der Beschäftigten zu (je 54 %).
Überdurchschnittlich hoch war der Anteil
auch im Gerüstbau (48 %), unter den
Fahrerinnen und Fahrern von Bussen und
Straßenbahnen (47 %), in der
Fleischverarbeitung (46 %) sowie unter
Servicekräften in der Gastronomie (45 %).
In der Gesamtwirtschaft hatte gut
ein Viertel (26 %) aller abhängig
Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte.
Sie selbst oder beide Elternteile waren also
seit dem Jahr 1950 nach Deutschland
eingewandert. In sogenannten Engpassberufen
herrscht oder droht laut Engpassanalyse der
Bundesagentur für Arbeit (BA) ein
Fachkräftemangel.
Knapp ein Drittel
der Beschäftigten in der Altenpflege hat
eine Einwanderungsgeschichte
Deutlich
über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt
liegt der Anteil der Beschäftigten mit
Einwanderungsgeschichte auch in weiteren
Mangelberufen: so etwa in der Kunststoff-
und Kautschukherstellung (44 %), im
Hotelservice (40 %), bei
Berufskraftfahrerinnen und -fahrern im
Güterverkehr (39 %), in der
Metallbearbeitung (37 %), in der Altenpflege
(33 %), bei Speditions- und
Logistikkaufleuten (32 %) sowie im Metallbau
oder der Elektrotechnik (je 30 %).
Der geringste Anteil an Beschäftigten mit
Einwanderungsgeschichte in einem
Engpassberuf war im Rettungsdienst (8 %), in
der Justizverwaltung (9 %) und in der
Landwirtschaft (15 %) zu finden. Auch wenn
es sich nicht um Mangelberufe laut
Engpassanalyse der BA handelt, sind Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in einigen
Berufsgruppen ähnlich stark
unterrepräsentiert: Das trifft vor allem auf
den Polizeivollzugsdienst (7 %), Berufe in
der öffentlichen Verwaltung sowie in der
Sozialverwaltung und -versicherung (je 9 %),
auf Lehrkräfte (Primarstufe: 9 %,
Sekundarstufe: 12 %) sowie auf Berufe in der
Steuerverwaltung (10 %) zu.
Beschäftige mit Einwanderungsgeschichte in
ausgewählten Engpassberufen 2024 Bar chart
with 19 bars. Anteil an allen abhängig
Beschäftigten je Beruf in % Klassifikation
der Berufe 2010 (KldB 2010);
Berufsuntergruppen.
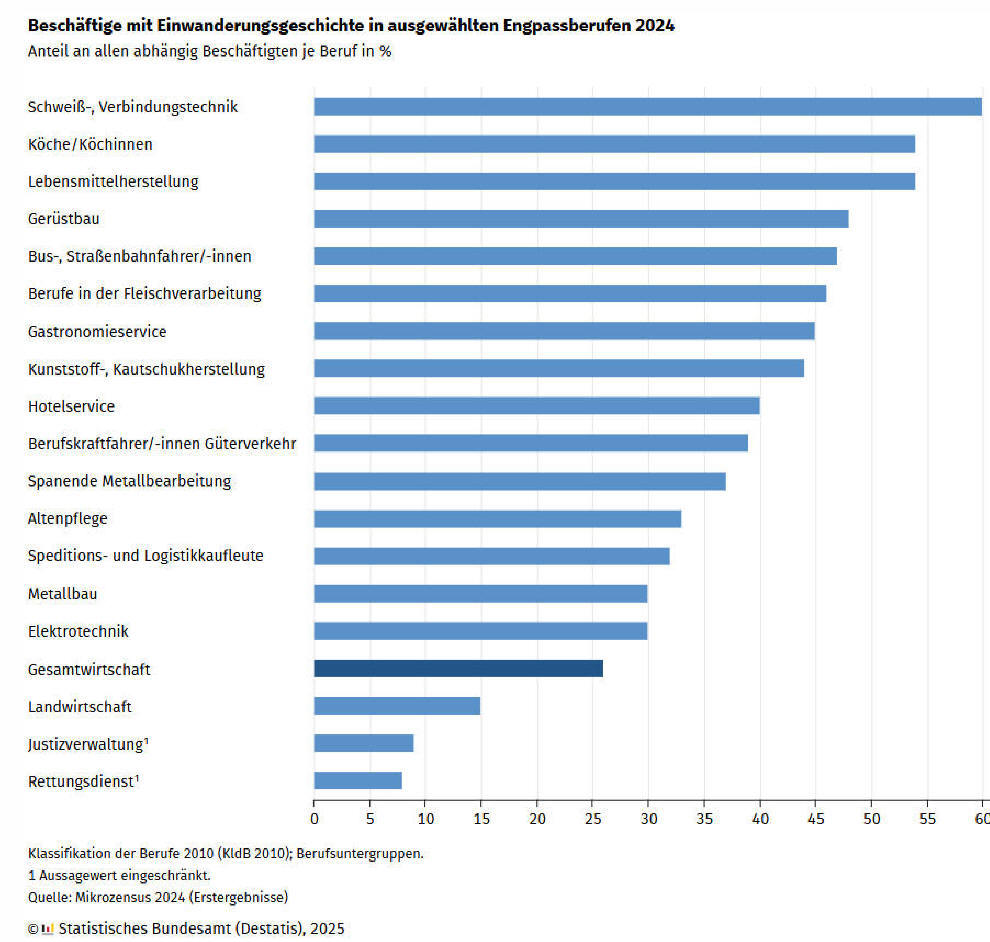
Branchen: Gastronomie und
Gebäudebetreuung anteilig mit den meisten
Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte
Der Anteil der Menschen mit
Einwanderungsgeschichte ist nicht nur in
vielen Mangelberufen hoch. Einige Branchen
sind insgesamt in besonderem Maße auf diese
Arbeitskräfte angewiesen. Das ist vor allem
in der Gastronomie der Fall: Mehr als die
Hälfte (54 %) aller abhängig Beschäftigten
in der Gastronomie, unabhängig vom jeweils
ausgeübten Beruf, hatte 2024 eine
Einwanderungsgeschichte.
In der
Gebäudebetreuung, die zum Großteil aus
Gebäudereinigung besteht, zu der aber auch
Garten- und Landschaftsbau zählen, hatte die
Hälfte (50 %) der Beschäftigten eine
Einwanderungsgeschichte. Einen
überdurchschnittlich großen Anteil hatten
Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte
auch in der Beherbergung (43 %), bei Wach-
und Sicherheitsdiensten, in privaten
Haushalten mit Hauspersonal sowie in der
Lagerei und Erbringung von sonstigen
Dienstleistungen für den Verkehr (je 42 %)
und im Spiel-, Wett- und Lotteriewesen sowie
bei Post-, Kurier und Expressdiensten (je
41 %).
In zwei beschäftigungsstarken
Bereichen mit jeweils mehr als einer
Million Beschäftigten lag der Anteil mit
einem knappen Drittel ebenfalls deutlich
über dem Durchschnitt in der
Gesamtwirtschaft (26 %): In Alten- und
Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen
sowie in der Kraftwagenproduktion hatten je
32 % der abhängig Beschäftigten eine
Einwanderungsgeschichte.
Deutlich
unterrepräsentiert waren Menschen mit
Einwanderungsgeschichte im Jahr 2024 dagegen
im Bereich öffentliche Verwaltung,
Verteidigung und Sozialversicherung (12 %),
in der Versicherungsbranche (14 %), in der
Energieversorgung und in der Landwirtschaft
(je 15 %). Im Bereich Erziehung und
Unterricht mit 2,8 Millionen Beschäftigten
waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte
ebenfalls deutlich unterrepräsentiert
(17 %).
Beschäftigte mit
Einwanderungsgeschichte in ausgewählten
Branchen 2024 Bar chart with 16 bars. Anteil
an allen abhängig Beschäftigten je Branche
in % Klassifikation der Wirtschaftszweige
2008 (WZ2008); Wirtschaftsabteilungen.
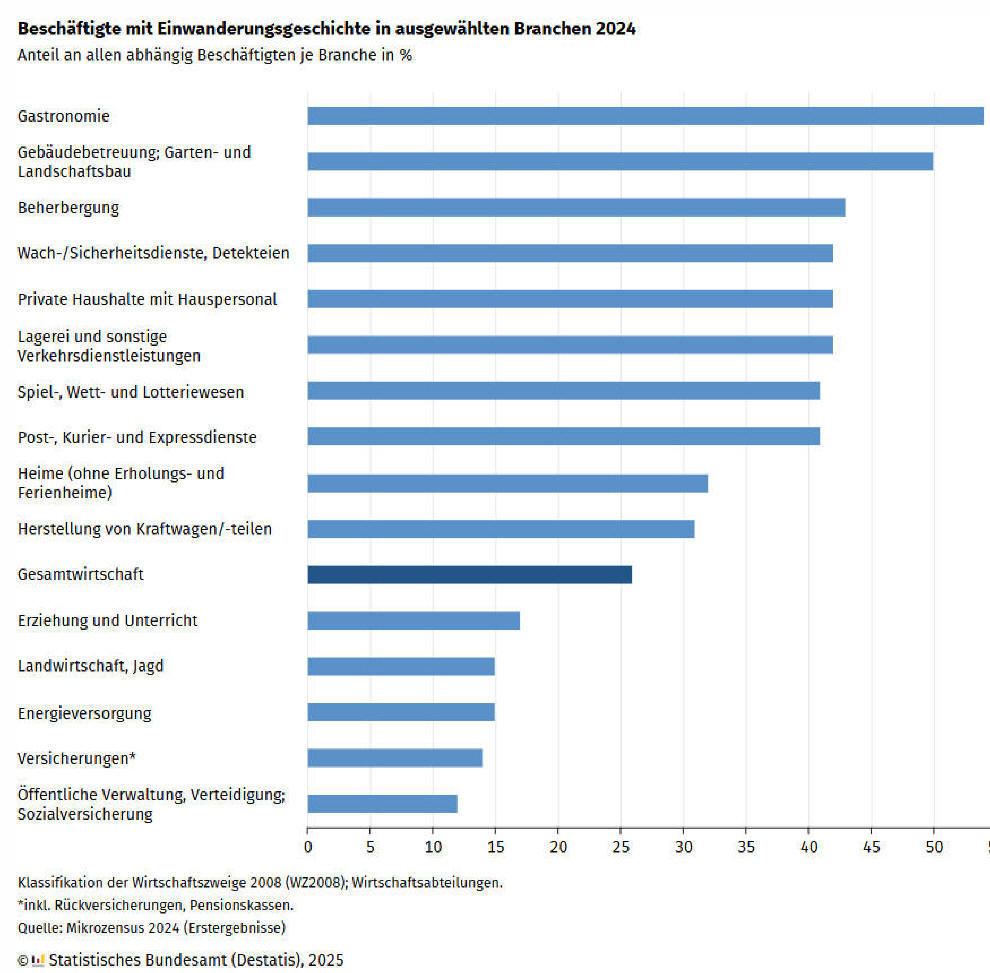
|