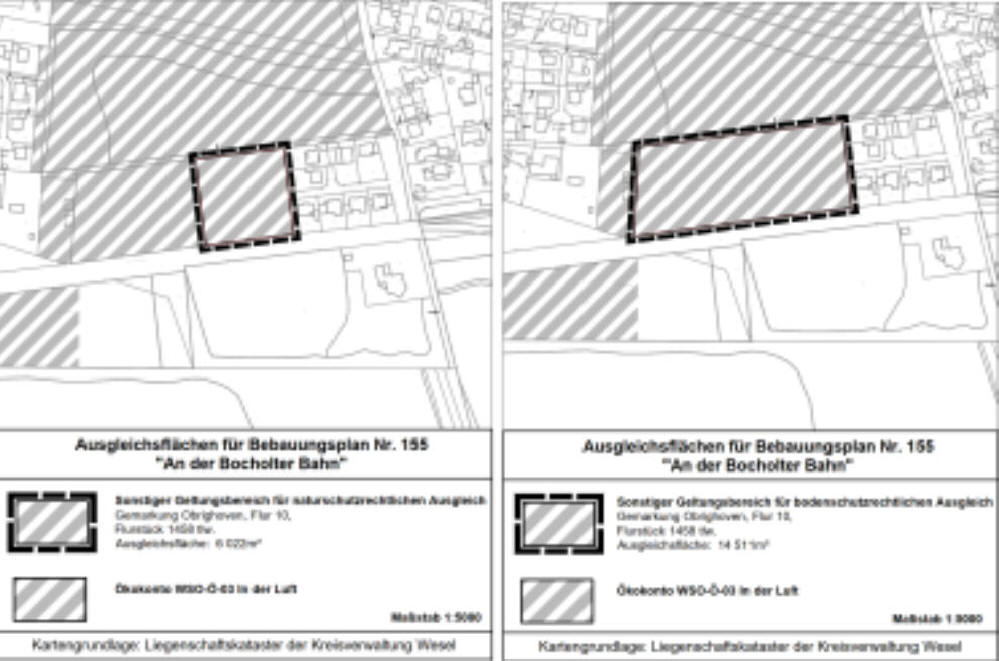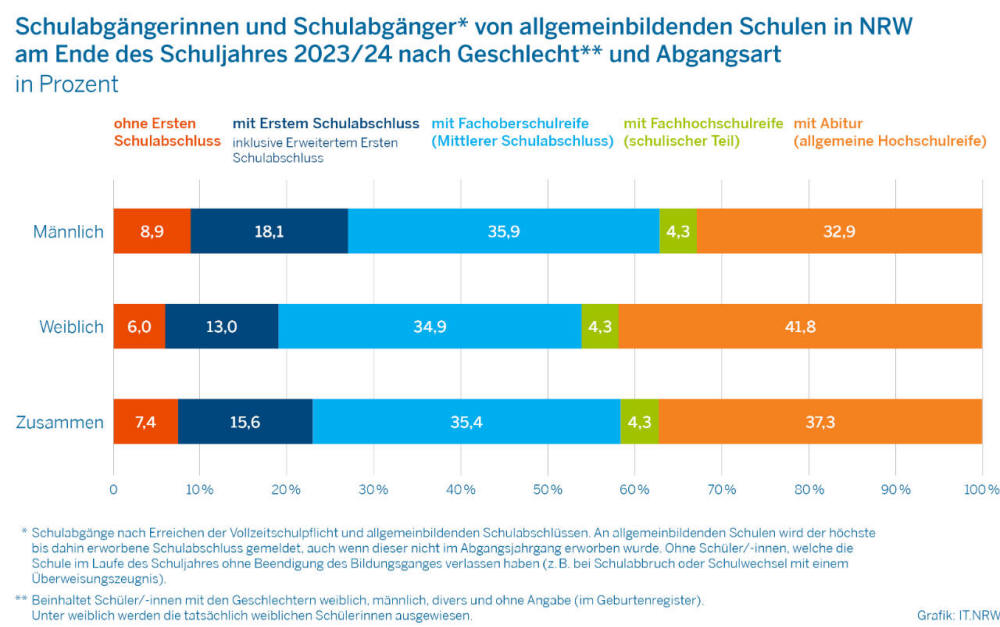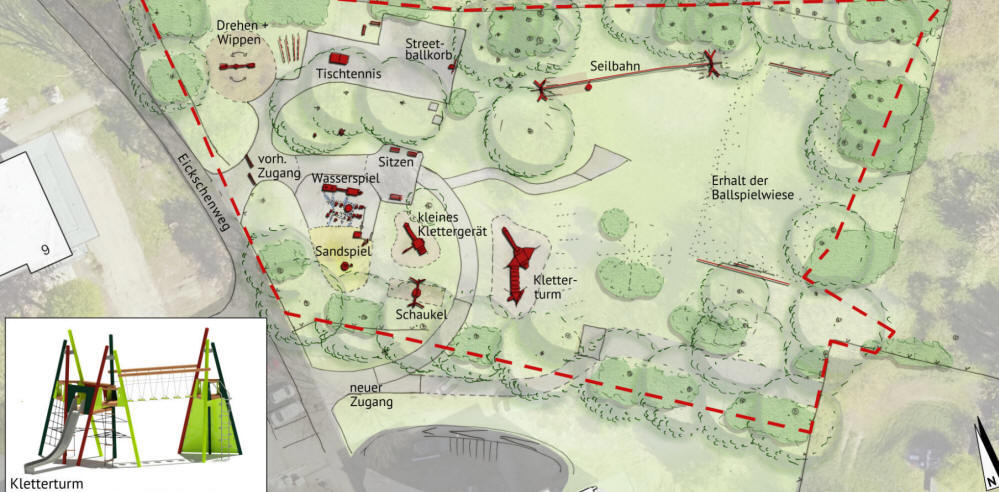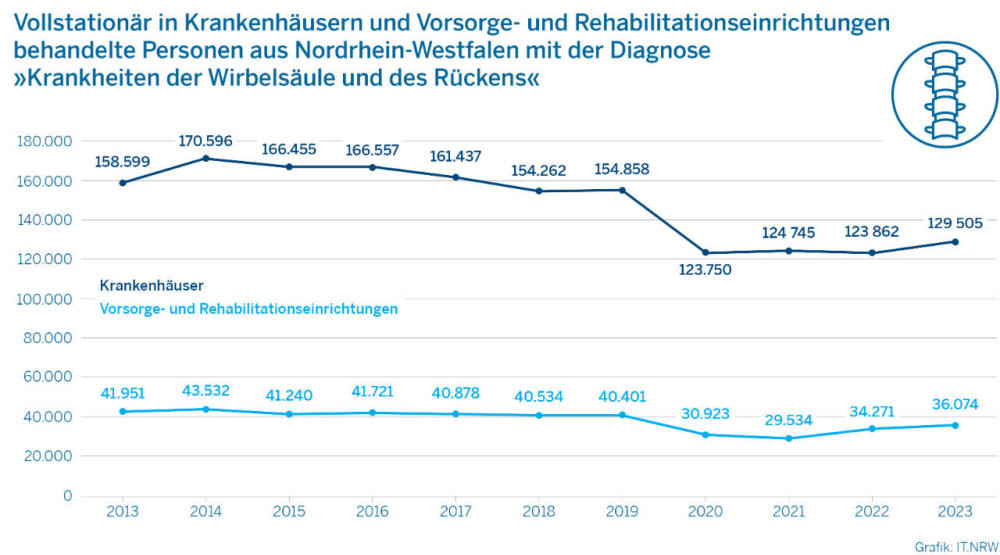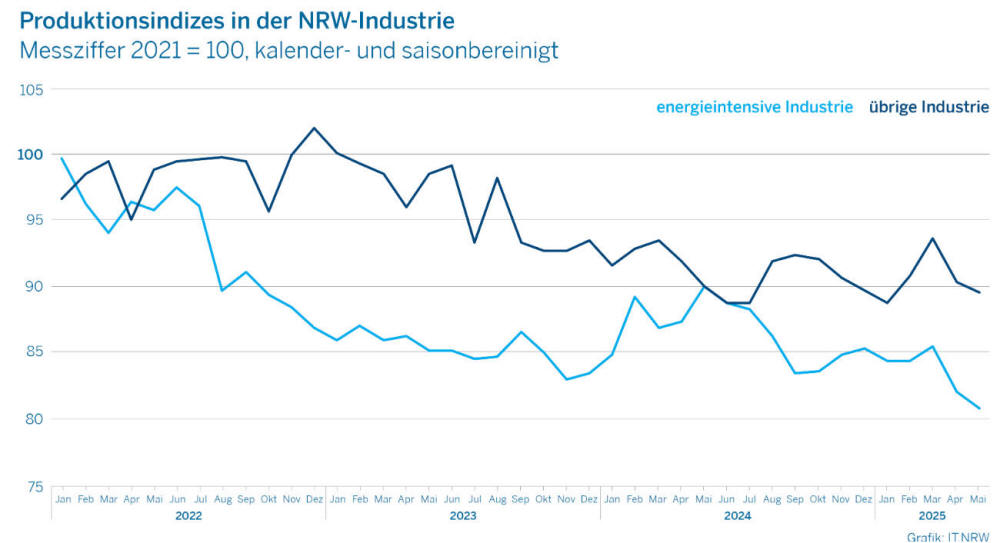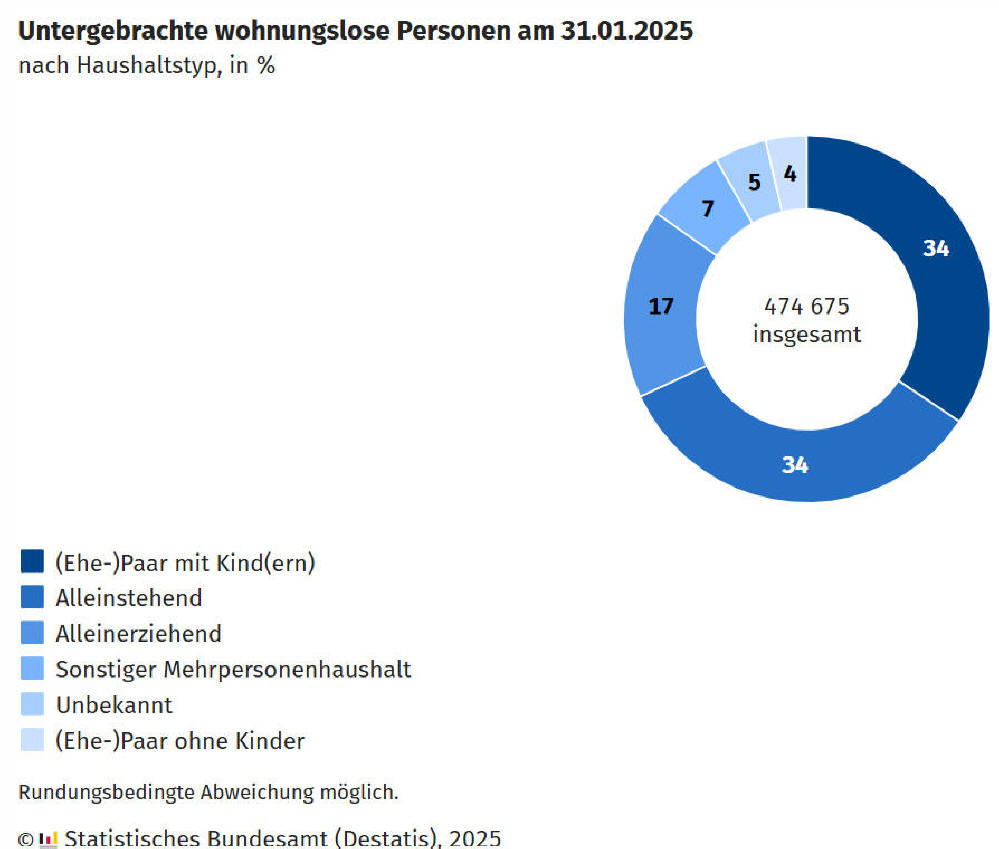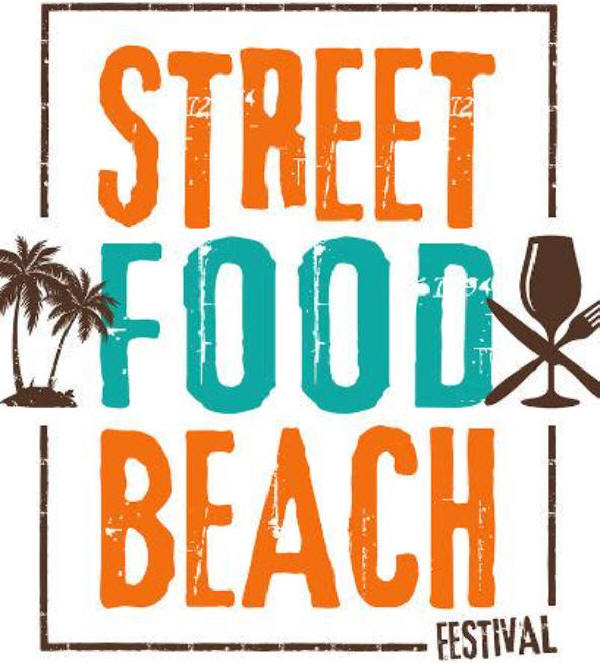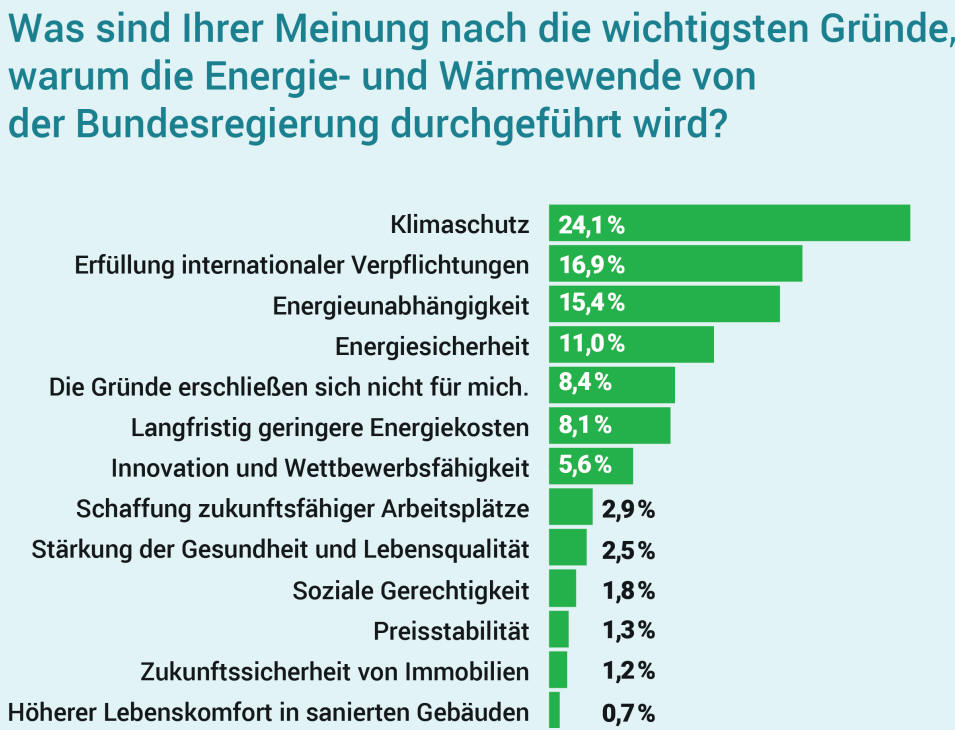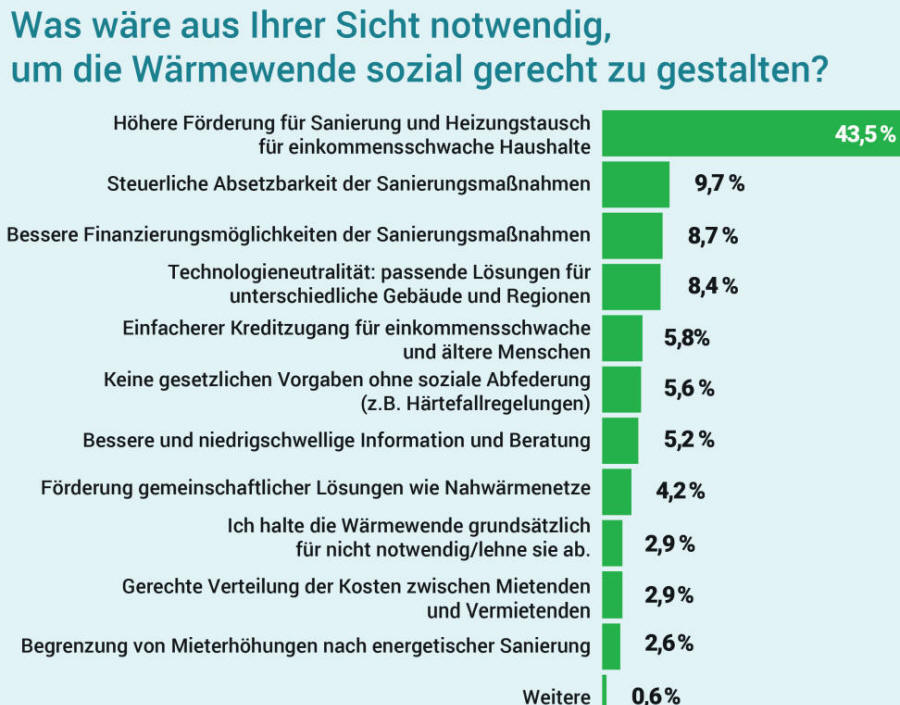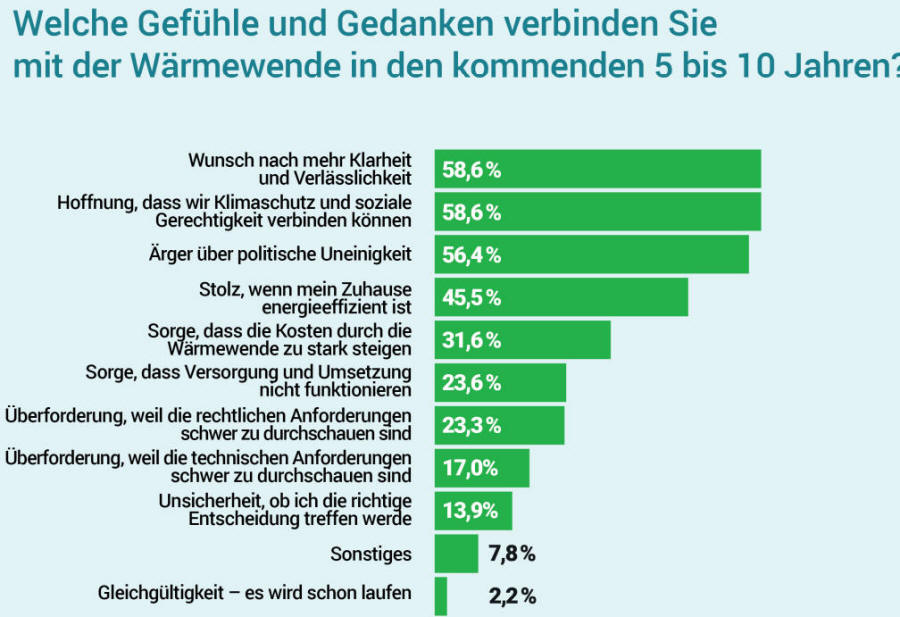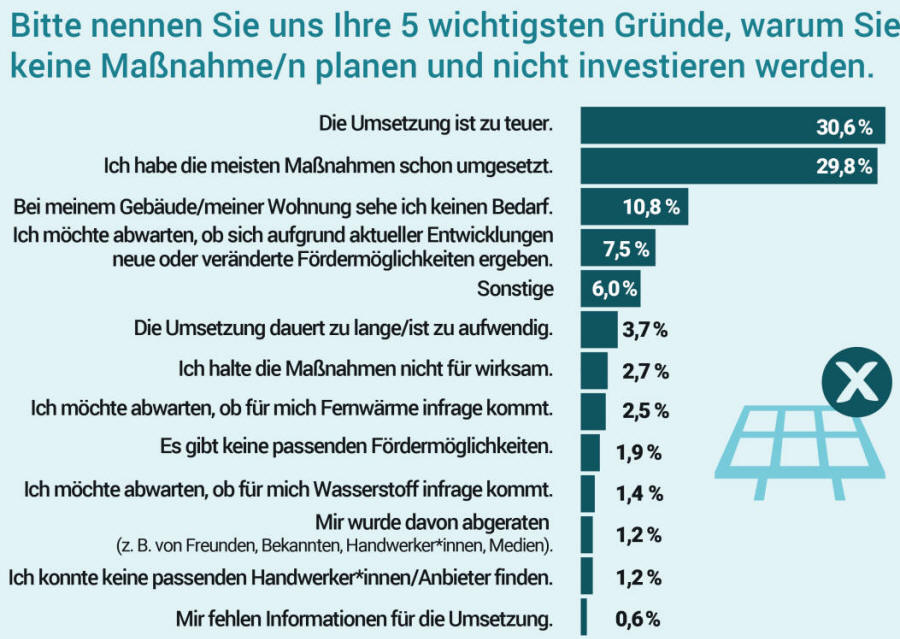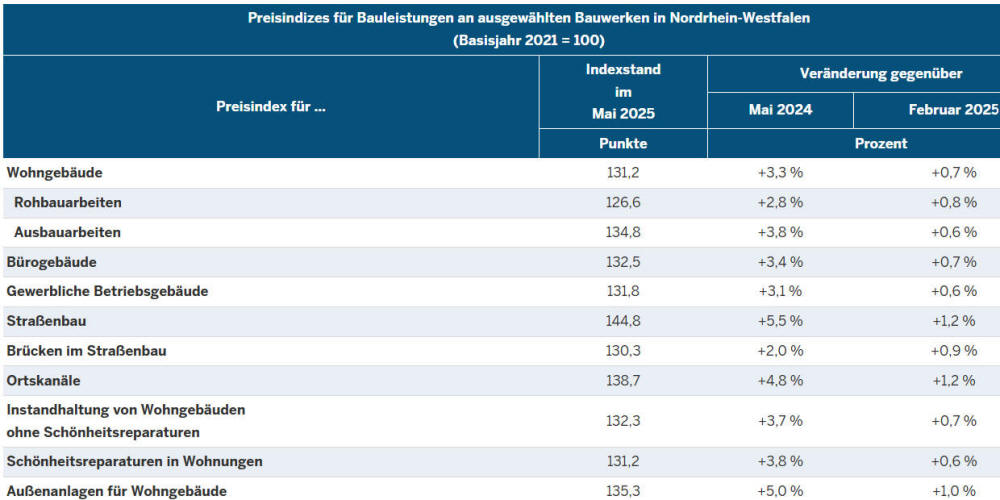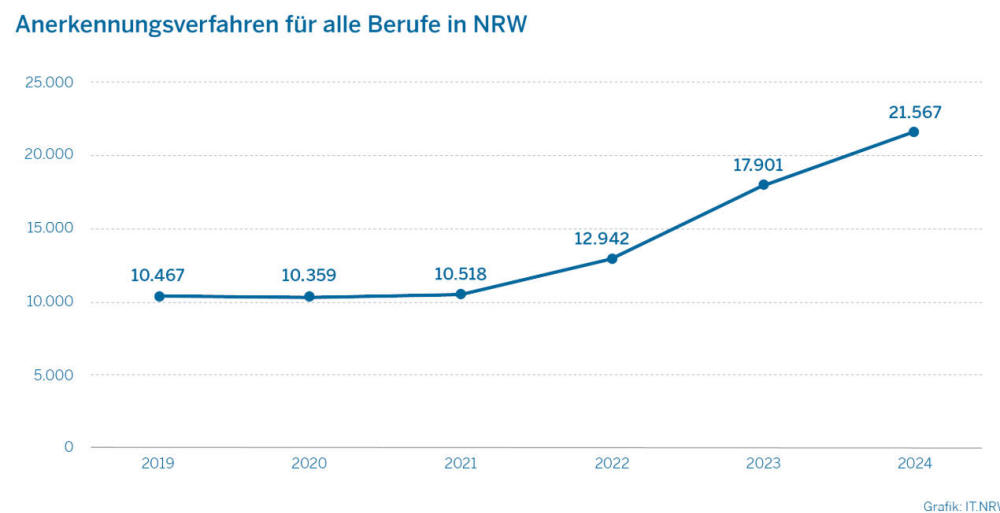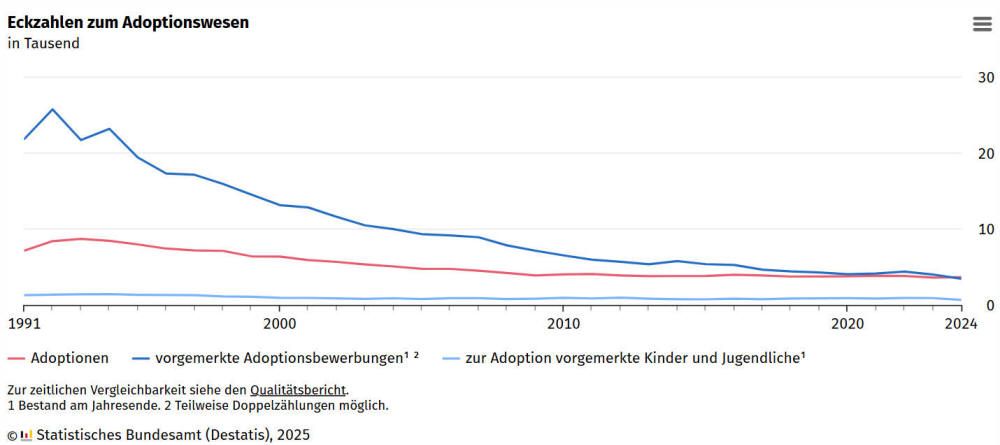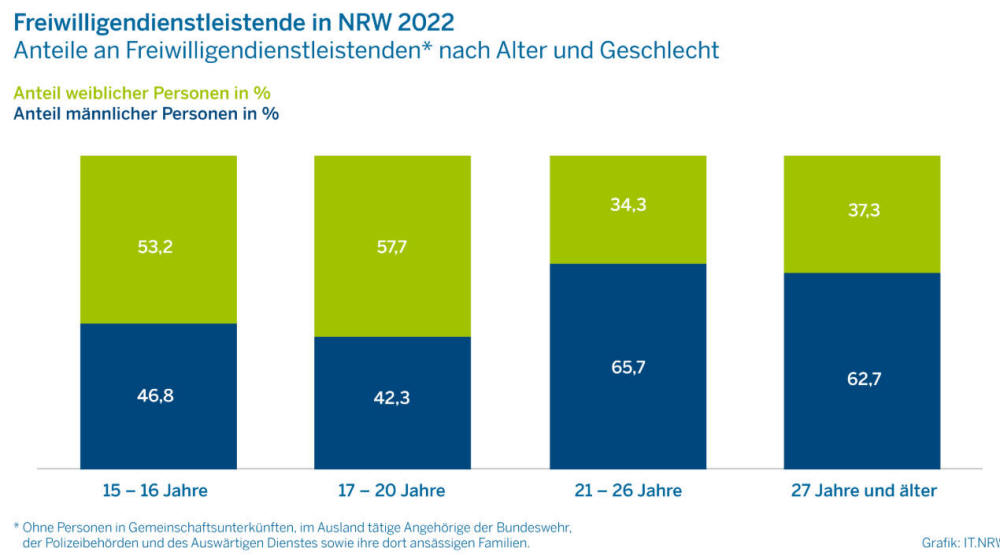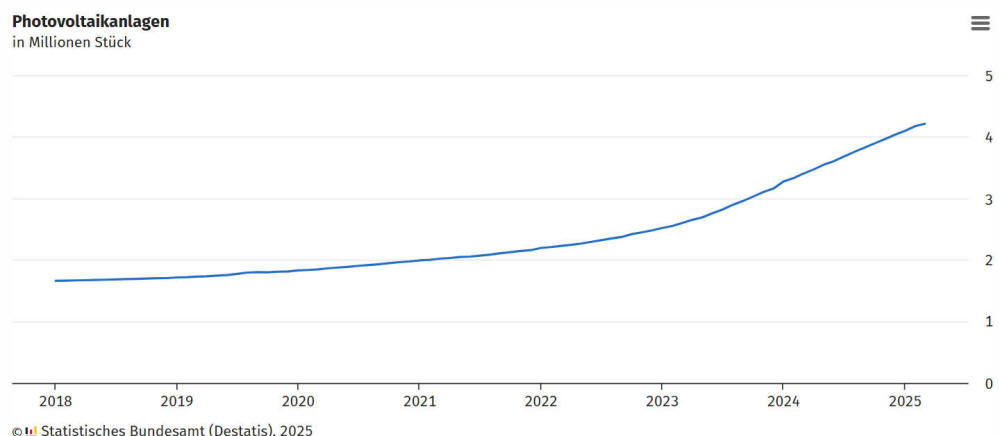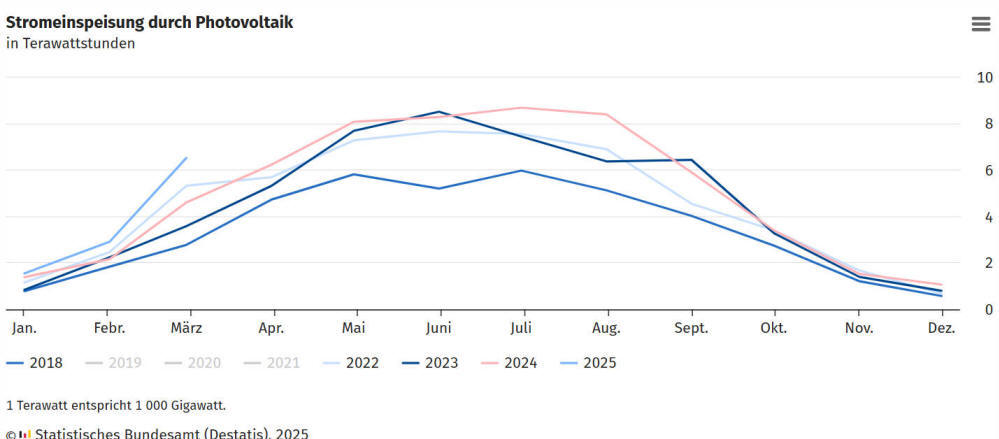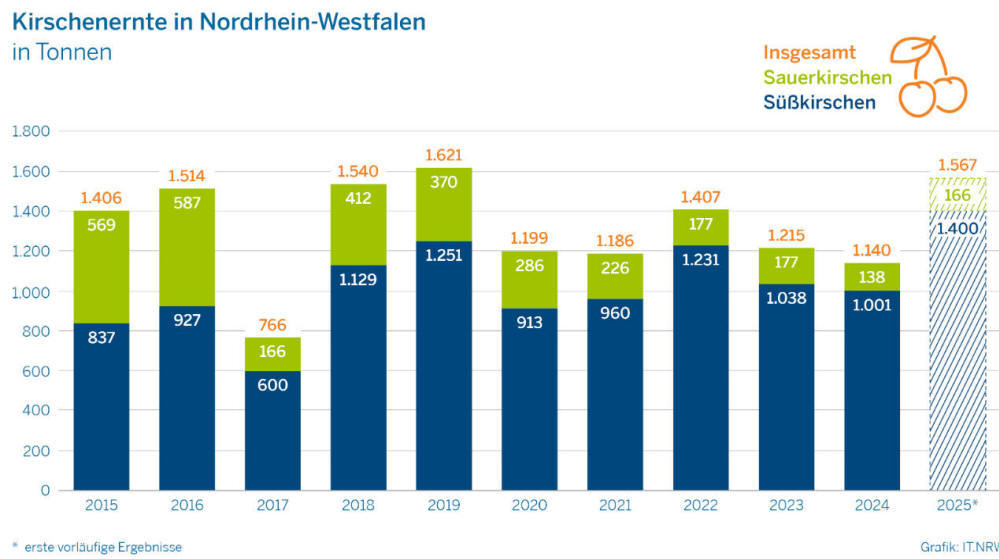|
Samstag, 12., Sonntag, 13. Juii 2025
Bundesrat beschließt
Gesetz zur Umsetzung der RED III und ebnet
schnelleren Genehmigungsverfahren bei
erneuerbaren Energien den Weg
Der Bundesrat hat in
seiner Sitzung am 11.07.25 dem Entwurf für ein
Gesetz zur Umsetzung der Novelle der
Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2023/2413 (RED
III) zugestimmt. Damit wird die Energiewende
beschleunigt, Wirtschaft und Kommunen erhalten
Planungssicherheit und die Belange der Umwelt
bleiben gewahrt.
An dem Gesetzesvorhaben
waren das Bundesumweltministerium (BMUKN), das
Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) und das
Bundesbauministerium (BMWSB) beteiligt. Das neue
Gesetz wird wesentliche Teile der 2023
überarbeiteten Richtlinie (EU) 2018/2001 zur
Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien in
nationales Recht überführen und dafür unter
anderem Änderungen am Immissionsschutzgesetz und
am Wasserhaushaltsgesetz vornehmen.
Damit setzt die Bundesregierung ein Vorhaben aus
dem Koalitionsvertrag um. Ziel ist es, den
Ausbau Erneuerbarer Energien zu erleichtern.
Wichtiges Element ist die Ausweisung von
sogenannten Beschleunigungsgebieten für
Windenergieanlagen an Land einschließlich
zugehöriger Energiespeicher am selben Standort,
die im Baugesetzbuch und Raumordnungsgesetz
geregelt wird.
Damit können Vorhaben
innerhalb dieser Gebiete in einem vereinfachten
und beschleunigten Verfahren nach den neuen
Bestimmungen im Windenergieflächenbedarfsgesetz
genehmigt werden – digital, bürokratiearm und
pragmatisch.
Dadurch wird zugleich eine
Anschlussregelung für Windenergieanlagen an Land
an die EU-Notfall-Verordnung geschaffen, deren
Genehmigungserleichterungen zum 30. Juni 2025
ausgelaufen sind. Von der Richtlinie vorgesehene
Beschleunigungsmaßnahmen für alle
Erneuerbare-Energien-Vorhaben, zum Beispiel
Windenergie, Solarenergie, Geothermie und
Wärmepumpen, auch außerhalb von
Beschleunigungsgebieten, werden durch Änderungen
des Bundesimmissionsschutzgesetzes und des
Wasserhaushaltsgesetzes ebenfalls umgesetzt. Das
Gesetz tritt unmittelbar nach seiner Verkündung
in Kraft.
Moers: Rat beschließt
kurzfristig Rücknahme der Nachtabschaltung
Mit Mehrheit hat der Rat der Stadt
Moers am Mittwoch, 9. Juli, das Ende der
Nachtabschaltung beschlossen. Dies soll Enni zum
nächstmöglichen Zeitpunkt umsetzen. Ausgenommen
sind zum Schutz von Insekten und anderen Tieren
die Parkanlagen. Die Stadt Moers hatte die
Maßnahme seit 2014 als einen Teil der
Haushaltskonsolidierung gestartet.
Mittlerweile hat die Enni die alten Leuchtmittel
zu einem großen Teil durch sparsamere ersetzt.
Hintergrund der Entscheidung bildet ein Antrag
von zwei Fraktionen, die Nachtabschaltung zu
beenden. Terheydenhaus soll Theaterneubau
ergänzen Positiv entschieden hat der Rat auch
die Hinzunahme des Terheydenhauses zum
angedachten Theaterneubau am Weißen Haus mit
erheblichen Fördermitteln.
Damit sind
entspanntere Platzverhältnisse für die
Unterbringung des Schlosstheaters möglich und
das Gebäudeensemble als kulturelles Zentrum
bleibt in städtischer Hand. Mit dem Beschluss
kann die sogenannte Konzeptstudie abgeschlossen
und der Architektenwettbewerb vorbereitet
werden.
In der Sitzung ist zudem der
Beigeordnete Claus Arndt in seine zweite
Amtszeit wiedergewählt worden. Sie beginnt am 1.
Januar 2026. Davor muss noch die offizielle
Ernennung erfolgen. Stadt unterstützt
Nelkensamstagszug mit 21.000 Euro Mit Mehrheit
haben die Mitglieder die zusätzlichen Kosten für
Sicherungsmaßnahmen zur Durchführung des
Nelkensamstagszugs 2026 beschlossen.
Wegen der gestiegenen Sicherheitsanforderungen
des Landes NRW sind die Kosten dafür gestiegen.
Die Stadt Moers unterstützt den Veranstalter
Kulturausschuss Grafschafter Karneval mit 21.000
Euro. Keinen Beschluss, aber einen regen
Austausch gab es zur Information der
Stadtverwaltung zur geplanten Baumaßnahme für
eine Geflüchtetenunterkunft in Schwafheim.
Die Stadt will weiter an dem Bauvorhaben
festhalten, da die bestehenden Unterkünfte
räumlich nicht ausreichen. Der Stream der
Sitzung ist noch bis Mittwoch, 23. Juli, auf dem
Youtube-Kanal der Stadt Moers unter www.youtube.com/stadtmoers zu
sehen.
Gesamtschule Hiesfeld: Bürgermeisterin Eislöffel
überreicht Schlüssel zu neuem Bauteil
Der 9. Juli 2025 war ein bedeutender Tag für die
Stadt Dinslaken und insbesondere für die
Schulgemeinschaft der Gesamtschule Hiesfeld: Mit
der feierlichen Übergabe des neuen sogenannten
Bauteils G auf dem Campus Nord des Schulzentrums
Hiesfeld setzt die Stadt ein deutliches Zeichen
für die Zukunftsfähigkeit ihrer
Bildungsinfrastruktur.

Feierliche Übergabe des Schlüssels an das
Schulzentrum Hiesfeld am 09.Juli 2025 durch
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.
Der
Neubau, der moderne Lernräume für die Jahrgänge
5 und 6 bietet, wurde im Rahmen eines Schulfests
offiziell an die Schulgemeinschaft übergeben.
Die Veranstaltung war geprägt von großer Freude,
Anerkennung und dem gemeinsamen Blick auf die
weitere Entwicklung des Schulstandorts.
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel betonte:
„Hier in Dinslaken investieren wir in gute
Bildung und in die Zukunft unserer Kinder und
Jugendlichen. Schule ist ein Ort des Lernens und
vor allem auch ein Lebensraum, in dem unsere
Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit
verbringen.
Gute Bildung ist die
Grundlage für eine erfolgreiche berufliche
Zukunft. Unsere modernen Schul- und Kita-Gebäude
sind eine wichtige Infrastruktur für die Zukunft
unserer Stadt, wir werben auch um junge Familien
und bieten beste Lern- und Arbeitsbedingungen.
Besonders in Zeiten des Mangels an Lehrkräften
schaffen wir auch gute Arbeitsbedingungen.
Mit der heutigen Übergabe und dem
Ratsbeschluss zur Fortsetzung der Maßnahmen
setzen wir ein klares Signal: Wir schaffen
Räume, in denen erfolgreiches Lernen Freude
macht, Vielfalt gelebt wird und Gemeinschaft
entsteht. Das ist eine Investition in die
Zukunft von Kindern und Jugendlichen und somit
auch in die Zukunft unserer Stadt“, so
Bürgermeisterin Eislöffel.
Der Bauteil G
ist der erste fertiggestellte Bauabschnitt im
Rahmen der umfassenden Umstrukturierung des
Schulzentrums Hiesfeld. Die räumliche Trennung
der beiden Schulformen des Gymnasiums im Süden
und der Gesamtschule im Norden schafft nicht nur
klare Strukturen, sondern ermöglicht auch eine
stärkere pädagogische Fokussierung.
Die neue
zweigeschossige Anlage mit einer
Bruttogrundfläche von knapp 2.000 Quadratmetern
beherbergt zehn helle Klassenräume, vier
Differenzierungsräume sowie offene Lernzonen,
die besonders für inklusives und kooperatives
Lernen ausgelegt sind. Ein barrierefreier Zugang
und ein neu gestalteter Haupteingang verleihen
der Gesamtschule ein modernes und einladendes
Gesicht.
Die Fertigstellung des Gebäudes
ist ein sichtbares Ergebnis jahrelanger Planung,
intensiver Abstimmung und engagierter
Bauausführung. Seit dem Start der
Konzeptentwicklung im Mai 2019 hat die
städtische ProZent GmbH das Projekt federführend
begleitet, von der ersten Idee über die Planung
bis hin zur Umsetzung und Steuerung.
Die
Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2023 und
konnten pünktlich zum Schuljahrwechsel 2025/2026
abgeschlossen werden. Dabei wurde nicht nur die
termingerechte Fertigstellung erreicht, sondern
auch das Budget unterschritten. Ein Erfolg, der
auf die hervorragende Zusammenarbeit aller
Beteiligten zurückzuführen ist.
Mario
Balgar, Geschäftsführer der ProZent GmbH, hob
die partnerschaftliche Zusammenarbeit hervor:
„Wir sind stolz, dass wir mit dem Bauteil G
einen wichtigen Meilenstein für die neue
Gesamtschule Hiesfeld realisieren konnten, und
das voraussichtlich sogar unter dem genehmigten
Budget. Dieses Ergebnis ist nur durch das
engagierte Zusammenspiel aller Akteure möglich
geworden. Die enge Abstimmung mit der Stadt, den
Schulen und den Fachplanern hat dazu
beigetragen, dass wir ein Gebäude geschaffen
haben, das modernen pädagogischen Ansprüchen
gerecht wird und Lust auf Lernen macht.“
Schuldezernentin Dr. Tagrid Yousef: „Mit dem
heutigen Tag wird die Schul- und
Bildungslandschaft in Dinslaken gestärkt. Schule
bereitet nicht nur auf das Berufsleben vor,
sondern fördert die ganzheitliche Entwicklung
verantwortungsbewusster und engagierter junger
Menschen.“
Auch Daniela Gottwald,
Leiterin der Gesamtschule Hiesfeld, zeigte sich
begeistert: „Der Neubau ist ein großer Gewinn
für unsere Schulgemeinschaft. Die neuen Räume
bieten beste Voraussetzungen für zeitgemäßen
Unterricht und ein vielfältiges Schulleben. Wir
danken der Stadt Dinslaken, der ProZent GmbH und
allen Beteiligten für die Unterstützung und das
große Engagement. Unsere Schülerinnen und
Schüler haben die Bauphase mit viel Geduld
begleitet, jetzt freuen wir uns darauf,
gemeinsam diesen neuen Lern- und Lebensraum mit
Leben zu füllen.“
Mit der Fertigstellung
des Bauteils G und der Beschlussfassung zur
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen am Campus
Nord ist die Stadt Dinslaken auf einem sehr
guten Weg, die Gesamtschule Hiesfeld als
modernen, leistungsfähigen und inklusiven
Bildungsstandort weiterzuentwickeln. Die
Maßnahmen stärken die Identität der Schule,
schaffen optimale Lernbedingungen und tragen
dazu bei, dass Dinslaken auch künftig eine Stadt
ist, in der Bildung höchste Priorität hat.
Bürgermeisterin Eislöffel würdigte zudem die
Geduld und das Engagement aller Beteiligten
während der Bauphase, von den Schülerinnen und
Schülern über das Kollegium bis hin zu den
Eltern und Nachbarn. „Sie alle haben
mitgeholfen, dass dieses Projekt ein Erfolg
wird. Dafür danke ich Ihnen von Herzen.“
Moers: Ein Platz mit Potenzial: Stadt
lädt zur Beteiligung am Saarplatz ein
Ein Quartiersplatz mit Potenzial, umgeben
von lebendigen Straßenzügen – der Saarplatz in
Meerbeck bietet viele Möglichkeiten für eine
neue Aufenthaltsqualität. Damit das Areal
einladender werden kann, plant die Stadt Moers
eine umfassende Neugestaltung. Auch die
Gehwegbereiche der angrenzenden
Straßenabschnitte wie die Zwickauer Straße,
Jahnstraße, Moselstraße, Blücherstraße und
Leissstraße sollen im Zuge eines Förderantrags
aufgewertet werden. Dafür sollen die
Perspektiven der Menschen vor Ort einbezogen
werden.
Zwei Infostände bieten
Gelegenheit zur Beteiligung: am Dienstag, 15.
Juli, und Montag, 4. August, jeweils von 15.30
bis 18 Uhr vor der Sparkasse Meerbeck (Ecke
Zwickauer Straße / Moselstraße). Dort können
sich Anwohnende und Gewerbetreibende
informieren, Rückmeldungen geben und eigene
Ideen einbringen. Ziel ist es, gemeinsam ein
sauberes, sicheres und lebenswertes Umfeld zu
gestalten – mit mehr Aufenthaltsqualität und
neuen Nutzungsmöglichkeiten.
Weitere
Informationen gibt es beim Fachdienst Freiraum-
und Umweltplanung der Stadt Moers unter planung.gruen@moers.de oder
telefonisch unter 0 28 41 / 201-215.
Moers: Neuer Turm im Freizeitpark steht
Rutschvergnügen ‚reloaded‘: Der
neue Rutschenturm auf dem Spielplatz im
Freizeitpark ist fertig! Wo bis vor Kurzem noch
ein Bauzaun den Zugang versperrte, steht nun ein
moderner Turm – bereit für kleine Kletterer und
rasante Rutschpartien.

Fotos: pst
Die große
Kletter-Rutsch-Kombination hat damit wieder ein
vollständiges Gesicht. Der alte Turm war in die
Jahre gekommen und musste aus Sicherheitsgründen
gesperrt werden. Jetzt ersetzt ihn ein neues,
robustes Element, das nicht nur sicher, sondern
auch ein echter Hingucker ist.
Wesel: Aufhebung des
Aufstellungsbeschlusses vom 19.09.2017, erneuter
Aufstellungsbeschluss,
Veröffentlichung im Internet sowie öffentliche
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr.
155 "An der Bocholter Bahn" der Stadt Wesel
Inhalt der Bekanntmachung der Stadt Wesel vom
10.07.2025
Die Öffentliche Bekanntmachung ist
im Amtsblatt der Stadt Wesel unter
https://abi.wesel.de abrufbar.
Aufhebung
des Aufstellungsbeschlusses vom 19.09.2017 und
erneuter Aufstellungsbeschluss, Veröffentlichung
im Internet sowie öffentliche Auslegung des
Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 155 "An der
Bocholter Bahn" der Stadt Wesel für nachstehend
abgebildeten Geltungsbereich im Ortsteil
Wesel-Feldmark:

Abbildung des räumlichen Geltungsbereiches von
Bebauungsplan Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"
Der Rat der Stadt Wesel beschloss in seiner
Sitzung am 20.05.2025 die Aufhebung des
Aufstellungsbeschlusses vom 19.09.2017 sowie die
erneute Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 155
“An der Bocholter Bahn“ der Stadt Wesel.
Der Rat der Stadt Wesel billigte in seiner
Sitzung am 08.07.2025 den Entwurf des
Bebauungsplans Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"
der Stadt Wesel und beschloss die
Veröffentlichung im Internet sowie die
öffentliche Auslegung.
Gemäß § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) wird der
Planentwurf mit Entwurfsbegründung und
Umweltbericht sowie mit den wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung in der Zeit
vom
14.07.2025 bis einschließlich 18.08.2025
im
Internet unter www.wesel.de/buergerbeteiligung
veröffentlicht.
Zusätzlich zur
Veröffentlichung im Internet erfolgt eine
öffentliche Auslegung der genannten Unterlagen
im Rathaus (Erweiterung) der Stadt Wesel,
Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel, auf dem Flur
vor den Zimmern 332 bis 334, montags bis
freitags während der allgemeinen Dienststunden
der Stadtverwaltung.
Planungsziel ist
der Lückenschluss der neuen Planstraße, die am
Kreuzungspunkt Emmericher Straße / Holzweg /
Julius-Leber-Straße beginnt und am
Kreuzungspunkt Hamminkelner Landstraße /
Friedrich-Geselschap-Straße / Zufahrt
Berufskolleg Wesel endet. Zudem wird eine Park &
Ride Anlage geplant. Südlich der Planstraße soll
das vorhandene Mischgebiet (MI) erweitert
werden. Im Nördlichen Bereich entlang der
Bocholter Bahn wird eine Versickerungs- und
MSPE-Fläche geplant.
Mit dem Planentwurf
des Bebauungsplans Nr. 155 "An der Bocholter
Bahn" (Blatt A und B) liegen folgende
Informationen aus:
Übersichtsplan
Geltungsbereich
Sonstiger Geltungsbereich für
externen Ausgleich
Textliche Festsetzungen
Derzeitiges Planungsrecht
Darstellung 38.
Änderung Flächennutzungsplan
Begründung Teil
A – Städtebaulicher Teil
Begründung Teil B –
Umweltbericht
Umweltbezogene Stellungnahmen
der frühzeitigen Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung
Abwägung samt
Anregungen (Stellungnahme der Verwaltung) aus
der Sitzung des Rates vom 08.07.2025
Stadt
Wesel, Artenschutzprüfung Bebauungsplan Nr.155,
Stand: 06.06.2025
Stadt Wesel, Umweltprüfung/
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Bebauungsplan Nr.155, Stand: 17.06.2025
Ingenieurgesellschaft H2P mbH, “Planung der
Entwässerungseinrichtungen Bebauungsplan Nr. 155
An der Bocholter Bahn in Wesel“, Stand:
05.06.2025, inklusive Erläuterungsbericht zu den
versickerungstechnischen Untersuchungen
geologie:büro Stand 2015
DB Netz AG,
Erläuterungsbericht ABS 46/2 Grenze D/NL –
Emmerich – Oberhausen, Stand: 08.03.2021
Peutz Consult GmbH, „Schalltechnische
Untersuchung für das Bebauungsplanverfahren Nr.
155 "An der Bocholter Bahn" der Hansestadt
Wesel“, Stand: 16.06.2025
Ingenieurgruppe IVV
GmbH & Co. KG, Verkehrsuntersuchung zum
Bebauungsplan Nr. 154 „Am Hessenweg“ in Wesel –
hier: Leistungsfähigkeitsuntersuchung des
Knotenpunktes L7 / Holzweg / Julius
Leber-Straße, Stand: März 2018
Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG, Ergänzung zur
Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 154
"Am Hessenweg" in Wesel – hier:
Leistungsfähigkeitsuntersuchung des
Knotenpunktes L 7 / Holzweg /
Julius-Leber-Straße, Stand: Juli 2018
Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG, Stellungnahme
per Mail vom 02.05.2025
GMA,
Einzelhandelskonzept für die Hansestadt Wesel
2020, Juli 2020
Information zum Datenschutz
in der Bauleitplanung
Verteilerliste.
Nachfolgend genannte umweltbezogene
Informationen sind verfügbar:
Umweltinformationen
Begründung Teil A –
Städtebaulicher Teil, Stadt Wesel
Neben den
städtebaulichen Aspekten wurden die Belange
bezüglich der Behandlung des
Niederschlagswassers, geplanter Grünflächen und
Anpflanzungen, Ausgleichsmaßnahmen,
artenschutzrechtlicher Belange, Möglichkeiten
zur Nutzung der Solarenergie, des
Schallschutzes, der Altlasten in Form von
Kampfmitteln, des Klimaschutzes, der
archäologischen Befundsituation im Plangebiet
und des Schutzguts Boden bewertet.
Betrachtet wurde weiterhin die Beurteilung des
Eingriffs in Natur und Landschaft sowie die
Beurteilung des Eingriffs zum Vorrang der
Innenentwicklung.
Begründung Teil B –
Umweltbericht, Stadt Wesel
Der Umweltbericht
bildet einen gesonderten Teil der Begründung.
Gegenstand der Umweltprüfung als Grundlage des
Umweltberichts ist die Bestandsbeschreibung und
-bewertung sowie die Ermittlung und Beschreibung
der möglichen Auswirkungen der Planung auf die
Schutzgüter und deren Wechselwirkungen. Im
Einzelnen:
Schutzgut „Mensch, Gesundheit und
Bevölkerung“
Untersuchung des Plangebiets
in Bezug auf zeitweise Staub-, Lärm- und
Geruchsentwicklungen aufgrund der Bautätigkeiten
im Geltungsbereich.
Betrachtung des
Plangebiets bezüglich der Auswirkungen einer
Bebauung auf das Kleinklima.
Untersuchung des
Wohn- und Wohnumfeldpotenzials sowie der Eignung
des Plangebiets für Erholungszwecke.
Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt“
Bewertung der Bedeutung der im
Plangebiet vorhandenen Biotoptypen für den
Biotop- und Artenschutz.
Ermittlung der
vorhandenen Biotoptypen sowie des notwendigen
ökologischen Ausgleichs. Erfassung und Bewertung
des Vorkommens planungsrelevanten Pflanzen- und
Tierarten, insbesondere Brutvögeln sowie
Fledermäusen im Plangebiet
Schutzgut
„Boden/Fläche“.
Untersuchung der
Bestandssituation des Plangebietes und der
Auswirkungen der Planung in Bezug auf die
Funktionen des Bodens, Bodentypen, schutzwürdige
Böden sowie Altlasten.
Ermittlung des
notwendigen bodenschutzrechtlichen Ausgleichs
Schutzgut „Wasser“
Es wird die
Fließrichtung des Grundwassers, die
Wasserbelastung, die Auswirkungen auf die
Grundwasserneubildung, sowie die Versickerung
thematisiert.
Schutzgut „Klima/Luft“
Beschreibung des Plangebietes im Hinblick auf
den zugehörigen Klimabereich, die
Niederschlagsmenge und die Durchlüftung.
Untersuchung des Plangebietes im Hinblick auf
die Auswirkungen der Versiegelungen von
Grünflächen auf das Klima.
Bewertung des
Plangebietes anhand der Kriterien thermische
Belastung tags / nachts sowie Kaltluftaustausch.
Schutzgut „Landschaft“
Beschreibung und
Bewertung des geplanten Eingriffs im Plangebiet
in Bezug auf das Landschaftsbild anhand der im
und um das Plangebiet vorhandenen
Landschaftsbildeinheiten. Untersuchung des
Plangebietes in Bezug auf vorkommende
Naturdenkmäler.
Beschreibung der
anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut.
Schutzgut „Kulturelles Erbe und sonstige
Sachgüter“
Untersuchung des Plangebietes
in Bezug auf die Bestandssituation sowie Bau-
und Bodendenkmäler im Sinne des
Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen.
Externe Ausgleichsmaßnahmen
Der durch den
Bebauungsplan ermöglichte Eingriff kann nicht
vollständig innerhalb des Plangebiets
ausgeglichen werden, daher ist eine externe
Kompensation in Höhe von 18.065 ökologischen
Werteinheiten (ÖWE) erforderlich. Dieses
Kompensationserfordernis wird auf den Flächen
des Ökokontos der Stadt Wesel unter der
Bezeichnung WSO-Ö-03 „In der Luft“ (Gemarkung
Obrighoven, Flur 10, Flurstück 1458) erbracht.
Darüber hinaus ist ein
bodenschutzrechtlicher Ausgleich für den
Eingriff in einen schutzwürdigen Boden des Typs
Plaggenesch notwendig. Dieser Ausgleich wird auf
den Flächen des Ökokontos der Stadt Wesel unter
der Bezeichnung WSO-Ö-03 „In der Luft“
(Gemarkung Obrighoven, Flur 10, Flurstück 1458)
erbracht.
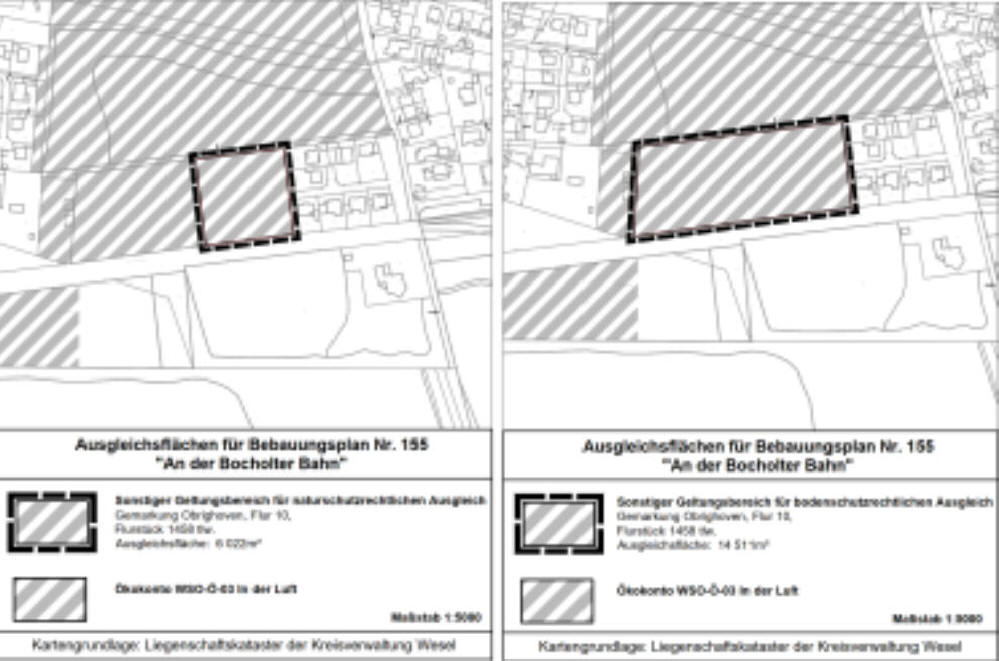
Die Warn-App NINA wird zehn Jahre alt
Über 12 Millionen Menschen nutzen die App des
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK). Jetzt erhält sie ein
umfangreiches Update mit vielen Neuerungen.
Unteranderem wird es einen neuen Themenbereich
„Polizeitipps“ geben.

(Quelle: BBK)
Die Warn-App NINA des
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK) ist im
Bevölkerungsschutz die App mit den meisten
Nutzerinnen und Nutzern: Über 12 Millionen
Menschen nutzen die Warn-App NINA bereits, um
sich zu informieren und passgenaue Warnmeldungen
direkt auf dem Smartphone zu erhalten. In diesem
Sommer wird die Warn-App NINA zehn Jahre alt. In
diesen zehn Jahren wurde sie kontinuierlich
verbessert und weiterentwickelt. Jetzt ist ein
umfangreiches Update gestartet, das bis zum Ende
der Woche ausgerollt sein soll.
Diese
Neuerungen werden die Nutzerinnen und Nutzer in
der Warn-App NINA sehen:
• Die deutschen
Polizeibehörden haben in den vergangenen Jahren
bereits vereinzelt das Bundeswarnsystem und die
Warn-App NINA für besondere polizeiliche Lagen
genutzt. Dies wird nun in einem eigenen
Warn-Bereich ausgebaut, was auch durch ein
eigenes Icon in der Warn-App NINA sichtbar wird.
Damit werden die Warnmeldungen der
Polizeibehörden von Bund und Ländern
gekennzeichnet. Nutzerinnen und Nutzer erhalten
so alle für ihre Sicherheit relevanten
Warnmeldungen aus einer Hand.
• Die App
erhält den neuen Bereich „Themen“. Darunter
werden die bekannten „Notfalltipps“ des BBK zu
finden sein sowie ein neu eingerichteter
Themenbereich „Polizeitipps“. Er enthält
umfassende Informationen zur polizeilichen
Kriminalprävention, etwa über
Kriminalitätsphänomene, Hinweise für Opfer von
Straftaten und praktische Tipps für mehr
Sicherheit im Alltag. Diese Informationen werden
vom Programm Polizeiliche Kriminalprävention der
Länder und des Bundes (ProPK) zur Verfügung
gestellt und werden kontinuierlich gepflegt und
aktualisiert.
Zusätzlich sind die
Funktionalitäten und die Technik im Hintergrund
so optimiert worden, dass die Datenmengen, die
zur zeitgerechten und zielgenauen Zustellung von
Push-Nachrichten nötig sind, verringert werden
können. Das steigert noch einmal die
Zuverlässigkeit der Übertragung in Situationen,
in denen besonders viele Warnmeldungen
verschickt werden müssen.
BBK-Präsident
Ralph Tiesler sagt zum Jubiläum und den
Neuerungen: „Unsere Warn-App NINA hat sich
etabliert und ist täglich erfolgreich und
zuverlässig im Einsatz, um Menschen vor Gefahren
zu warnen. Mit dem aktuellen Update wird unsere
Notfall-Informations- und Nachrichten-App, denn
dafür steht NINA, ihrem Zweck als umfassende
Begleiterin in Gefahrensituationen noch besser
gerecht. Die Nutzerinnen und Nutzer werden
behördenübergreifend vor Gefahren vom Hochwasser
über Unwetter und gefährliche Brände bis hin zu
besonderen polizeilichen Lagen gewarnt.
Gleichzeitig können sich die Menschen im
Vorsorgebereich über die eigene Krisenvorsorge
oder Handlungsempfehlungen in gefährlichen
Situationen informieren. Wir werden die Warn-App
NINA auch in Zukunft weiter verbessern. Und das
gemeinsam mit der Bevölkerung: Viele Anpassungen
der letzten Jahre gingen auf das Feedback von
Nutzerinnen und Nutzern zurück.“
Die
Neuerungen rund um die Warn-App NINA werden am
Samstag, 12. Juli, auf dem Bevölkerungsschutztag
in Rostock vorgestellt. Besucherinnen und
Besucher können sich am Stand des BBK umfassend
informieren und erhalten auch Hilfe bei den
Einstellungen der App.
Die Warn-App NINA
des BBK ist kostenlos in den gängigen App-Stores
erhältlich. Den Download und viele weitere
Informationen zu Einstellungen und Funktionen
gibt es hier: https://www.bbk.bund.de/nina
Risiken durch Smartphone und Kopfhörer -
Ohren auf im Straßenverkehr!
Musikhören kann die Sicherheit beeinträchtigen
Unfallforscher: Wichtige Warnsignale können
überhört werden
Im Ausland teils
Kopfhörerverbot für Radfahrer
Zu oft sind
Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr
abgelenkt, weil sie Kopfhörer oder Ohrstöpsel
tragen und Musik hören. „Ihnen ist offenbar
nicht bewusst, dass sie sich damit in Gefahr
bringen“, sagt DEKRA-Unfallforscher Denis
Preissner. „Laute Musik oder Noise Cancelling
verlängern die Reaktionszeit und erhöhen das
Unfallrisiko.“

Anfang Mai 2025 wurde bei München ein 23jähriger
Mann von einer S-Bahn erfasst und tödlich
verletzt. Er hatte Kopfhörer auf und vermutlich
überhörte er den Zug. Tragisch, aber kein
Einzelfall: Viele Menschen tragen Kopf- oder
Ohrhörer, wenn sie durch die Straßen gehen,
Radfahren oder auf dem E-Scooter durch die Stadt
flitzen. Klar, unterwegs Musik oder einen
Podcast zu hören, macht Spaß und vertreibt die
Zeit.
Es gibt aber viele Gründe, warum
man im Straßenverkehr darauf verzichten sollte.
Der Wichtigste: Laute Musik übertönt die
Umgebungsgeräusche. Wenn die Bässe wummern, sind
das hupende Auto oder die klingelnde Straßenbahn
schlicht nicht mehr zu hören. Von den fünf
Sinnen sind im Straßenverkehr Hören und Sehen
die wichtigsten. Wer einen ausblendet, steigert
das Unfallrisiko.
Ein Beispiel: Ein
Fußgänger will die Straße überqueren. Ein Blick
nach rechts und links, kein Auto in Sicht und er
geht los. Doch den Radfahrer, der plötzlich laut
rufend und wild klingelnd hinter ihm um die Ecke
kommt, sieht er nicht. Ohne Kopfhörer würde er
ihn aber wenigstens hören und könnte noch
schnell zur Seite springen.
Da mehr
Menschen das Rad nutzen und weil die Zahl der
E-Autos ständig wächst, wird zudem der Verkehr
in den Städten tendenziell leiser. Das erhöht
zwar die Lebensqualität. Gerade in
verkehrsberuhigten Bereichen besteht aber die
Gefahr, dass Passanten die Rad- und
Scooterfahrer oder E-Autos überhören.
Problematisch ist auch, unterwegs mit Stecker im
Ohr zu telefonieren. Dann wird die Umwelt nur
noch eingeschränkt wahrgenommen. Selbst wenn das
Ohr die Warnsignale hört, verarbeitet das Gehirn
sie nicht oder zu langsam. Sogar leise Musik
lenkt ab. In einem Test des Instituts für Arbeit
und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung reagierten Musik hörende
Probanden auf Martinshorn oder Hupen um 50
Prozent langsamer.
Besonders gefährlich
sind übrigens Kopfhörer mit
Noise-Cancelling-Funktion. Sie blenden störende
Geräusche mithilfe von Gegenschall aus. Das ist
hilfreich, um sich zu konzentrieren oder
abzuschalten. Doch die Technik funktioniert
schon bei geringer Lautstärke. Wer also meint,
damit leise Musik hören und trotzdem schnell auf
Gefahren reagieren zu können, irrt. Wenn
überhaupt, sollte man Kopf- oder Ohrhörer mit
Transparenzmodus oder
Umgebungsgeräuschverstärkung verwenden. Oder
eben den Noise-Cancelling-Modus abschalten.
Aufmerksamkeit ist nicht ersetzbar
„Keine
technische Hilfe kann aber die Aufmerksamkeit
ersetzen“, sagt DEKRA Unfallforscher Preissner.
Der Experte empfiehlt: „Der sicherste Weg
bleibt: Smartphone weg, Kopfhörer raus –
zumindest im Straßenverkehr.“ Wer nicht darauf
verzichten möchte, sollte beim Musikhören nur
einen Ohrstöpsel nutzen und die Lautstärke
herunterdrehen. So bleibt das Gehör offen fürs
hupende Auto, die klingelnde Straßenbahn oder
den Warnruf des Radfahrers.
Rechtlich
spricht zwar nichts explizit dagegen, im
Straßenverkehr Kopfhörer oder Ohrstöpsel zu
tragen. Allerdings stellt Paragraph 23 der
Straßenverkehrsordnung unmissverständlich fest:
Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür
verantwortlich, dass sein Gehör nicht
beeinträchtigt wird. Wenn also die Bässe
dermaßen pumpen, dass man das Martinshorn der
Feuerwehr oder die klingelnde Straßenbahn nicht
hört, muss man die Lautstärke herunterdrehen.
Ähnliche Regelungen wie in Deutschland gibt
es in Österreich und in der Schweiz. Die Polizei
in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich
oder Spanien, geht sehr viel rigoroser vor, wenn
sie Auto-, Rad- oder E-Scooter-Fahrer mit Knopf
im Ohr erwischt.
Auto richtig packen
und relaxed in den Urlaub starten
-
Auch kleine Gegenstände sicher verstauen
-
Mit Dachbox unterwegs: Fahrverhalten anpassen
Bevor der Traumurlaub beginnen kann, muss
gepackt werden. Bei der Frage, was die Familie
im Urlaub unbedingt braucht, scheiden sich oft
die Geister. Aber egal, welche Dinge im Auto
landen, um sicher anzukommen, gilt es beim
Verstauen des Gepäcks ein paar Dinge zu
beherzigen.
Schwere und sperrige
Gegenstände gehören immer in den Kofferraum: Am
besten gelagert werden sie vor oder direkt auf
der Hinterachse. In Kombis und SUVs dürfen
Gepäckstücke nicht über die Höhe der Rückbank
hinaus gestapelt werden. Nur mit einem
Trenngitter oder Trennnetz im Auto ist höheres
Beladen kein Problem.

Geregelt ist die Ladungssicherheit, wie die
HUK-COBURG mitteilt, in der
Straßenverkehrsordnung (StVO §22). Hier heißt
es, „die Ladung (…) ist so zu verstauen und zu
sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder
plötzlichen Ausweichbewegungen nicht
verrutschen, umfallen, hin und her rollen“ kann.
Das betrifft nicht nur große Gepäckstücke, auch
lose Kleinigkeiten – zum Beispiel Handtaschen
oder Handys – können sich bei Vollbremsungen auf
der Autobahn in Wurfgeschosse verwandeln, die
die Insassen verletzen. Darum lagern selbst
Kleinteile am besten im Handschuh- oder
Seitentürfach.
Vielen Urlaubern genügt
der Stauraum ihres Pkw nicht. Sie montieren
deshalb zusätzlich eine Box auf ihr Autodach.
Hier sollte man die zulässige Dachlast ebenso
wie die Höchstgeschwindigkeit im Blick haben. In
der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs lässt sich
ablesen, wie schwer der zusätzliche Dachkoffer
nach dem Beladen sein darf bzw. welche
Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist. Unabhängig
davon hat nicht jede Dachbox dasselbe Volumen:
Wieviel maximal hineinpasst, steht in der
boxeigenen Betriebsanleitung.
Gewicht ist
auch an anderer Stelle ein Thema: Oft wird das
eigene Rad mit in den Urlaub genommen. Die
meisten Urlauber transportieren es auf einer
Anhängerkupplung, auf der ein zusätzlicher
Träger befestigt wird. Entscheidend ist hier
neben der zulässigen Trägerlast auch die
Stützlast der Anhängerkupplung. Über beides
informiert wieder die zu jedem Einzelteil
gehörende Betriebserlaubnis. Darin steht
ebenfalls, wie schnell man fahren darf, wenn man
seine Räder Huckepack nimmt.

NRW: Rund 42 % der Schulabgängerinnen
erlangten Abitur – bei Schulabgängern waren es
rund 33 %
* Insgesamt 181.230
Schulabgängerinnen und Schulabgänger verließen
die allgemeinbildenden Schulen am Ende des
Schuljahres 2023/24.
* Mehr als jede/-r
Dritte von ihnen machte das Abitur.
* 8,9 %
der männlichen und 6,0 % der weiblichen
Schulabgänger ohne Ersten S
Am Ende des
Schuljahres 2023/24 haben 181.230
Schulabgängerinnen und Schulabgänger die
allgemeinbildenden Schulen (ohne
Weiterbildungskolleg) in Nordrhein-Westfalen
verlassen. Mehr als jede/-r Dritte von ihnen
machte das Abitur. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, gab es jedoch Unterschiede bei den
Geschlechtern.

Von den 89.350 weiblichen Personen, die die
Schule verließen, erlangten 41,8 % die
allgemeine Hochschulreife. Von den 91.880
männlichen Schulabgängern machten 32,9 % das
Abitur. Geschlechterunterschiede auch beim
Schulabgang ohne ersten Schulabschluss Während
sich bei der Fachoberschul- bzw.
Fachhochschulreife kaum Geschlechterunterschiede
zeigen, gab es beim Ersten Schulabschluss
(ehemals Hauptschulabschluss) mehr männliche
Schulabgänger.
Durchschnittlich 7,4 %
der Schulabgängerinnen und Schulabgänger
verließen die allgemeinbildende Schule ohne
Ersten Schulabschluss. Dabei betrug der Anteil
unter den Schulabgängerinnen 6,0 % und bei den
Schulabgängern 8,9 %. Berufliche Schulen und
Weiterbildungskollegs bieten auch
allgemeinbildende Schulabschlüsse an An
beruflichen Schulen können neben beruflichen
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie
beruflichen Schulabschlüssen auch
allgemeinbildende Schulabschlüsse erlangt
werden.
So erlangten 26,8 % der 223.565
Schulabgängerinnen und Schulabgänger von
beruflichen Schulen einen allgemeinbildenden
Schulabschluss. 3,4 % der Schulabgängerinnen und
Schulabgänger verließen die berufliche Schule
mit einem hier erworbenen Abitur. Auch an
Weiterbildungskollegs können allgemeinbildende
Schulabschlüsse erreicht werden.
Am Ende
des Schuljahres 2023/24 verließen 3.125
Schulabgängerinnen und Schulabgänger ein
Weiterbildungskolleg und 33,6 % von ihnen mit
Abitur. Hierbei ist zu beachten, dass an
beruflichen Schulen und Weiterbildungskollegs
allgemeinbildende Abschlüsse nur berichtet
werden, wenn diese höherwertiger ausfallen als
der bisher erworbene Abschluss.
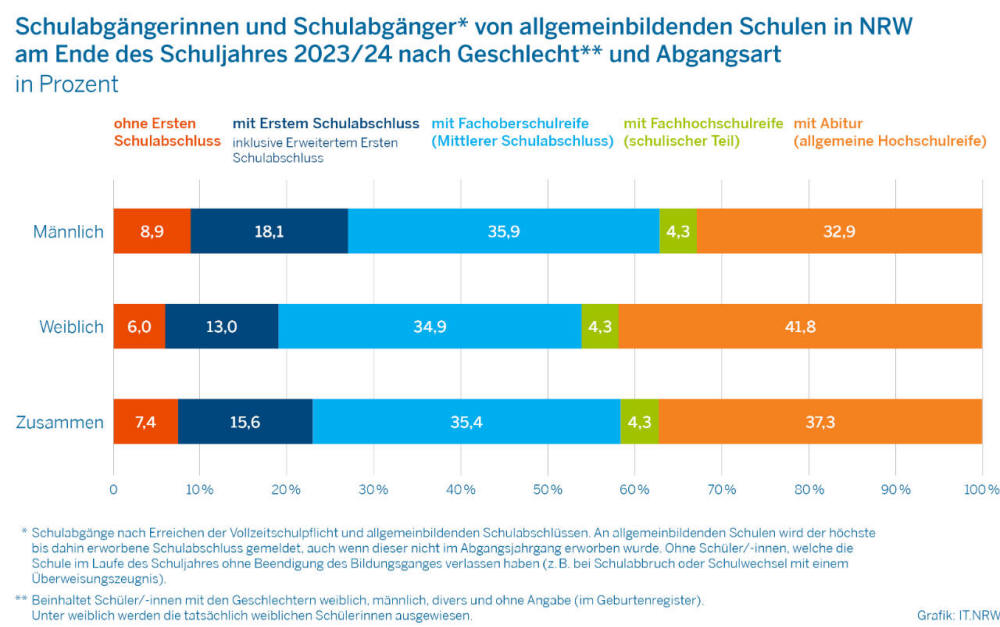
Durchschnittlich 8 Tote und fast 1 000
Verletzte pro Tag bei Verkehrsunfällen im Jahr
2024
• 2 770 Getötete bei
Straßenverkehrsunfällen, 69 weniger als im
Vorjahr
• Zahl der Verletzten und der
polizeilich erfassten Unfälle knapp unter
Vorjahresniveau • Überhöhte oder nicht
angepasste Geschwindigkeit häufigste Ursache
tödlicher Verkehrsunfälle
Im Jahr 2024
sind in Deutschland 2 770 Menschen bei
Straßenverkehrsunfällen gestorben. Das waren 69
Getötete weniger als im Jahr 2023 (2 839) und in
etwa so viele wie im Jahr 2022 (2 788). Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
endgültigen Ergebnissen mitteilt, lag die Zahl
der Verletzten im Straßenverkehr mit rund 365
000 nur knapp unter dem Vorjahresniveau (366
600).
Rund 314 400 Menschen wurden
leicht verletzt (2023: 313 700), rund 50 600
Menschen schwer (2023: 52 900). Die Zahl der
Schwerverletzten sank damit im Jahr 2024 auf den
niedrigsten Wert seit 1991, als die Verletzten
bei Straßenverkehrsunfällen erstmals getrennt
nach Schwer- und Leichtverletzten erfasst
wurden. Durchschnittlich starben im Jahr 2024
jeden Tag 8 Menschen infolge eines Unfalls im
Straßenverkehr, 138 trugen schwere und 859
Menschen leichte Verletzungen davon.
Zahl der Alkoholunfälle wieder auf dem Niveau
der Jahre 2014 bis 2019
Die Zahl der
Unfälle, bei denen mindestens eine
unfallbeteiligte Person alkoholisiert war, lag
im Jahr 2024 mit 35 100 leicht unter dem
Vorjahreswert (2023: 37 200). Damit sank die
Zahl der Alkoholunfälle wieder auf das Niveau
der Jahre 2014 bis 2019, nachdem die Polizei in
den Corona-Jahren 2020 und 2021 jährlich weniger
als 33 000 solcher Unfälle registriert hatte.
Durchschnittlich kam es auf Deutschlands
Straßen im Jahr 2024 alle 15 Minuten zu einem
Alkoholunfall. Insgesamt starben 2024 bei
Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Alkohol
198 Menschen und 17 800 Menschen wurden
verletzt. Da Unfälle nicht immer auf nur einen
einzigen Grund zurückgeführt werden können,
werden häufig mehrere Unfallursachen für einen
Unfall angegeben.
So gehen
Alkoholunfälle häufig auch mit anderem
Fehlverhalten einher, etwa mit zu schnellem
Fahren oder dem Missachten der Vorfahrt. 65 %
der Verletzten innerhalb von Ortschaften und
57 % der Toten auf Landstraßen Wie in den
Vorjahren ereigneten sich die meisten
polizeilich registrierten Unfälle innerorts.
2024 waren es rund drei Viertel (74 %). Hier
war auch die Zahl der Verletzten besonders hoch:
Rund zwei Drittel aller Verletzten (65 %) wurden
im Jahr 2024 bei Unfällen innerhalb von Städten
und Dörfern verletzt, rund ein Viertel (26 %)
auf Landstraßen und etwa ein Zehntel (9 %) auf
Autobahnen.
Die meisten Verkehrstoten
waren im Jahr 2024 dagegen außerorts zu
beklagen. Grund sind unter anderem die höheren
Fahrgeschwindigkeiten außerhalb von Ortschaften.
Auf Landstraßen kommen weitere Risikofaktoren
wie die fehlende Trennung zum Gegenverkehr,
schlechte Überholmöglichkeiten oder ungeschützte
Hindernisse wie Bäume neben der Fahrbahn hinzu.
57 % der bei Unfällen im Straßenverkehr
Getöteten kamen auf Landstraßen ums Leben,
innerorts waren es 33 % und auf Autobahnen 10 %.
In absoluten Zahlen starben bei Unfällen auf
Landstraßen im Jahr 2024 insgesamt
1 571 Personen, rund 96 500 Menschen trugen
Verletzungen davon. Die meisten von ihnen waren
mit dem Pkw unterwegs (54 % aller Getöteten und
68 % aller Verletzten auf Landstraßen).
Auf Autobahnen verloren 284 Menschen ihr Leben
infolge eines Verkehrsunfalls. Darunter waren
169 Pkw-Insassen und 54 Insassen von
Güterkraftfahrzeugen (zum Beispiel Lkw,
Sattelzugmaschinen oder Kleintransporter).
62 % der Verkehrstoten innerorts waren zu
Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs Innerhalb von
Ortschaften findet der größte Teil des Rad- und
Fußgängerverkehrs statt. Dies wirkt sich auf die
Unfallzahlen aus: Im Jahr 2024 starben innerorts
915 Menschen bei Verkehrsunfällen. 62 % von
ihnen waren mit dem Fahrrad (278 Getötete) oder
zu Fuß (292 Getötete) unterwegs.
Etwa
ein Drittel der innerorts auf Fahrrädern
Getöteten kam auf dem Pedelec, häufig auch als
E-Bike bezeichnet, ums Leben (100 Getötete),
rund zwei Drittel auf einem Fahrrad ohne
Elektroantrieb (178). Auch E-Scooter-Unfälle
sind ein überwiegend innerörtliches Phänomen: 23
der insgesamt 27 Menschen, die im Jahr 2024 mit
dem E-Scooter tödlich verunglückten, kamen
innerhalb von Ortschaften ums Leben.
Ihr
Anteil an allen innerorts Getöteten blieb mit
2,5 % aber vergleichsweise gering.
Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit
häufigste Ursache tödlicher Verkehrsunfälle
Nach wie vor ist überhöhte oder nicht angepasste
Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer 1 für
tödliche Verkehrsunfälle. 30 % der Verkehrstoten
und 13 % aller Verletzten kamen im Jahr 2024 bei
Unfällen zu Schaden, bei denen mindestens eine
beteiligte Person die zulässige
Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte oder
für die Straßen- oder Witterungsverhältnisse zu
schnell fuhr (843 Getötete, 48 600 Verletzte).
Bei jeweils 15 % der Unfälle mit
Personenschaden wurde einer beziehungsweise
einem Unfallbeteiligten vorgeworfen, den Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten
oder die Vorfahrt nicht beachtet zu haben.
Besonders auf Autobahnen ist zu schnelles Fahren
eine der Hauptunfallursachen. 43 % der Getöteten
auf Autobahnen kamen bei Unfällen ums Leben, bei
denen mindestens eine beteiligte Person die
zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten
hatte oder für die Straßen- oder
Witterungsverhältnisse zu schnell fuhr
(121 Getötete).
Auf Landstraßen kamen
34 % der tödlich Verunglückten (541 Getötete)
bei solchen Geschwindigkeitsunfällen zu Tode,
innerorts lag der Anteil bei 20 %
(181 Getötete). Im Schnitt wird alle 19 Minuten
ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt Im
Jahr 2024 starben 53 Kinder unter 15 Jahren
infolge eines Verkehrsunfalls, im Jahr 2023
waren es 44 gewesen.
Die Zahl der
verletzten Kinder lag wie im Vorjahr bei 27 200.
Das bedeutet, dass 2024 im Schnitt alle
19 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall
verletzt wurde. 21 Kinder kamen als Insassen
eines Pkw ums Leben, ebenfalls 21 waren zu Fuß
und 8 mit dem Fahrrad unterwegs. Die Zahl der
bei Verkehrsunfällen verletzten Seniorinnen und
Senioren ab 65 Jahren stieg 2024 auf 53 600
(2023: 52 000).
Auch die Zahl der
Getöteten stieg in dieser Altersklasse gegenüber
dem Vorjahr, und zwar um 30 auf 1 101 Personen.
Damit waren 40 % der Verkehrstoten im Jahr 2024
im Alter ab 65 Jahren. Die meisten Seniorinnen
und Senioren (434) kamen als Pkw-Insassen ums
Leben. Mit einem Pedelec verunglückten
135 Seniorinnen und Senioren tödlich, 150 mit
einem Fahrrad ohne Motor.
Freitag, 11. Juli 2025
Für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und
Schüler beginnen nach den Zeugnisvergaben die
Sommerferien
Zeugnistelefone der
Bezirksregierungen sind wie gewohnt erreichbar
Am Freitag, 11. Juli 2025, endet das Schuljahr
in Nordrhein-Westfalen, die Sommerferien
beginnen. Rund 2,5 Millionen Schülerinnen und
Schüler zwischen Aachen und Bielefeld starten
dann hoffentlich mit einem guten Gefühl in diese
Zeit zum Durchatmen. Die Ferien finden am
Mittwoch, 27. August 2025, ihr Ende, wenn das
neue Schuljahr eingeläutet wird.
„Ich
danke den vielen Menschen, die im nun endenden
Schuljahr mit großem Engagement dazu beigetragen
haben, dass unsere Schulen nicht nur Orte des
Lehrens und Lernens sind, sondern vor allem auch
Orte, an denen sich alle wohlfühlen können und
an denen Werte gelebt werden. Wir arbeiten
kontinuierlich daran, dass sich die Bedingungen
an unseren nordrhein-westfälischen Schulen
weiter verbessern, dass die Personalzahlen
weiter steigen und noch mehr Wert auf die
Förderung der Basiskompetenzen von Schülerinnen
und Schülern gelegt wird, dass die
Demokratiekompetenz von Kindern und Jugendlichen
gefördert oder die datengestützte
Qualitätsentwicklung vorangetrieben wird. Jetzt
aber ist erst einmal unterrichtsfreie Zeit – und
ich wünsche allen am Schulleben Beteiligten und
natürlich vor allem auch den Schülerinnen und
Schülern erholsame und entspannte Wochen!“, sagt
Schulministerin Dorothee Feller.
Bei
Beratungsbedarf und Fragen zu den Zeugnissen und
der Notengebung, stehen wie jedes Jahr die
Zeugnistelefone der Bezirksregierungen
vertrauensvoll zur Verfügung.
Zeugnistelefon
der Bezirksregierung Düsseldorf:
Telefonnummer: 0211 4754002
Freitag, 11. Juli
2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis
15.00 Uhr
Montag, 14. Juli 2025, von 10.00
bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag, 15. Juli 2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr
und von 13.00 bis 15.00 Uhr
"Zeugnis-Telefon" für den Kreis Wesel
Am
Freitag, 11.07.2025, erhalten viele Schülerinnen
und Schüler ihre Zeugnisse. Zu diesem Anlass ist
beim Schulamt für den Kreises Wesel für
die Schulformen Grundschule, Hauptschule und
Förderschule ein Zeugnistelefon eingerichtet.
Das Zeugnistelefon ist an folgenden Tagen unter
der Telefonnummer
0281 207 2212 erreichbar:
Freitag, 11.07.2025, Montag, 14.07.2025,
Dienstag, 15.07.2025, jeweils von 10:00 bis
12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr.
Stauprognose 11.-13. Juli:
Sommerreiseverkehr nimmt deutlich zu
ADAC
erwartet lange Staus am Wochenende / NRW startet
in die Ferien

©imago images/Steinsiek.ch
Der
Sommerreiseverkehr wird am kommenden Wochenende
spürbar zunehmen. Insbesondere der Ferienbeginn
in Nordrhein-Westfalen sowie im Norden der
Niederlande sorgt für volle Straßen und teils
kilometerlange Staus.
Zusätzlich rollt
eine zweite Reisewelle aus Bremen, Hessen,
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland
sowie aus dem Süden der Niederlande an. Auch
viele Urlauberinnen und Urlauber aus Nordeuropa
sind auf dem Weg in den Süden. Tagesausflügler
und Kurzentschlossene verschärfen die Lage
weiter, vor allem bei schönem Wetter.
Die
größten Nadelöhre sind und bleiben Baustellen.
Aktuell zählt der ADAC 1.194 Baustellen auf
deutschen Autobahnen, von denen viele auch
während der Ferienzeit bestehen bleiben. Hinzu
kommen am Wochenende Vollsperrungen auf der A6
und der A8, die den Verkehrsfluss zusätzlich
behindern.
Besonders staugefährdet sind
folgende Autobahnen in beiden Richtungen:
A1
Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen –
Hamburg
Kölner Ring (A1/A3/A4)
A2 Dortmund
– Hannover – Braunschweig – Magdeburg
A3 Köln
– Frankfurt – Nürnberg – Passau
A5 Frankfurt
– Heidelberg – Karlsruhe – Basel
A6 Mannheim
– Heilbronn – Nürnberg
A7 Hamburg –
Füssen/Reutte
A8 Karlsruhe – Stuttgart –
München – Salzburg
A9 Halle/Leipzig –
Nürnberg – München
A24 Hamburg – Berlin
A31 Bottrop – Leer
A45 Hagen – Gießen –
Aschaffenburg
A61 Mönchengladbach – Koblenz –
Ludwigshafen
A93 Inntaldreieck – Kufstein
A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
A99
Umfahrung München
Die verkehrsreichsten
Zeiten sind Freitagnachmittag, Samstagvormittag
und Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, sollte
besser auf die Wochentage Montag bis Donnerstag
ausweichen, idealerweise außerhalb der
Berufsverkehrszeiten.
Zur Entlastung des
Ferienverkehrs gilt vom 1. Juli bis zum 31.
August an allen Samstagen ein Lkw-Fahrverbot für
Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zwischen 7 und 20 Uhr
auf besonders belasteten Strecken.
Auch
im benachbarten Ausland drohen teils erhebliche
Verzögerungen. In Österreich ist vor allem die
Brennerautobahn betroffen. Dort sorgen
umfangreiche Bauarbeiten an der Luegbrücke trotz
zweispurigem Verkehr insbesondere am Wochenende
für erhebliche Behinderungen. Zudem gelten in
Tirol Abfahrtssperren für den überregionalen
Durchgangsverkehr auf der Inntalautobahn (A12)
sowie auf der Fernpass-Route.
Zusätzliche
Verzögerungen drohen durch verschärfte
Grenzkontrollen, vor allem an den Übergängen
Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden
(A93). Auch bei der Ausreise aus Deutschland
werden teilweise Kontrollen durchgeführt, etwa
in Richtung Dänemark, Niederlande, Frankreich
und Polen. Für Fahrten nach Slowenien, Kroatien,
Griechenland und in die Türkei sollten
Autofahrende ebenfalls längere Wartezeiten
einkalkulieren.
Der ADAC empfiehlt allen
Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die
aktuelle Verkehrslage zu informieren und
ausreichend Pausen einzuplanen. Wer unterwegs
auf dem Laufenden bleiben möchte, kann die ADAC
Drive App nutzen. Sie zeigt nicht nur aktuelle
Spritpreise, sondern auch Staus, Baustellen und
freie Ladestationen in Echtzeit.
Trotz leichtem Rückgang bleibt die Zahl der im
Straßenverkehr Getöteten hoch.
Der
TÜV-Verband mahnt sichere Infrastruktur,
strengere Kontrollen und bessere Prävention an.
Das Statistische Bundesamt hat heute die
Unfallstatistik für das Jahr 2024
veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen
kommentiert Fani Zaneta, Referentin für
Fahrerlaubnis, Fahreignung und
Verkehrssicherheit beim TÜV-Verband:
„Täglich sterben acht Menschen im deutschen
Straßenverkehr. Im Jahr 2024 waren es insgesamt
2.770. Das sind zwar rund 2,4 Prozent weniger
als im Vorjahr, aber noch immer deutlich zu
viele, um von einer Trendwende zu sprechen. Der
Straßenverkehr in Deutschland ist für viele
Menschen noch immer zu gefährlich. Sicherheit im
Straßenverkehr darf kein Zufall sein, sondern
braucht entschlossenes politisches Handeln.“
Schutz für die Schwächsten im Verkehr bleibt
unzureichend
„Besonders groß ist der
Handlungsbedarf bei der Sicherheit schwächerer
Verkehrsteilnehmer:innen. Fast zwei Drittel der
innerorts Getöteten waren 2024 zu Fuß oder mit
dem Fahrrad unterwegs. Im Schnitt wird alle 19
Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall
verletzt. Diese Zahlen belegen, dass der
Verkehrsraum in vielen Städten noch nicht sicher
genug ist.
Eine moderne und
verantwortungsvolle Verkehrspolitik muss den
Schutz von Kindern, älteren Menschen,
Radfahrenden und Fußgänger:innen in den
Mittelpunkt stellen. Sichere Rad- und Fußwege,
übersichtliche Kreuzungen und eine gerechtere
Verteilung des Verkehrsraums sind dafür die
Grundlage. Städte und Kommunen brauchen die
notwendigen Spielräume, um Gefahrenstellen zu
entschärfen und sichere Verkehrswege zu
schaffen.“
Verkehrssicherheit braucht
sichere Infrastruktur und konsequente Kontrollen
„Der Straßenverkehr muss so gestaltet werden,
dass Fehler nicht tödlich enden. Neben baulichen
Maßnahmen braucht es eine konsequente
Überwachung von Verkehrsregeln. Allein 2024
wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt mehr als 2,4
Millionen Tempoverstöße registriert.
Geschwindigkeitsverstöße waren im Jahr 2024 die
Hauptursache für Verkehrsunfälle. Trotzdem fehlt
es an spürbaren Konsequenzen und vielerorts an
Kontrollen.
Mehr Polizeipräsenz im
Straßenverkehr, höhere Bußgelder und klare
Regeln sind dringend notwendig, um
Geschwindigkeitsverstöße, Alkoholfahrten und
anderes Fehlverhalten wirksam einzudämmen.
Insbesondere die Zahl der Alkoholunfälle zeigt,
dass bestehende Regelungen nicht ausreichen:
Fast 200 Menschen starben 2024 bei
Alkoholunfällen. Wer alkoholisiert ein Fahrzeug
lenkt, gefährdet sich und andere. Die Grenze für
eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung
sollte daher unbedingt von derzeit 1,6 auf 1,1
Promille gesenkt werden.“
Altersgerechte
Mobilität sicher gestalten
„Der demografische
Wandel stellt den Straßenverkehr vor neue
Herausforderungen. Mit zunehmendem Alter steigt
das Unfallrisiko, oft aufgrund nachlassender
Reaktionsfähigkeit oder Fehleinschätzungen im
Straßenverkehr. 40 Prozent aller Getöteten waren
im vergangenen Jahr über 65 Jahre alt. Die
meisten von ihnen kamen als Pkw-Insass:innen ums
Leben (434 Getötete). Um diese Opferzahlen zu
senken, sind Rückmeldefahrten ab 75 Jahren ein
wichtiges Instrument. Sie unterstützen ältere
Autofahrer:innen bei der sicheren
Verkehrsteilnahme und helfen dabei die eigene
Fahrkompetenz realistisch einzuschätzen. So
bleibt individuelle Mobilität erhalten, ohne die
Sicherheit im Straßenverkehr zu gefährden.“
Auch im Rad- und Fußverkehr ist die Zahl der
Opfer über 65 Jahren dramatisch: 135
Senior:innen starben mit dem Pedelec, 150 mit
dem Fahrrad ohne Motor. Neben der persönlichen
Verantwortung ist nach Ansicht des TÜV-Verbands
eine altersgerechte Infrastruktur notwendig: gut
erkennbare Fahrspuren, sichere Querungen und
geschützte Radwege helfen, Unfälle von
vornherein zu vermeiden.
Methodik-Hinweis: Grundlage der Angaben sind
endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes
für das Jahr 2024. Die Zahlen sind abrufbar
unter: www.destatis.de
Grundlage der Angaben
zu Verkehrsauffälligkeiten, wie
Geschwindigkeitsverstößen sind Daten des
Kraftfahrt-Bundesamtes für das Jahr 2024. Sie
sind abrufbar unter:
www.kba.de
Wenn es mal heiß
wird - Kühle Orte in Wesel
Die
Sommermonate bringen meist sonniges Wetter und
laden dazu ein, Zeit im Freien zu verbringen.
Wenn es jedoch über einen längeren Zeitraum sehr
heiß ist, wirkt sich das negativ auf Mensch und
Natur aus.
Angesichts des
fortschreitenden Klimawandels ist auch in
Zukunft in den Sommermonaten mit immer
häufigeren und intensiveren Hitzeperioden sowie
Tageshöchsttemperaturen von mehr als 30 Grad
Celsius zu rechnen. Auch die Zahl der
Tropennächte, in denen die Temperatur nachts
nicht unter 20 Grad Celsius sinkt, wird weiter
zunehmen.
Dies hat nicht nur erhebliche
Auswirkungen auf Natur und Umwelt, sondern auch
auf die menschliche Gesundheit.
Insbesondere unsere
Innenstädte heizen sich durch ihre dichte
Bebauung in den Sommermonaten deutlich stärker
auf als das locker bebaute Umland. An vielen
Orten staut sich zudem die heiße Luft, denn es
fehlt an Luftzirkulation. Hinzu kommt, dass
viele Stadtbewohner*innen keine eigene grüne
Oase oder schattiges Plätzchen zur Abkühlung
haben. Daher sind öffentliche Parks und
Grünflächen an heißen Tagen wichtige
Rückzugsorte, die Erholung und Abkühlung bieten.
Der Hitzeknigge, Mann mit Sonnenschirm
Hitzeplanung in Wesel
Die
Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Wesel
seit einiger Zeit deutlich zu spüren. Zukünftig
gilt es, die Stadt widerstandsfähiger gegen
diese Wetterextreme zu machen. Aus
stadtplanerischer Sicht sollten Flächen – dort
wo möglich – entsiegelt und begrünt werden.
Die Themen Hitze und Starkregen werden in
sämtlichen Bereichen der Stadtplanung
mitberücksichtigt. Die Klimaschutzmanger*innen
werden auch in planerische Fragestellungen
miteinbezogen, z. B. in der Bauleitplanung,
Grünflächenplanung, Verkehrsplanung oder bei der
Neugestaltung von Schulhöfen. Aktuell werden
Fördermittel aus dem Förderprogramm des Bundes
„Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ für
Neupflanzungen von Straßen- und Einzelbäumen,
für Teilentsiegelungen und für
Naturerlebnisräume (z.B. Pikoparks) verwendet.
Neben den genannten stadtplanerischen
Maßnahmen gehört zum Maßnahmenpaket der Stadt
Wesel auch die Bereitstellung von Informationen
zum Hitzeschutz (Broschüren, Internetauftritt
der Stadt, Senioren-App).
An dieser
Stelle ist auch der Fachdienst Gesundheitswesen
des Kreises Wesel zu nennen, der eine eigene
Kampagne zum Hitzeschutz im Kreis Wesel
durchführt. Die Stadt Wesel hat auf ihrer
Homepage die Informationen verlinkt. Auf der
Internetseite des Kreises findet sich u.a. eine
tagesaktuelle Karte des Deutschen Wetterdienstes
mit Hitzewarnstufen. Während akuter
Hitzeperioden ist das Hitzetelefon des
Kreisgesundheitsamts geschaltet.
Das
gilt, wenn an mindestens drei
aufeinanderfolgenden Tagen vom DWD eine
Hitzewarnung der Stufe 1 (starke Wärmebelastung)
vorhergesagt wird. Bei der sogenannten HOTline
erreicht man während der regulären
Öffnungszeiten des Kreises Ärztinnen und Ärzte
des Gesundheitsamts, die gesundheitliche Fragen
zum Hitzeschutz direkt beantworten.
Bei
der Stadt Wesel ist das Thema „Hitze“ im
Klimaschutzmanagement angesiedelt. Es wird dort
im Team ganzheitlich und interdisziplinär mit
anderen Themen der Klimafolgenanpassung
besprochen. Außerdem besteht bereits seit
mehreren Jahren die interdisziplinäre
Arbeitsgruppe Baumpflanzungen Sie tagt alle zwei
Wochen. Alleine in den letzten Jahren konnten
mehrere Hundert Bäume gepflanzt werden. Außerdem
wurden zahlreiche Projekte zur
Starkregen(vorsorge), Bodenentsiegelung,
Grünflächenplanung und zur Steigerung der
Biodiversität gemeinsam erarbeitet und
umgesetzt.
Beispiele: Pikopark
Hugo-Becker-Straße, Entsiegelung ehem.
Rollschuhbahn, Bürgergärten Büderich,
777-Jahre-Wald, Ereigniswälder (Aue und
Obrighoven), außerdem zahlreiche Baumpflanzungen
auf Spielplätzen, Friedhöfen, Grünflächen sowie
entlang von Straßen und Wegen.
Flyer und
Karte „Kühle Orte“
Die „Kühle-Orte-Karte“ für
das Weseler Stadtgebiet soll den Bürger*innen
die Suche nach kühlen Orten und Plätzen im
Stadtgebiet erleichtern, aber auch generell für
das Thema „Hitze“ sensibilisieren. Im Ergebnis
benennt die „Kühle-Orte-Karte“ die Kategorien
Parks, Grünanlagen, Wasserspielplätze,
Trinkbrunnen und öffentliche WCs.
Im
Herbst 2024 hat die SPD-Fraktion im Haupt- und
Finanzausschuss angeregt, einen Flyer zu
entwickeln, der einen Überblick zu kühlen Orten
geben soll. Die gedruckte Flyer-Version enthält
einen Kartenausschnitt des Innenstadtbereichs
der Stadt Wesel. In der Online-Karte ist das
gesamte Stadtgebiet abgebildet.
Neben einer
online abrufbaren digitalen Version ist der
Flyer u. a. im Rathaus, in der Stadtinformation
und im Mehrgenerationenhaus erhältlich.
Einladung zur Informationsveranstaltung:
Wasserstoffnetz für Unternehmen in Dinslaken
Im Zuge des geplanten Ausbaus der
Wasserstoffinfrastruktur im Kreis Wesel lädt die
Stadt Dinslaken interessierte Unternehmen
herzlich zu einer Informationsveranstaltung ein.
Die Veranstaltung findet am Montag, 14. Juli
2025, von 10:00 bis ca. 12:00 Uhr im Raum
Niederrhein der Kathrin-Türks-Halle in
Anwesenheit von Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel statt.
In Fachvorträgen
vermitteln Vertreter*innen von Thyssengas
Informationen zum Zugang zum Wasserstoffkernnetz
sowie zu den organisatorischen
Rahmenbedingungen. Zudem stellt die Benteler
Steel/Tube GmbH ihre Dekarbonisierungsstrategie
vor und geht auf die Vorteile eines möglichen
gemeinsamen Netzanschlusses mit weiteren
Unternehmen in Dinslaken ein.
Eine
Dekarbonisierungsstrategie ist ein Plan, der
darauf abzielt, die Emissionen von
Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen zu
reduzieren, um den Klimawandel zu bekämpfen und
eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.
Die Veranstaltung dient als Plattform für
einen frühzeitigen Austausch und zur Vernetzung
der Unternehmen. Eingeladen sind insbesondere
Unternehmen, die aktuell fossile Energieträger
nutzen und sich mit alternativen,
zukunftsfähigen Energieformen befassen möchten.
Um eine Rückmeldung zur Teilnahme wird
gebeten. Anmeldungen sind per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@dinslaken.de oder
telefonisch unter 02064 66258 möglich. Aber auch
spontane Besuche sind möglich.
Neues Amtsblatt
Am 8. Juli 2025 ist
ein neues Amtsblatt der Stadt Dinslaken
erschienen. Es informiert über 28 Grabstätten
auf dem Friedhof Im Nist, auf dem Parkfriedhof
und auf dem Waldfriedhof Oberlohberg. Hier
werden Angehörige gesucht, die die jeweiligen
Grabstätten fortführen.
Betroffene
Bürger*innen können sich bei Fragen an
die Friedhofsverwaltung auf dem Parkfriedhof
(Flurstraße 32) wenden. Telefonisch ist sie
unter der Nummer 02064-606118 erreichbar. Die
Amtsblätter der Stadt Dinslaken können auch
online eingesehen werden.
Mehr Spaß am Eickschenweg in Moers: Bau des
neuen Spielplatzes beginnt
Noch ist
es ruhig auf dem Spielplatz am Eickschenweg in
Rheinkamp. Doch das wird sich bald ändern: Ab
Ende Juli rollen die Bagger an, denn hier
entsteht ein ganz neues Paradies für Kinder und
Jugendliche. Der Platz wurde zuletzt im Jahr
2000 umgebaut.
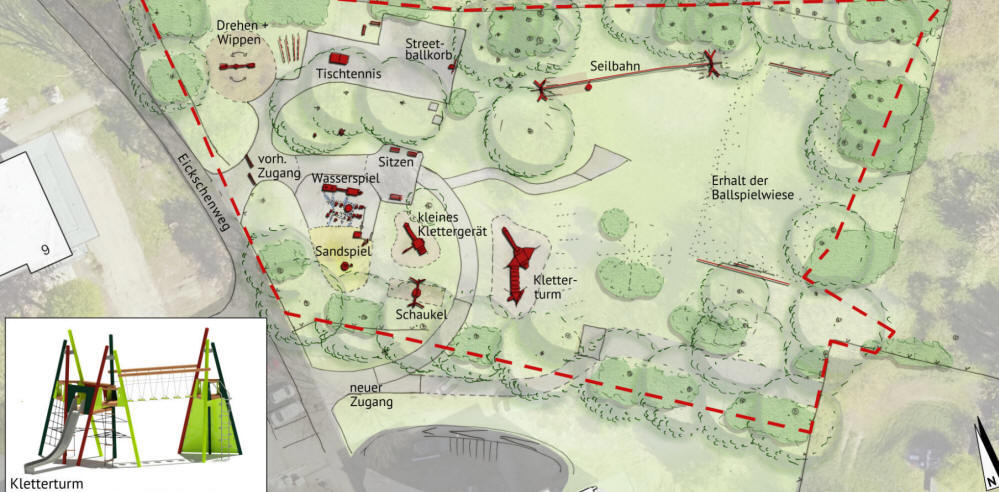
So werden die Spielgeräte auf dem Platz
aufgebaut. (Grafik: pst).
Viele
Spielgeräte mussten aus Sicherheitsgründen
entfernt werden. Jetzt bekommt das Gelände nicht
nur neue, sondern auch einen Zugang vom Ende der
Rheinhold-Büttner-Straße – möglich gemacht durch
eine enge Zusammenarbeit mit Vivawest, die die
Fläche zur Verfügung stellt. Mit dem Umbau wird
der Spielplatz Eickschenweg wieder zu dem, was
er sein soll: ein lebendiger Treffpunkt für
Kinder, Jugendliche und Familien im Quartier.
Angebote für alle Altersklassen
Damit
sich der Platz sich in das Wohnquartier einfügt,
wurden bereits im Winter Sträucher entfernt. So
wirkt er nicht mehr wie ein abgeschlossener
Raum. Die Aufteilung bleibt dabei wie gehabt:
hinten das große Rasenfeld zum Ballspielen, im
Norden der Jugendbereich mit Tischtennisplatte
und Streetballkorb. Dort wird es künftig auch
gemütliche Bänke und ein neues Drehgerät geben –
besonders für Teenager gedacht.
Ein
echter Hingucker entsteht zwischen
Sandspielbereich und Rasenfeld: ein großes
Klettergerät mit Netzen, Leitern, Kletterwand
und hoher Rutsche – ideal für Kinder im
Grundschulalter. Für die Kleineren wird es in
direkter Nähe ein eigenes Kletterpodest mit
kleiner Rutsche geben.
Barrierefreier
Sand- und Wasserspielbereich
An den Rändern
des Spielplatzes warten weitere Highlights: eine
Seilbahn im Norden und eine Nestschaukel im
Süden. Der Sand- und Wasserspielbereich wird
barrierefrei gestaltet. Die Pumpe wird so
versetzt, dass das Wasser in leicht zugängliche
Spieltische fließt. Von dort geht’s durch Rinnen
in den Sand. Wer lieber zuschaut oder eine Pause
braucht, kann auf den neuen seniorengerechten
Bänken mit Lehne Platz nehmen.
Die
Bauarbeiten starten Mitte Juli und sollen bis
Ende 2025 abgeschlossen sein. Die große
Eröffnung ist für das Frühjahr 2026 geplant.
Insgesamt investiert die Stadt Moers rund
330.000 Euro in das Projekt. Die Vivawest
Stiftung gGmbH unterstützt u. a. die Seilbahn
finanziell.
Moers: Skimboarding,
BMX & mehr - Trendsport zum Ausprobieren in den
Ferien
Flachwasser, ein
spezielles Board und jede Menge Bewegung: Beim
Skimboarding gleitet man mit Anlauf über eine
nasse Fläche und führt über eine Rampe Tricks
aus – ein rasanter Sommersport, der nun auch in
Moers ausprobiert werden kann.

Erstmals kann man in Moers Skimboarding
ausprobieren. Dafür wird ein Skimpool im
Skatepark aufgebaut. (Foto: Skimhomies)
Hierfür wird ein Skimpool im Skatepark Moers
aufgebaut. Gemeinsam mit zwei weiteren Workshops
– ‚BMX Dirtbike an den BBQ Trails‘ und
‚BMX/Dirtbike im Skatepark‘ – gehört
‚Skimboarding‘ zum Projekt ‚Urban Moves –
Trendsport im öffentlichen Raum‘.
Es
geht damit nach dem Skatepark-Opening ‚360
(G)Rad‘ in die nächste Runde. Die
Sommer-Workshops werden wieder vom Kinder- und
Jugendbüro der Stadt Moers in Kooperation mit
der Streetbox des Caritasverbands Moers-Xanten
e. V. umgesetzt und mit 18.000 Euro aus Mitteln
des Kinder- und Jugendförderplans des Landes NRW
finanziert.
Sie sind Teil des
umfangreichen Ferienprogramms ‚Try Days‘ von der
Streetbox. Angebot für Ältere „Ich freue mich
sehr über die Förderzusage des Landes, da wir so
gezielt Projekte über die regulären Angebote der
offenen Kinder- und Jugendarbeit hinaus
durchführen können“, sagt Lena Brandau, Leiterin
des Kinder- und Jugendbüros.
„Uns ist
wichtig, dass Jugendliche in Bewegung kommen,
Neues ausprobieren und ohne Leistungsdruck
zeigen können, was in ihnen steckt. Das Ganze
mitten in der Stadt und mit viel Spaß.“ Die
durch Urban Moves geförderten Workshops richten
sich vor allem an ältere Kinder und Jugendliche.
‚Try Days‘ hält noch weitere sportliche und
kreative Angebote bereit.
Und Urban
Moves läuft weiter: Im Herbst ist ein Event an
der Dirtbahn geplant. Im Winter folgen Workshops
in Jugendeinrichtungen. 2026 endet das Projekt
mit einer großen Abschlussveranstaltung.
Skimboarding steht am 30. Juli und 13. August
auf dem Programm, BMX/Dirtbike BBQ Trails am 1.
und 4. August und BMX/Dirtbike im Skatepark am
15. August. Alle Infos, weitere Termine und
Anmeldung unter: https://streetbox-moers.de.
Stadt Kleve sucht Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer für die Kommunalwahl
Am
14. September 2025 findet in Kleve die
Kommunalwahl statt.
Um einen reibungslosen
Ablauf der Wahlhandlung sowie der
Stimmauszählung zu gewährleisten, sucht die
Stadt Kleve für den Wahlsonntag am 14. September
sowie für eine etwaige Stichwahl am 28.
September 2025 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer.

Wort "Wahlen" aus Menschen zusammengestellt
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unterstützen das
Wahlamt der Stadt Kleve bei der Durchführung der
Wahlhandlung am Wahltag sowie bei der
anschließenden Auszählung der abgegebenen
Stimmen in insgesamt 44 Urnenwahlräumen und 22
Briefwahlräumen. In den Urnenwahlräumen stehen
sie den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern
bei Fragen zur Seite, geben die Stimmzettel aus
und überwachen den ordnungsgemäßen Ablauf des
Wahltages vor Ort.
Voraussetzung für die
ehrenamtliche Tätigkeit ist die Vollendung des
16. Lebensjahres und der Besitz der deutschen
Staatsangehörigkeit oder der Staatsangehörigkeit
eines anderen EU-Mitgliedsstaates.
Für
ihren Einsatz erhalten die ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer ein Erfrischungsgeld. Zur
Kommunalwahl am 14. September 2025 beträgt das
Erfrischungsgeld je nach ausgeübter Funktion
zwischen 50 und 70 Euro. Im Falle einer
Stichwahl am 28. September 2025 wird für die
erneute Unterstützung an diesem Tag ein
zusätzliches Erfrischungsgeld zwischen 75 und 90
Euro gezahlt, wiederum abhängig von der
ausgeübten Funktion im Wahlvorstand.
Interessierte Personen finden alle Informationen
zur Kommunalwahl, zur Tätigkeit als Wahlhelferin
oder Wahlhelfer und die Online-Anmeldung auf
www.kleve.de/wahl sowie den dort verlinkten
Unterseiten. Für Fragen und telefonische
Registrierungen ist das Wahlamt unter
02821/84-555 erreichbar.
Die Stadt Kleve
hofft auf zahlreiche freiwillige Meldungen von
Bürgerinnen und Bürgern und bedankt sich bereits
im Voraus für die Unterstützung!
Regionalrat stellt Weichen für eine geordnete
Windenergienutzung in der Region
Der Regionalrat Düsseldorf hat am 10.07.2025 die
neuen regionalplanerischen Festlegungen für
Windenergieanlagen beschlossen. Sofern diese
nach dem nun anstehenden Anzeigeverfahren bei
der Landesplanungsbehörde wirksam werden, ist
damit eine geordnete Windenergienutzung in der
ganzen Region sichergestellt.
Windenergieanlagen sind dann nur noch in den vom
Regionalrat oder den Räten der Kommunen
beschlossenen Windenergiegebieten
bauplanungsrechtlich privilegiert. Damit tritt
eine hohe Planungssicherheit in der Region ein.
Windenergieanlagen in umwelt- und raumbezogen
kritischen neuen Standortbereichen – also
außerhalb der geplanten Bereiche – können so
kaum noch genehmigt werden.
Zugleich
ist über die planerisch festgelegten
Windenergiebereiche sichergestellt, dass den
Belangen der Energiesicherheit und des
Klimaschutzes hinreichend Rechnung getragen
wird. Regierungspräsident Thomas Schürmann lobte
nicht nur das Ergebnis, sondern auch den
dahinterstehenden Prozess.
„Ich danke
allen, die sich in das komplexe und
anspruchsvolle Verfahren eingebracht haben –
auch wenn nicht allen Anregungen gefolgt werden
konnte. Das hat sehr dazu beigetragen, dass der
Regionalrat nach intensiver Prüfung und Beratung
den aktuellen Entwurf beschließen konnte.
Positiv hervorzuheben sind aus meiner Sicht die
immer sehr sachlichen, fachkundigen und an den
Erfordernissen der ganzen Region orientierten
Diskussionen im Regionalrat. Damit leistet
unsere Region einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende und für den Klimaschutz “
Bundesweit laufen entsprechende
Windenergieplanungen oder sind bereits
abgeschlossen. Denn über das
Windenergieflächenbedarfsgesetz des Bundes und
dessen Umsetzung durch die Länder wird
sichergestellt, dass alle Regionen ihren
entsprechenden Beitrag zur künftigen
Energieversorgung leisten.
Im
Vergleich zur Fassung, die dem
Aufstellungsbeschluss der 18.
Regionalplanänderung vom 20.06.2024 zu Grunde
lag, gab es bereits im Frühjahr 2025
umfangreiche Änderungen der geplanten
Festlegungen und Regelungen. Substantiell
reduziert wurden z.B. die geplanten WEB im
Reichswald und in der Umgebung des Reichswaldes.
Reduktionen gab es aber auch in weiteren Teilen
des Kreises Kleve und des Kreises Viersen.
Stark verringert wurden ferner die geplanten
WEB im Rhein-Kreis Neuss (vor allem in Jüchen,
Grevenbroich und Rommerskirchen, aber auch in
Korschenbroich). Hinzu kamen Reduktionen in
Mönchengladbach und dem Kreis Mettmann – bei
Letzterem insbesondere in der Stadt Mettmann. Es
wurden aber auch kleinere Flächen ergänzt,
beispielsweise im Süden von Weeze auf Anregung
der Kommune.
Weitere Informationen zur
Beratung im Regionalrat finden Sie hier:
https://www.regionalrat-duesseldorf.nrw.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQzuxVeiVE_JugkNqTLqTXM
Hinweis: Die Planungsregion Düsseldorf setzt
sich zusammen aus den Kreisen Kleve, Mettmann
und Viersen, dem Rhein-Kreis Neuss und den
Städten Düsseldorf, Mönchengladbach, Krefeld,
Wuppertal, Solingen und Remscheid .

NRW: Krankenhausbehandlungen wegen
Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens 2023
um 4,6 % gestiegen
* Zahl der
behandelten Personen bleibt nach Corona auf
niedrigem Niveau.
* Behandlungsquote in
Herne mit 1.966 je 100.000 Einwohnern am
höchsten.
* Anstieg von 5,3 % bei den
vollstationären Reha-Behandlungen.
Im
Jahr 2023 wurden 129.505 Menschen aus
Nordrhein-Westfalen wegen Krankheiten der
Wirbelsäule und des Rückens vollstationär im
Krankenhaus behandelt. Darunter fallen
Deformitäten oder Verschleißerscheinungen der
Wirbelsäule, Bandscheibenschäden und
Rückenschmerzen, die nicht auf die zuvor
genannten Erkrankungen zurückzuführen und auch
nicht psychogen sind.
Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, waren das 4,6 %
mehr als ein Jahr zuvor, aber 18,3 % weniger als
im Jahr 2013. Nach einem starken Rückgang der
Behandlungsfälle um 20,1 % im ersten Jahr der
Corona-Pandemie blieben die Behandlungsfälle in
den Jahren 2021 mit +0,8 % und 2022 mit −0,7 %
auf diesem niedrigeren Niveau. Ob dies ggf. mit
einer Zunahme ambulanter Behandlungen begründet
ist, kann die Statistik nicht belegen.
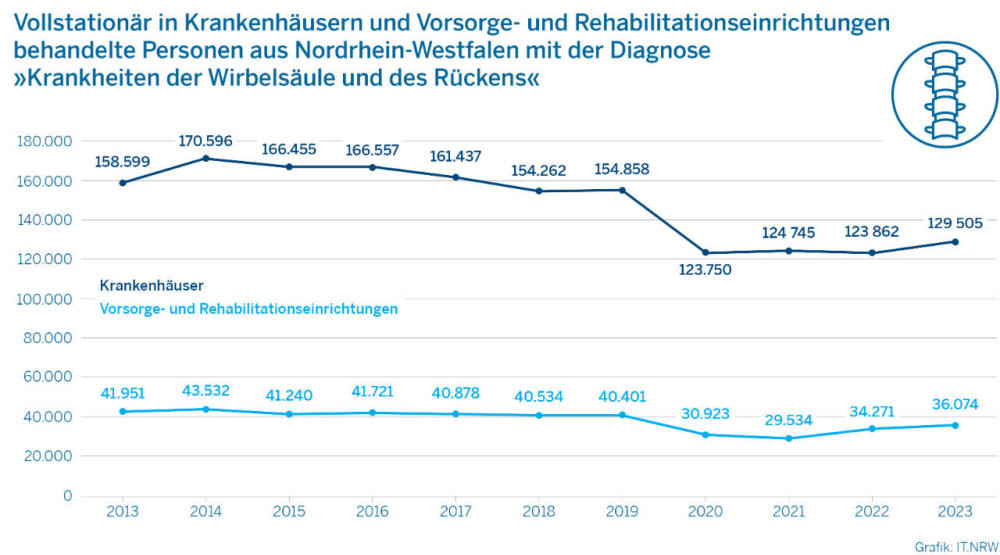
Durchschnittsalter lag bei 61,6 Jahren, mehr
als die Hälfte waren Frauen
Mit 45,4 % der
Patientinnen und Patienten waren etwa ähnlich
viele Patientinnen und Patienten im Alter von 40
bis unter 65 Jahren wie in der Altersgruppe
65 Jahre und älter mit 43,4 % vertreten. Das
Durchschnittsalter der behandelten Personen lag
bei 61,6 Jahren. Mit 55,0 % der 2023 behandelten
Personen waren etwas mehr als die Hälfte Frauen.
Im Durchschnitt verblieben die
Patientinnen und Patienten 6,3 Tage im
Krankenhaus. Höchste Behandlungsquote in Herne –
niedrigste Quote in Münster Die höchste Quote
der Behandlungsfälle in Krankenhäusern wegen
Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens gab
es 2023 in Herne mit 1.966 je 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner, gefolgt von
Gelsenkirchen mit 1.299 und dem Kreis
Recklinghausen mit 1.271.
Am geringsten war
die Quote in Münster mit 312 Behandlungsfällen
je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, in
Bielefeld mit 330 und im Kreis Gütersloh mit
367.
Anstieg auch bei vollstationären
Reha-Behandlungen von Krankheiten der
Wirbelsäule und des Rückens
Die Zahl der im
Jahr 2023 wegen Krankheiten der Wirbelsäule und
des Rückens in Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100
Betten vollstationär behandelten Menschen aus
NRW lag bei 36.074. Das war ein Anstieg von
5,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber 2013
ging die Anzahl der Behandlungen um 14,0 %
zurück.
Wie bei den
Krankenhausbehandlungen gab es bei den
vollstationären Reha-Behandlungen mit 56,5 %
etwas mehr Patientinnen als Patienten. Im
Gegensatz zur Altersverteilung bei den
Krankenhausbehandlungen waren 68,0 % der
Behandelten im Reha-Bereich im Alter von 40 bis
unter 65-Jahren. Somit lag das
Durchschnittsalter mit 58,3 Jahren bei den Rehas
etwas niedriger. Die durchschnittliche
Verweildauer betrug 23,4 Tage.
NRW-Industrie: Energieintensive Produktion im
Mai 2025 um 1,5 % gesunken
*
Produktionsrückgang in der übrigen Industrie um
0,9 %.
* Chemie sowie Metallerzeugung und
-bearbeitung mit Produktionseinbußen.
*
Rückläufige Werte im Vergleich zu Februar 2022
sowohl in der energieintensiven als auch in der
übrigen Industrie.
Die Produktion der
NRW-Industrie ist im Mai 2025 nach vorläufigen
Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt um
1,0 % gegenüber April 2025 gesunken. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, sank die
Produktion in den energieintensiven
Wirtschaftszweigen um 1,5 %. Die Produktion in
der übrigen Industrie war gegenüber dem
entsprechenden Vormonat um 0,9 % niedriger.
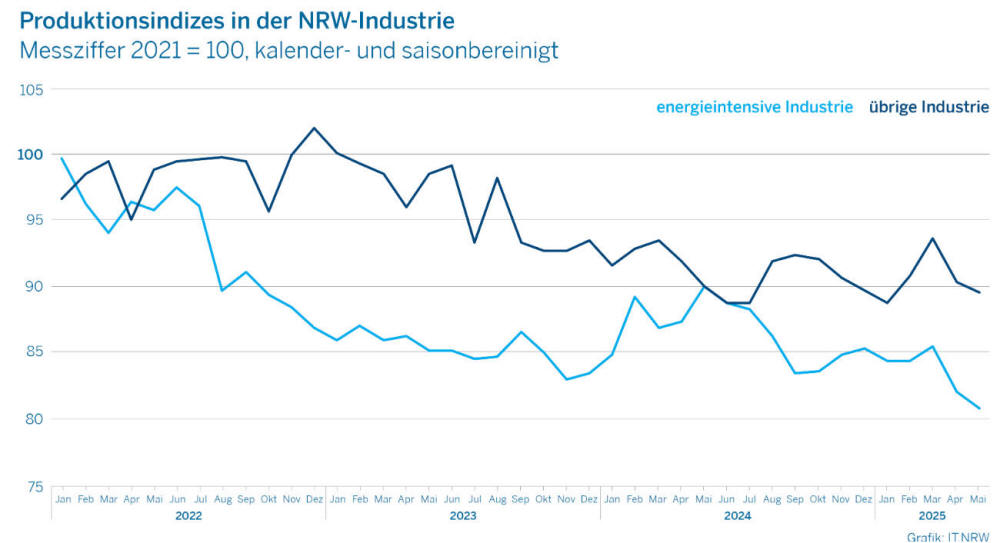
Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die
Produktion um 4,0 %; die der energieintensiven
Industrie sank um 10,0 %. Die Produktion in der
übrigen Industrie ging um 0,5 % zurück. Chemie
mit Produktionseinbußen von 2,9 % – Kokerei und
Mineralölverarbeitung mit einem Plus von 7,6 % .
Im Vergleich zu April 2025 waren in NRW für
die energieintensiven Branchen im Mai 2025
unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten:
Innerhalb der energieintensiven Branchen wurde
für die chemischen Industrie ein
Produktionsrückgang von 2,9 % (−11,5 % ggü. dem
Vorjahresmonat) ermittelt.
In der
Metallerzeugung und -bearbeitung sank die
Produktion um 2,3 % (−10,5 % ggü. dem
Vorjahresmonat). Die Kokerei und
Mineralölverarbeitung vermeldete hingegen ein
Produktionsplus von 7,6 % (−12,6 % ggü. dem
Vorjahresmonat).
Unterschiedliche
Entwicklungen auch in den Branchen der übrigen
Industrie
In den Branchen der übrigen
Industrie waren ebenfalls unterschiedliche
Entwicklungen zu erkennen: Die
Produktionsleistung in der Herstellung von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg um 4,6 %
(+2,7 % ggü. dem Vorjahresmonat). Im Sonstigen
Fahrzeugbau wurde ein Produktionsplus von 3,1 %
verzeichnet (−2,2 % ggü. dem Vorjahresmonat).
Die Getränkeherstellung vermeldete
dagegen einen Produktionsrückgang von 8,4 %
(−10,9 % ggü. dem Vorjahresmonat). Die
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
verzeichnete ein Produktionsminus von 2,7 %
(−1,9 % ggü. dem Vorjahresmonat). Auch der
Maschinenbau konstatierte Produktionseinbußen
von 1,8 % (+3,1 % ggü. dem Vorjahresmonat).
Im Vergleich zu Februar 2022, zu Beginn des
Krieges in der Ukraine, sank die Produktion im
Mai 2025 insgesamt um 11,4 % (−15,8 % in der
energieintensiven Industrie; −8,8 % in der
übrigen Industrie). Wie das Statistische
Landesamt weiter mitteilt, lag der revidierte
kalender- und saisonbereinigte Wert für den
Berichtsmonat April 2025 um 3,7 % unter dem
Vormonats- und 3,2 % unter dem Vorjahreswert.
Donnerstag, 10. Juli 2025
Leben retten will gelernt sein -
Kooperationsvereinbarung zur verpflichtenden
Einführung von Reanimationsunterricht ab dem
Schuljahr 2026/27 unterzeichnet
Mit der Unterzeichnung einer
Kooperationsvereinbarung am 8. Juli 2025 setzt
Nordrhein-Westfalen ein klares Zeichen, um die
Laienreanimation an Schulen zu stärken.
Schulministerin Dorothee Feller hat gemeinsam
mit Vertreterinnen und Vertretern von
Stiftungen, Ärztekammern, Hilfsorganisationen,
ärztlichen Partnerinnen und Partnern und
medizinischen Fachgesellschaften eine Initiative
zur Verankerung der Laienreanimation im
Schulalltag auf den Weg gebracht.
Ziel
der Kooperationsvereinbarung ist es, alle
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit
dem lebensrettenden Schema „Prüfen – Rufen –
Drücken“ vertraut zu machen.
Zu den
Partnern gehören in alphabetischer Reihenfolge:
· ADAC Stiftung,
· Aachener Institut für
Rettungsmedizin und zivile Sicherheit
·
Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe
·
Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und
Anästhesisten
· Björn-Steiger-Stiftung,
·
BKK-Landesverband NORDWEST
· Deutsche
Herzstiftung
· Deutsche Gesellschaft für
Anästhesiologie und Intensivmedizin
·
Deutscher Rat für Wiederbelebung
· Deutsches
Rotes Kreuz (Landesverbände Nordrhein und
Westfalen-Lippe)
· Deutsches Jugendrotkreuz
(Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe)
· Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf
· Franziskus Hospital Bielefeld
· Stiftung
Universitätsmedizin Münster
· Unfallkasse NRW
· Universitätsklinikum Köln
·
Universitätsklinikum Münster
Ministerpräsident Hendrik Wüst erklärt: „Ob im
Straßenverkehr, am Arbeitsplatz oder in den
eigenen vier Wänden: Jeder kann zum Lebensretter
werden. Wie es richtig geht, muss man lernen –
und zwar schon in der Schule. Mit dem
verpflichtenden Wiederbelebungsunterricht ab dem
Schuljahr 2026/27 vermitteln wir Schülerinnen
und Schülern das notwendige Wissen, um im
medizinischen Notfall richtig zu handeln und
Leben zu retten. Solche Kompetenzen
weiterzugeben, ist Teil unseres Bildungs- und
Erziehungsauftrags.“
Schulministerin
Dorothee Feller hebt hervor: „Wer im Notfall
richtig handelt, kann Leben retten. Wir wollen,
dass Prüfen – Rufen - Drücken so
selbstverständlich wird wie Fahrradfahren. Dafür
brauchen Schulen konkrete Unterstützung und
genau die bringen wir jetzt gemeinsam mit
starken Partnerinnen und Partnern auf den Weg.“
Ab dem Schuljahr 2026/27 wird der
Reanimationsunterricht an Schulen im Bereich der
Sekundarstufe I in NRW verpflichtend eingeführt.
Jede Schülerin und jeder Schüler soll mindestens
einmal in den Klassen 7, 8 oder 9 eine Schulung
zur Laienreanimation im Umfang von 90 Minuten
erhalten. Förderschulen und private
Ersatzschulen werden ermutigt,
Reanimationsunterricht durchzuführen. Zum 1.
August 2025 wird eine Geschäftsstelle bei der
Bezirksregierung Köln eingerichtet. Bereits im
September beginnen landesweit die ersten
Schulungen von Lehrkräften.
Damit der
Reanimationsunterricht flächendeckend und
zuverlässig umgesetzt werden kann, sollen alle
rund 2.100 Schulen mit Sekundarstufe I in
Nordrhein-Westfalen spätestens im Laufe des
Schuljahres 2026/27 über jeweils zehn
Reanimationsphantome sowie zwei entsprechend
geschulte Lehrkräfte verfügen.
Der
Mindeststandard für die Schulung der Lehrkräfte
wird durch Schulungsvideos der oben aufgeführten
Kooperationspartner gewährleistet. Alle
Lehrkräfte können zudem auf ein umfassendes
Angebot an Lehrvideos und Unterrichtsmaterialien
von anderen Projektpartnern zurückgreifen.
Ergänzend wird ein Angebot für
Präsenzfortbildungen unterbreitet.
Um die
Maßnahme umzusetzen, ist das Schulministerium
auf die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen
Partnern in diesem medizinischen Bereich
angewiesen. In Gesprächen konnten zahlreiche
Unterstützungsangebote gewonnen werden. Die
Angebote umfassen etwa personelle Ressourcen für
Schulungen bis hin zu finanziellen Mitteln für
die Anschaffung von Übungsmaterial.
Christina Tillmann, Vorständin der ADAC-Stiftung
und eine der vielen Kooperationspartner
unterstrich: „Wenn wir junge Menschen schon in
der Schule befähigen, im Notfall richtig zu
reanimieren, retten wir nicht nur mehr Leben,
sondern stärken auch den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Die flächendeckende Einführung des
Reanimationsunterrichts in NRW hat
Vorbildcharakter und ist ein kraftvolles Signal
für Bildung mit echtem Lebensbezug.“
Dr.
Pierre-Enric Steiger, Präsident der
Björn-Steiger-Stiftung, betonte: „Die
Björn-Steiger-Stiftung ist stolz, dieses
lebensrettende Projekt zu unterstützen. Durch
die Schulung von Schülerinnen und Schülern in
Laienreanimation schaffen wir eine Generation,
die im Notfall mutig handelt.“
Prof. Dr.
Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Herzstiftung, erklärte: „Das beherzte
Eingreifen von uns allen in einer Notsituation
ist überlebensentscheidend. Dass die
Wiederbelebung jetzt ein fester Bestandteil des
Schulunterrichts in Nordrhein-Westfalen wird,
ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der
Laien-Reanimationsquote in der Bevölkerung.“
Die heute unterzeichnete
Kooperationsvereinbarung hatte einen engagierten
Vorlauf im Rahmen des Modellprojekts
„Laienreanimation an Schulen in
Nordrhein-Westfalen“ von 2017 bis 2022. Dieser
Vorlauf war insbesondere geprägt durch das
freiwillige Engagement der ärztlichen Partner
sowie zahlreiche Gespräche, in denen viele
Akteure – auch in privater und ehrenamtlicher
Initiative – mitgewirkt haben.
Universitätsprofessor Bernd Böttiger,
Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für
Wiederbelebung, betont: „Seit vielen Jahren
setzen wir uns intensiv mit dem Thema
Laienreanimation auseinander. Dass der
Reanimationsunterricht nun für alle Schülerinnen
und Schüler verpflichtend wird, ist ein
bedeutender Schritt – und ein großer Erfolg.
Diese Entscheidung wird dazu beitragen, viele
Menschenleben zu retten.“
Universitätsprofessor Hugo Van Aken,
Vorsitzender der Stiftung Universitätsmedizin
Münster erklärt: „Ein lang gehegter Traum wird
nach 20 Jahren endlich Wirklichkeit. Es ist
großartig, dass Nordrhein-Westfalen als größtes
Bundesland einen verpflichtenden
Reanimationsunterricht einführt. So wird
deutlich – Wiederbelebung kann wirklich jeder
lernen.“
Ministerin Feller dankt allen
beteiligten Partnern für ihre Mitwirkung:
„Dieses Bündnis zeigt, was möglich ist, wenn
verschiedene Institutionen mit unterschiedlichen
Beiträgen ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ich
bin allen Partnern für ihre fachliche und
personelle Unterstützung sowie den Stiftungen
ADAC-, Björn-Steiger- und Deutsche Herzstiftung
für ihre finanzielle Unterstützung ausdrücklich
dankbar.
Jeder einzelne Beitrag eines
jeden Partners ist ein großer Gewinn für die
Laienreanimation von Schülerinnen und Schüler.
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unsere
Schülerinnen und Schüler auf den Ernstfall gut
vorbereitet sind.“
ADAC-Stiftung:
Reanimationsunterricht - wichtig, um Leben zu
retten
Zweijährige konzeptionelle
Zusammenarbeit / Unterstützung für die
Qualifikation von Lehrkräften und bei der
Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien /
Tillmann: „Gemeinsam stärken wir Kinder, im
Notfall zu helfen.“
Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen hat heute bekannt gegeben,
Reanimationsunterricht verpflichtend in den
Lehrplan aller weiterführenden Schulen
aufzunehmen. Die ADAC Stiftung ist eine von
mehreren Organisationen, die das
bevölkerungsreichste Bundesland bei der
Realisierung unterstützen. Die ADAC Stiftung hat
seit rund zwei Jahren daran mitgearbeitet, das
inhaltliche Konzept zu entwickeln. Für
Schulungen der Lehrkräfte, eine begleitende
Evaluation und Unterrichtsmaterialien stellt die
ADAC Stiftung in den kommenden Jahren ihre
inhaltliche Expertise und finanzielle Ressourcen
zur Verfügung.

Reanimationsunterricht - wichtig, um Leben zu
retten - Foto: Stefan Hobmaier.
Christina
Tillmann, Vorständin der ADAC Stiftung, sagte
zur Ankündigung der Landesregierung: „Wenn junge
Menschen bereits in der Schule lernen, im
Notfall richtig zu reanimieren, können wir nicht
nur mehr Leben retten, sondern stärken auch den
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die
flächendeckende Einführung des
Reanimationsunterrichts in NRW hat
Vorbildcharakter und ist ein kraftvolles Signal
für Bildung mit echtem Lebensbezug.“
Die
ADAC Stiftung hat in mehreren regionalen
Pilotprojekten Konzepte für
Reanimationsunterricht in Schulen erprobt und
setzt sich für eine Aufnahme ins Curriculum auch
in anderen Bundesländern ein. Hessen und
Saarland haben entsprechende Erlasse bereits
beschlossen, doch Nordrhein-Westfalen ist das
erste Bundesland, dass bereits vor Inkrafttreten
landesweit tragfähige Strukturen für eine
dauerhafte Umsetzung schafft.
„Nordrhein-Westfalen geht einen strategisch
klugen Weg, der auf Langfristigkeit und echte
Wirksamkeit ausgerichtet ist, und der
hoffentlich von weiteren Bundesländern
übernommen wird.“, sagte Christina Tillmann.
Über die ADAC Stiftung:
Die ADAC Stiftung
konzentriert sich in ihrer Arbeit auf zwei
Themen: Mobilität und Lebensrettung. Sie setzt
sich dafür ein, dass alle Menschen in
Deutschland ihrem Bedürfnis nach Mobilität
sicher und nachhaltig nachkommen können. Und
dass Menschen mit akuten Verletzungen oder in
lebensbedrohlichen Situationen im ganzen Land
schnelle und wirksame Hilfe erhalten.
Zudem
fördert sie mit der Einzelfallhilfe gezielt die
soziale Teilhabe von Unfallopfern und ihren
Familien.
Die Stiftung ist seit ihrer
Gründung 2016 alleinige Gesellschafterin der
gemeinnützigen ADAC Luftrettung und fördert
interdisziplinäre Projekte im Rettungswesen.
Moers: Mobiles Behinderten-WC am Kastell
wieder nutzbar
Die Reparaturarbeiten
am Behinderten-WC am Kastell sind abgeschlossen.
Die mobile Toilette steht ab sofort wieder
funktionsfähig an ihrem gewohnten Standort zur
Verfügung.
Während der Ausfallzeit
konnte auf die behindertengerechte
Toilettenanlage im Alten Landratsamt ausgewichen
werden. Diese Anlage bleibt weiterhin im Rahmen
des Programms ‚Nette Toilette‘ öffentlich
zugänglich und nutzbar.
Moers: Feuerwehr-Einsatzkräfte trainieren
Bekämpfung von Flächenbränden
Die Bekämpfung von Vegetationsbränden ist in den
letzten Jahren verstärkt in den Fokus der
Feuerwehren gerückt. Die deutschlandweiten
Ereignisse der letzten Wochen und Jahren zeigen
die Bedeutung dieser Thematik.

Foto: Feuerwehr Moers
Aus diesem Grund
führte Löschzug Repelen der Feuerwehr Moers
gemeinsam mit den Einheiten Hülsdonk und
Kapellen am Freitag, 4. Juli, eine sogenannte
Vegetationsbrandübung durch. Neben theoretischen
Anteilen zu den Themen Brandverlauf, Sicherheit
und Vorgehen konnten die Einsatz auch den
praktischen Umgang mit Handwerkzeugen,
Löschrucksäcken sowie das mobile Arbeiten mit
Schläuchen, Strahlrohren und Fahrzeugen üben.
Einen besonderen Dank richtet die
Feuerwehr Moers an Landwirt Heinz-Peter
Leimkühler, der die Übungsfläche zu Verfügung
gestellt und mit landwirtschaftlichem Gerät
vorbereitet hat. Hierdurch konnten die Wehrleute
die Übung sicher und unter realen Bedingungen
durchführen.
Moers Ende des
Familienzentrums Rheinkamp-Meerfeld - Arbeit
geht weiter
Nach 15 Jahren gemeinsamer Arbeit endet am 31.
Juli das Familienzentrum Rheinkamp-Meerfeld. Es
wurde im August 2010 gegründet und bestand aus
dem Verbund der Kindertagesstätten ‚Bauklötzchen
e.V.‘ und der städtischen Kita
‚Konrad-Adenauer-Straße‘. Trotzdem setzen beide
Kitas ihre Arbeit für Kinder und Familien fort.
Das Familienzentrum hat in den letzten
15 Jahren zahlreiche Familien begleitet und
unterstützt – nicht nur im eigenen Kita-Alltag,
sondern auch mit vielfältigen Angeboten für
Familien aus dem gesamten Stadtteil. Dazu
gehörten u. a. Beratungsangebote,
Infoveranstaltungen zu pädagogischen Themen,
Erste-Hilfe-Kurse, generationsübergreifende
Bewegungsangebote sowie eine enge Zusammenarbeit
mit Vereinen und Einrichtungen vor Ort.
Großer organisatorischer Aufwand
Hintergrund
der Entscheidung war, dass der organisatorische
Aufwand – insbesondere im Hinblick auf die
regelmäßige Re-Zertifizierung - für eine
Elterninitiative zunehmend schwer zu leisten
war. Die Entscheidung wurde sorgfältig abgewogen
und in engem Austausch getroffen.
Stadt
und Elterninitiative bedanken sich bei allen
Beteiligten für das langjährige Engagement und
die vertrauensvolle Zusammenarbeit, für die
vielen bereichernden Begegnungen und die
geleistete Arbeit. Die pädagogische Arbeit in
beiden Kindertageseinrichtungen wird
selbstverständlich fortgesetzt.
Die
städtische Kita Konrad-Adenauer-Straße versucht,
im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin Angebote
in Anlehnung an die bisherige
Familienzentrumsarbeit anzubieten. Auch die
Arbeit im Stadtteil wird fortgeführt. Eine neue
Konzeption soll im kommenden Kita-Jahr
entwickelt werden.
Nachtwächter und
Türmer trafen sich in Moers
Illustre Gäste begrüßte Bürgermeister Christoph
Fleischhauer am Freitag, 4. Juli, vor dem
Moerser Schloss. Mitglieder der ‚Deutschen Gilde
der Nachtwächter, Türmer und Figuren‘ trafen
sich an dem Wochenende zur Regionaltagung und
Gildetreffen Nord-West. Es stand unter dem
Motto: Kommet, sehet, staunet und genießet.

Foto pst
Eingeladen hatte die gewandeten
Gäste aus ganz Deutschland die Moerser
Gästeführerin Anne-Rose Fusenig. Der
Bürgermeister lobte das Engagement der Frauen
und Männer, die Menschen in ganz Deutschland die
jeweilige Geschichte ihrer Stadt näherbringen.
Meistens stellen sie eine historische Figur dar.
„So kann man Geschichte live ohne Bücher oder
Fernsehschirm erleben“, so Fleischhauer.
Er dankte auch Anne-Rose Fusenig, die vor
Kurzem mit Bravour eine weitere Prüfung in ihrem
Bereich abgelegt hat. Sie ist nun zertifizierter
Guide für den niedergermanischen Limes. Nach der
Begrüßung lud die ebenfalls gewandete
Museumsleiterin Diana Finkele die Gäste ins
Moerser Schloss ein.
Traditioneller Schützenumzug läutet zum 19. Mal
die Klever Kirmes ein
Am Samstag, den 12. Juli 2025, treffen sich um
14 Uhr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
traditionellen Schützenumzugs zur Eröffnung der
Klever Kirmes auf dem Marktplatz „Linde“.
Pünktlich um 14:45 Uhr setzt sich der Festzug,
bestehend aus 13 Schützen- und 2 Musikvereinen,
in Bewegung und zieht durch die Innenstadt.
Die musikalische Begleitung übernehmen der
Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Kleve und
der Spielmannszug der Feuerwehr Reichswalde.
Insgesamt werden rund 450 Personen an dem Umzug
teilnehmen.

Riesenrad Klever Kirmes
Seit seiner
Premiere im Jahr 2005 hat sich der Schützenumzug
als bedeutsamer Auftakt der Klever Kirmes
etabliert. Seit 20 Jahren wird in diesem
Zusammenhang die lebendige Tradition des Klever
Schützenwesens gefeiert.
Der festliche
Schützenumzug beginnt um 14:45 Uhr am Marktplatz
Linde und führt anschließend durch die
historische Innenstadt Kleves. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zugs
marschieren über die Hagsche Straße und Große
Straße in die Fußgängerzone der Stadt Kleve.
Weiter geht es durch die Kavarinerstraße bis zum
Koekkoekplatz, wo in diesem Jahr auf eine Parade
verzichtet wird. Über die Hafenstraße führt der
Weg schließlich zur Festwiese im Bereich der
Volksbank Kleverland – direkt gegenüber dem
Kirmesgelände. Die Ankunft des gesamten
Schützenzuges auf der Festwiese ist gegen 15:20
Uhr geplant.
Nach der Begrüßung auf der
Festwiese hält Bürgermeister Wolfgang Gebing ein
Grußwort. Anschließend findet die
Preisverteilung des Stadtpokalschießens statt,
das in diesem Jahr vom Kellener Schützenverein
e. V. organisiert wurde.
Im Anschluss an
den traditionellen Fassanstich durch
Bürgermeister Wolfgang Gebing auf dem
Kirmesplatz sind die am Schützenumzug
teilnehmenden Vereine zum spannenden Schießen um
den Bürgermeisterpokal eingeladen.
Austragungsort ist der Schießstand des
Schaustellers Thommessen. Die feierliche
Preisverleihung findet gegen 16:15 Uhr in
festlicher Atmosphäre vor dem Getränkestand des
Schaustellers Jansen statt.
Nächstes
Reparatur-Café in St. Ida am 16. Juli
Schont Umwelt und Geldbeutel: Beim nächsten
Reparatur-Café in St. Ida/Rheinkamp, Eicker
Grund 102, am Mittwoch, 16. Juli, können wieder
beschädigte Dinge aus den Bereichen Schneiderei,
Holzarbeiten, Elektro und Fahrräder
instandgesetzt werden.
Von 16 bis 18.30
Uhr stehen ehrenamtlich Tätige den Besitzerinnen
und Besitzern bei der Reparatur zur Seite. Auch
Unterstützung im Umgang mit mitgebrachten PCs,
Laptops, Tablets und Handys sowie die
Installation von Apps und Programmen sind
möglich.
Das Reparatur-Café ist eine
Kooperation des Quartierszentrums AWO-Caritas
mit der katholischen Kirchengemeinde St.
Martinus und KoKoBe Moers und findet jeden
dritten Mittwoch im Monat statt. Weitere Infos
gibt es telefonisch unter 0 28 41/8 87 86 06
sowie per E-Mail an tanja.reckers@caritas-moers-xanten.de.
Euro Rock - Das europäische
Bandprojekt vom 12. – 21. Juli 2025
Das Duisburger Musikprojekt „Euro Rock“ steht
seit 1993 für den internationalen
Kulturaustausch junger europäischer Rockbands
und steigt dieses Jahr zum 31. Mal. Es ist
deutschlandweit in seiner Art einzigartig.
Ins Leben gerufen von Peter Bursch, Musiker
und Gitarrenpädagoge, ermöglicht das Projekt
Jugendlichen, sich in einem vernetzten Europa
kennenzulernen und Vorurteilen mit Offenheit und
Selbsterfahrung entgegenzutreten. Ein besonderes
Merkmal des Projekts ist, dass die Bands
gemischt werden.
Sänger spielen mit
Drummern aus Holland, Bassisten aus Litauen und
Keyboardern aus Deutschland. Fast jeden Abend
wird auf Bühnen in Bars, großen Sälen und bei
Open-Air-Festivals performt. Hier begegnen sich
Musikerinnen und Musiker unterschiedlichen
Niveaus und profitieren voneinander.
Als
Seminar-„Basiscamp“ wird wieder das rockerprobte
und bewährte „Parkhaus“ in Meiderich genutzt.
Dort stehen den Band vier Proberäume zur
Verfügung. Vom 12. bis 21. Juli widmen sich die
Bands dem kreativen Austausch und dem
gemeinsamen Musizieren.
„Euro Rock ist
für die Teilnehmenden ein bahnbrechendes
Projekt. Es ist nicht nur das musikalische
Abenteuer, das prägt. Das Einlassen auf
verschiedene Musikerinnen und Musiker aus
unterschiedlichen Teilen Europas ist auch für
die persönliche Entwicklung ein Meilenstein“,
sagt Daniel Jung vom Kulturbüro, der das Projekt
wie immer organisiert hat.
Der Ablauf
des Projekts ist flexibel und ermöglicht den
Musikerinnen und Musikern, maßgeblich Einfluss
auf den Verlauf zu nehmen. Je nach Fragestellung
werden auch spontan Workshops installiert oder
Themenabende einberufen. Brauchen die Bands
einfach mehr ungestörte Zeit mit einem
Produzenten im Proberaum, wird dafür Raum
geschaffen.
Die beteiligten Bands 2025
sind:

• Crimson Bloom – Duisburg/Krefeld
•
Shitman – Nijmegen/Ede, Niederlande

Shitman
©
Freek Wolff

• Primadona – Vilnius, Litauen
„Euro
Rock“ wird wie gewohnt von namhaften
Künstlerinnen und Künstlern begleitet. Das
Dozententeam besteht aus „Euro Rock“-Erfinder
Peter Bursch („Bröselmaschine“), Micki Meuser
(Musikproduzent aus Berlin, Vorsitzender der
Deutschen Filmkomponist*innen Union), Andreas
Klees (Multiinstrumentalist aus Duisburg,
ehemals The Bonny Situation und Thalamus),
Benjamin Peters (Vocalcoach und Sänger bei
Mottek), Pia Verbücheln (Dozentin für Gitarre,
Bakali) sowie Stefan Mühlenkamp (Drum Teacher,
ehemals Paperstreet Empire).
Weitere
Informationen sind auf der Homepage
www.euro-rock.de sowie auf Facebook
https://www.facebook.com/eurorockduisburg zu
finden.
Konzerte mit freiem Eintritt:
13.7.2025, 20 Uhr Stapeltor
16.7.2025, 20
Uhr Bollwerk 107 (Moers)
17.7.2025, 20 Uhr
Zum Hübi
18.7.2025, 20 Uhr Café The Shuffle
(Nijmegen, Niederlande)
19.7.2025, 20 Uhr
Parkhaus Meiderich
20.7.2025, 13 Uhr
Stadtfest Duisburg (Mitsubishi-Brüggemann-Bühne)
Mit dem Stadtfest Duisburg verbindet
„Euro Rock“ eine langjährige Freundschaft. Für
die Bands ist es ein großartiges Erlebnis auf
dieser großen und professionellen Bühne zu
spielen. Die Gigs am Sonntag, 20. Juli, bieten
den perfekten Abschluss für das Projekt.
Bauturbo: Nachbesserung beim § 246e
BauGB
Durchbruch für selbstnutzende
Wohneigentümer*innen
Der
gemeinnützige Verband Wohneigentum begrüßt die
Nachbesserung beim § 246e BauGB als "Durchbruch
für selbstnutzende Eigentümer und
Eigentümerinnen" und spricht sich für eine
Zustimmungsfiktion aus.
Gesetzesentwurf
überarbeitet
Im neuen Entwurf des
Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus hat
das Bundesbauministerium eine zentrale Forderung
des Verbands Wohneigentum aufgegriffen: Die
sogenannte Experimentierklausel (§ 246e BauGB)
soll künftig ohne Mindestanzahl an Wohneinheiten
gelten. Damit können künftig auch kleinere
bauliche Maßnahmen – etwa der Anbau einer
Einliegerwohnung oder die Umnutzung eines
Nebengebäudes – rechtssicher zügiger ermöglicht
werden.
„Das ist ein echter Fortschritt –
insbesondere für Eigentümer*innen, die für
Kinder, Eltern oder Pflegekräfte auf dem eigenen
Grundstück Wohnraum schaffen möchten“, erklärt
Verena Örenbas, Bundesgeschäftsführerin des
Verbands Wohneigentum e.V.. „Kleinteilige
Nachverdichtung wird damit rechtlich einfacher
und unbürokratischer möglich.“
Diese
Flexibilität ermögliche sowohl die Schaffung
neuen Wohnraums als auch die Anpassung
bestehender Gebäude an veränderte
Lebenssituationen – etwa im Alter oder bei
Pflegebedarf.
Kommunen sind gefordert
Zeitlich befristet bis zum 31. Dezember 2030
erlaubt § 246e BauGB künftig Abweichungen vom
bestehenden Bauplanungsrecht – vorausgesetzt,
die zuständige Gemeinde stimmt zu. „Damit dieses
Zeitfenster genutzt werden kann, ist jetzt das
Mitziehen der Kommunen gefordert“, so Örenbas.
Der Verband warnt: Ohne klare gesetzliche
Fristen, ohne Rechtsanspruch und ohne
Begründungspflicht der Gemeinde bestehe das
Risiko, dass sinnvolle Vorhaben abgelehnt oder
verzögert würden.
Für eine Zustimmungsfiktion
Der Eigentümerverband fordert daher eine
Zustimmungsfiktion nach dem Vorbild des § 36
Abs. 2 BauGB: Wenn eine Gemeinde nicht innerhalb
einer bestimmten Frist entscheidet, gilt die
Zustimmung als erteilt. „Nur so entsteht die
Planungs- und Investitionssicherheit, die viele
Eigentümer*innen dringend brauchen“, betont
Örenbas.
Eigentum als Teil der Lösung
Selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer
leisten seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag
zur Wohnraumversorgung – durch Pflege des
Bestands, nachhaltige Nutzung von Flächen und
generationsübergreifendes Bauen. Der geänderte
Gesetzentwurf erkennt diesen Beitrag erstmals in
einem zentralen Planungsinstrument an.
„Familiennah, nachhaltig, unkompliziert – so
muss Wohnungsbau auch funktionieren“, fasst
Örenbas zusammen. „Jetzt kommt es darauf an,
dass diese neue Chance auf allen Ebenen genutzt
wird.“
Konzerte der Stadt Kleve:
Musikalische Kriminalfälle, Improvisationen auf
Zuruf und ein Weltklasse-Bariton
Klassikfans aufgepasst: Der Vorverkauf für die
städtischen Konzerte hat begonnen! Die
Konzertsaison 2025/26, noch geplant von der
langjährigen Leiterin Sigrun Hintzen, hält
zahlreiche Höhepunkte bereit. Ein hochkarätig
besetztes Klavierquintett eröffnet die Saison im
September, sein Konzertprogramm „Take Five“
spielt auf vielseitige Weise mit der Zahl Fünf.
Pianist Herbert Schuch, der 2023 als
Ersatz für Fabian Müller begeisterte, musiziert
im Oktober mit seiner Ehefrau und Duopartnerin
Gülru Ensari Werke für Klavier vierhändig –
unter anderem Maurice Ravels fulminanten
„Bolero“.

Es folgen: die Brüder Lionel und Damian
Martin (Violoncello und Klavier) mit
Improvisationen auf Zuruf des Publikums,
englische Vokalmusik in adventlichem Glanz mit
dem Kammerchor Chorwerk Ruhr, eine Schubertiade
mit dem Weltklasse-Bariton Benjamin Appl sowie
eine Reise ins Nachtleben mit dem Arcis Saxophon
Quartett.
Acht Mitglieder des
Bayerischen Rundfunkorchesters – darunter die
gebürtige Kleverin Ursula Kepser – kontrastieren
Franz Schuberts wunderbares Oktett mit einem
modernen Werk für dieselbe Besetzung. Auch das
Landesjugendorchester ist erneut in der
Stadthalle zu erleben: mit Brahms’ Sinfonie Nr.
1 und Musik zeitgenössischer Komponistinnen.
In der Besonderen Reihe (mit Konzerten im
Museum Kurhaus, der Kleinen Kirche an der
Böllenstege und der Stadthalle) werden
musikalische Kriminalfälle gelöst, eine Gambe
und ein Sopran wetteifern darum, wer am
schönsten singt, und zwei junge Musikerinnen
übertragen die orchestrale Pracht von Edward
Elgars „Enigma-Variationen“ auf Klarinette und
Akkordeon. Die Filmmusik zu „Harry Potter“ und
weitere magische Werke erklingen beim
Zauber-Familienkonzert des Kinderorchesters NRW.
Tickets und Infos zu den Konzerten gibt
es im Rathaus, an allen
Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online auf
www.kleve.reservix.de. Der Eintritt für die
Reihenkonzerte kostet 18 Euro, für die Besondere
Reihe 12 Euro. Schüler*innen und Studierende
zahlen 5 Euro.
Wer seinen Wunschplatz
sicher haben möchte, hat die Wahl zwischen
verschiedenen günstigen Abonnement-Formaten (bei
Verhinderung ist die Abokarte übertragbar).
Verena Krauledat, seit Juni neue künstlerische
Leiterin der städtischen Konzertreihen, freut
sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.
Langeweile ausgeschlossen:
Tipps für die Sommerferien
Die
NRW-Sommerferien stehen vor der Tür – für
Schülerinnen und Schüler bedeutet das rund sechs
Wochen ohne Mathe, Englisch, Bio und Co. Und für
Familien eine gute Gelegenheit, den perfekten
Mix aus Sport und Spiel, aus Kultur und
Unterhaltung am Niederrhein zu genießen. Auch
kulinarisch gibt es einiges zu entdecken. Das
Angebot in der Region ist groß und bunt, wie
eine exemplarische Auswahl zeigt.
Am 19.
und 20. Juli verwandelt sich Schloss Walbeck
(Geldern) in ein lebendiges Geschichtsbuch: Beim
Schlossfest erwartet die Besucher ein
authentisches Spektakel mit Ritterlagern,
Händlern, Musikanten, Gauklern und mutigen
Rittern in voller Rüstung. Die große
Feldschlacht der Heerlager lässt
mittelalterliche Kampftechniken lebendig werden
– ein beeindruckendes Schauspiel für Groß und
Klein.
Handwerker und Künstler zeigen
traditionelle Techniken, während sich das bunte
Markttreiben mit Waren aus aller Herren Länder
entfaltet. Für Kinder gibt es ein eigenes
Kinderritterdorf mit Märchenerzählern,
Schmiedewerkstatt, Schatzsuche und der beliebten
Kinderschlacht gegen die Ritter.
Ein
Theater-Highlight mit viel Tradition sind die
Schlossfestspiele Neersen. Noch bis zum 24.
August gibt es vor der einmaligen Kulisse in
Willich hochwertige Unterhaltung für alle
Generationen. Auf dem Programm stehen Stücke wie
„Der Club der toten Dichter“, „Nils Holgersson“
und „Fisherman’s Friends“. „Nils Holgersson“
wird als Kindertheater direkt zu Beginn der
Ferien am 13. Juli sowie erneut am 20. Juli
jeweils ab 11 Uhr aufgeführt.
Traditionell finden seit über vier Jahrzehnten
am ersten Augustwochenende die „PPP-Tage“
(„Pauken, Plunder, Promenade“) in Wesel statt.
Ein buntes Rahmenprogramm vom Schützentag über
das Vereinsfest in der Innenstadt bis hin zum
beliebten Sonntags-Trödelmarkt auf der
Fischertorstraße und der großen Kirmes am
Rheinufer lockt vom 1. bis 3. August in die
Hansestadt am Rhein.
Vom 7. bis 10.
August wird Wassenberg wieder zum Hotspot für
Genießer: Beim 31. SchlemmerMarkt Rhein-Maas
erwarten die Besucher vier Tage voller
kulinarischer Höhepunkte. Unter dem Motto
„Lebensfreude und gutes Essen gehören zusammen“
präsentieren regionale und internationale
Spitzenköche auf dem Roßtorplatz und am
Patersgraben kreative Spezialitäten – von
raffinierten Meeresfrüchte-Variationen über
feine Fleischgerichte bis hin zu verführerischen
Desserts.
Niederrhein Tourismus hat die
regionalen Veranstaltungstipps während der
Sommerferien auf einer Webseite übersichtlich
und mit komfortabler Suchfunktion
zusammengefasst:
https://www.niederrhein-tourismus.de/niederrhein/sommerferientipps-am-niederrhein

Genuss pur verspricht der SchlemmerMarkt
Rhein-Maas in Wassenberg. Foto: Patrick
Gawandtka

Öffentliche Schulden im 1. Quartal
2025 um 0,6 % höher als 2024 - Schuldenstand
steigt um 14,3 Milliarden Euro auf 2 523,3
Milliarden Euro
Der Öffentliche
Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen
Bereich zum Ende des 1. Quartals 2025 mit 2
523,3 Milliarden Euro verschuldet. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die
öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem
Jahresende 2024 um 0,6 % oder 14,3 Milliarden
Euro.
Zum Öffentlichen Gesamthaushalt
zählen die Haushalte von Bund, Ländern,
Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der
Sozialversicherung einschließlich aller
Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich
gehören Kreditinstitute sowie der sonstige
inländische und ausländische Bereich, zum
Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.
Schulden des Bundes nahezu unverändert
Die Schulden des Bundes waren zum Ende des
1. Quartals 2025 lediglich 0,7 Milliarden Euro
(0,0 %) höher als Ende 2024. Die Verschuldung
für das "Sondervermögen Bundeswehr“ ist dabei
überdimensional um 12,8 % oder 2,9 Milliarden
Euro auf nunmehr 25,9 Milliarden Euro gestiegen.
Schulden der Länder erhöhen sich um
1,4 %
Die Länder waren zum Ende des
1. Quartals 2025 mit 615,4 Milliarden Euro
verschuldet, was einem Anstieg um
8,6 Milliarden Euro (+1,4 %) gegenüber dem
Jahresende 2024 entspricht. Am stärksten stiegen
die Schulden gegenüber dem Jahresende 2024
prozentual in Sachsen (+16,5 %), Sachsen-Anhalt
(+11,2 %) und Niedersachsen (+6,8 %).
In
Sachsen ist der Anstieg auf einen erhöhten
Aufnahmebedarf und anstehende Refinanzierungen
von Landesschatzanweisungen zurückzuführen. In
Niedersachsen ergibt sich aufgrund
buchhalterischer Arbeiten im Rahmen des
Jahresabschlusses im 1. Quartal ein Anstieg der
Verschuldung, der im Laufe des Jahres durch
planmäßige Tilgungen wieder reduziert wird.
Der stärkste Schuldenrückgang gegenüber dem
Jahresende 2024 wurde für Rheinland-Pfalz mit
-2,6 % ermittelt. Hier waren übliche
unterjährige Liquiditätsentwicklungen für den
Rückgang verantwortlich. Auch in Brandenburg
(-0,8 %) und Mecklenburg-Vorpommern (-0,8 %)
sind die Schulden prozentual stärker gesunken.
Schulden der Gemeinden und
Gemeindeverbände wachsen um 3,0 %
Auch bei
den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die
Verschuldung zum Ende des 1. Quartals 2025
gegenüber dem Jahresende 2024 zu. Sie stieg um
5,0 Milliarden Euro (+3,0 %) auf
174,4 Milliarden Euro. D
en höchsten
prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem
Jahresende 2024 wiesen dabei die Gemeinden und
Gemeindeverbände in Schleswig-Holstein (+6,0 %)
auf, gefolgt von Bayern (+5,2 %) und
Niedersachsen (+4,9 %). Einen Rückgang der
Verschuldung gab es lediglich in Thüringen
(-0,1 %). Die Verschuldung der
Sozialversicherung sank im 1. Quartal 2025
gegenüber dem Jahresende 2024 um
0,5 Millionen Euro (-1,3 %) auf
38,2 Millionen Euro.
474 700
untergebrachte wohnungslose Personen Ende Januar
2025 in Deutschland
• 41 % der
untergebrachten wohnungslosen Personen jünger
als 25 Jahre
• 29 % kommen aus der Ukraine •
Nach Haushaltskonstellation bilden Paare mit
Kindern mit gut 34 % die größte Gruppe unter den
untergebrachten wohnungslosen Personen
Zum Stichtag 31. Januar 2025 waren in
Deutschland nach den Meldungen von Kommunen und
Einrichtungen rund 474 700 Personen wegen
Wohnungslosigkeit untergebracht. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat
sich damit die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 8 %
erhöht (2024: 439 500). Der Anstieg ist
vermutlich auf Verbesserungen der Datenmeldungen
im vierten Jahr seit der Einführung der
Statistik zurückzuführen.
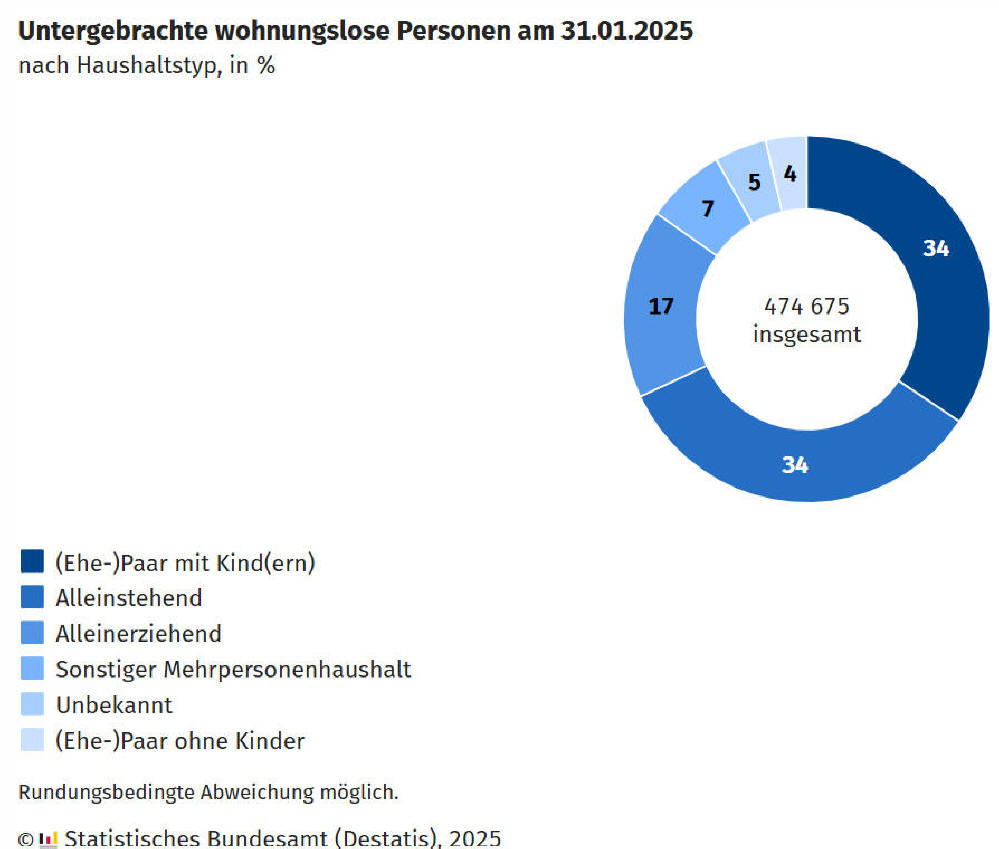
Die Statistik erfasst wohnungslose Personen,
die in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar
2025 beispielsweise in überlassenem Wohnraum,
Sammelunterkünften oder Einrichtungen für
Wohnungslose untergebracht waren. Obdachlose
Personen, die ohne jede Unterkunft auf der
Straße leben sowie Formen von verdeckter
Wohnungslosigkeit (zum Beispiel bei Bekannten
oder Angehörigen untergekommene Personen) werden
nicht in der Statistik berücksichtigt, sind aber
Teil der begleitenden
Wohnungslosenberichterstattung, die alle
zwei Jahre vom Bundesministerium für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen durchgeführt wird.
137 800 untergebrachte Personen kommen
aus der Ukraine Schutzsuchende aus der Ukraine
stellen zwar nach wie vor die größte Gruppe
(29 %) innerhalb der Statistik dar, jedoch fiel
der Anstieg nicht so stark aus wie in den
vergangenen Jahren. Zum Stichtag 31. Januar 2025
wurden 137 800 geflüchtete Ukrainerinnen
und Ukrainer in der Statistik erfasst (2024:
136 900).
Insgesamt wurden 409 000
Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
gemeldet (2024: 377 900), ihr Anteil an allen
untergebrachten wohnungslosen Personen liegt wie
im Vorjahr bei 86 % (2024: 86 %). Der Anteil von
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit liegt
mit 65 700 Personen (2024: 61 500) weiterhin bei
rund 14 %.
Untergebrachte Wohnungslose
sind zu 41 % unter 25 Jahre alt und mehrheitlich
Männer
41 % der gemeldeten Personen waren
jünger als 25 Jahre (2024: 40 %). Der Anteil der
Personen im Alter ab 65 Jahren blieb mit rund
5 % unverändert gegenüber dem Vorjahr. Im
Durchschnitt waren die am Stichtag 31. Januar
2025 untergebrachten Personen 31 Jahre alt. 56 %
der untergebrachten wohnungslosen Personen waren
Männer und rund 42 % Frauen (2024: 55 % Männer
und 43 % Frauen).
Für 2 % der Fälle
wurde das Geschlecht mit "unbekannt“ angegeben.
Paare mit Kindern und Alleinstehende am
häufigsten untergebracht Die wohnungslosen
Personen sind in verschiedenen Haushalts-
beziehungsweise Familienkonstellationen
untergebracht. Personen in Paarhaushalten mit
Kindern bildeten mit 163 400 Personen (gut 34 %)
die größte Gruppe.
Fast ebenso viele
Personen (159 800 oder knapp 34 %) waren
alleinstehend, knapp 17 % oder 79 000 Personen
waren in Alleinerziehenden-Haushalten, 7 % oder
33 400 Personen in sonstigen
Mehrpersonenhaushalten und 4 % beziehungsweise
17 300 Personen in Paarhaushalten ohne Kinder
untergebracht. Bei 21 800 Personen (4 %) war der
Haushaltstyp unbekannt.
117 900
untergebrachte Wohnungslose in
Nordrhein-Westfalen
Im Bundesländervergleich
waren im bevölkerungsreichsten Land
Nordrhein-Westfalen mit 117 900 Personen die
meisten Personen wegen Wohnungslosigkeit
untergebracht, gefolgt von Baden-Württemberg mit
94 600 Personen und Berlin mit 53 600 Personen.
Am wenigsten untergebrachte Wohnungslose wurden
in Thüringen (3 000), Sachsen-Anhalt (1 200) und
Mecklenburg-Vorpommern (700 Personen) gemeldet.
Mittwoch, 9. Juli 2025
Großes Casting: 4.000 Komparsen für "Tribute
von Panem" gesucht
Duisburg/Köln
(idr) - Für die Verfilmung der Vorgeschichte der
Blockbuster-Reihe "Die Tribute von Panem" werden
in NRW rund 4.000 Komparsen gesucht. Die
Dreharbeiten für den Film "The Hunger Games:
Sunrise on the Reaping" (deutscher Titel:
"Tribute von Panem L – Der Tag bricht an")
finden von Ende August bis Anfang Oktober in den
Großräumen Duisburg und Köln statt.
Zum
Cast gehören Hollywoodstars wie Glenn Close,
Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes,
Mckenna Grace und Kelvin Harrison Jr. Die
Agentur Eick & Weber lädt dafür zu einem
Onlinecasting ein. Bewerbungsschluss ist der 17.
September.
Eingeladen sind Interessierte
aller Ethnizitäten, Herkunftsländer,
Geschlechter und Altersgruppen bis 80 Jahren.
Gefragt sind u. a. explizit "Menschen mit
versehrten, vom Leben gezeichneten Körpern (z.
B. mit auffälligen Narben, Amputationen,
Handicaps)".
Offensichtlich gefärbte
oder gesträhnte Haare, Permanent-Make-up,
Lip-Filler, Solariumsbräune, feste Zahnspangen,
Piercings und Tattoos an sichtbaren
Körperstellen sind hingegen nicht erwünscht.
Wichtige Infos & Termine: Kostümprobe im
Großraum Duisburg (1 Termin, ca. 3 Stunden):
Mitte August bis Mitte September 2025
Drehzeitraum: Ende August bis Anfang Oktober
2025 (1–8 Drehtage pro Person möglich)
An
folgenden sechs Tagen in Duisburg brauchen wir
besonders viele Kinder, Jugendliche und
Erwachsene: Do, 18.09. + Fr, 19.09. + Mo, 22.09.
+ Di, 23.09. + Mi, 24.09. + Do, 25.09. (in
Duisburg)
Drehorte: Großräume Duisburg und
Köln Bewerbungsstart: Ab sofort - die Besetzung
hat bereits begonnen Bewerbungsschluss:
17.09.2025
Letzter Besetzungstag:
21.09.2025 (Wer bis dahin keine Rückmeldung
erhalten hat, ist leider nicht dabei.)
Die
Produktion sucht: Männer, Frauen und sehr viele
Kinder aller Nationen zwischen 0 bis 80 Jahre
Menschen mit versehrten, vom Leben gezeichneten
Körpern (z. B. mit auffälligen Narben,
Amputationen, Handicaps) Männer und Frauen mit
militärischer Grundausbildung (Polizisten,
Soldaten etc.) Babys chinesischstämmige Personen
(gerne ganze Familien) Stand-Ins / Licht-Doubles
- Infos.
https://casting-panem.de
Dinslaken: Lippeverband zu Blaualgen im
Rotbachsee
Der Lippeverband rechnet mit besorgniserregender
Ausbreitung bis September. Der Verdacht auf
Blaualgen im Rotbachsee hat sich bestätigt. Der
Lippeverband hat rund um den Rotbachsee
Warnschilder aufgestellt. Der
Wasserwirtschaftsverband warnt
Spaziergänger*innen vor Kontakt mit dem
Seewasser. Ebenso sollten Hunde nicht aus dem
Rotbachsee trinken oder darin baden.
Grund für eine besorgniserregende Ausbreitung
der Blaualge könnte die anhaltende Hitze in dem
stehenden Gewässer sein. Der Lippeverband geht
davon aus, dass der See noch bis September mit
den gesundheitsschädlichen Bakterien befallen
sein wird – für einen Rückgang der Blaualgen im
See müssen die Temperaturen unter zwölf Grad
sinken.
Anders als der Name es vermuten
lässt, handelt es sich bei der Blaualge weder um
eine Alge noch ist sie blau. Es sind Bakterien
(Cyanobakterien), die einen eher grünlichen
Teppich auf den Gewässern bilden. Bei einer
normalen Konzentration sind Blaualgen
ungefährlich. Das ändert sich aber, wenn sie
sich stark vermehren.
Blaualgen können
bei Menschen zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Hautreizungen, geröteten Augen und Atemnot
führen. In Seen mit auffälligem Algenwachstum
sollte nicht gebadet werden. Insbesondere bei
kleinen Kindern sollte man kein Risiko eingehen.
Hunde sind ebenso gefährdet und sollten
keinesfalls in Kontakt mit dem Wasser aus dem
Dinslakener See kommen.
Der Lippeverband
weist weiterhin darauf hin, dass die Fütterung
von Fischen und Wasservögeln das Wachstum der
Algen begünstigt. Daher sollten Bürger*innen
besonders in den Sommermonaten darauf
verzichten.
Der Lippeverband
Der
Lippeverband ist ein öffentlich-rechtliches
Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee
des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip
lebt. Seine Aufgaben sind in erster Linie die
Abwasserentsorgung und -reinigung,
Hochwasserschutz durch Deiche und Pumpwerke und
die Gewässerunterhaltung und -entwicklung.
Dazu gehört auch die ökologische
Verbesserung technisch ausgebauter Nebenläufe.
Darüber hinaus kümmert sich der Lippeverband in
enger Abstimmung mit dem Land NRW um die
Renaturierung der Lippe. Dem Lippeverband
gehören zurzeit 155 Kommunen und Unternehmen als
Mitglieder an, die mit ihren Beiträgen die
Verbandsaufgaben finanzieren.
„Zeugnis-Telefon" der Bezirksregierung
Düsseldorf
Am Freitag, 11.07.2025, erhalten viele
Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse. Aus
diesem Anlass bietet die Bezirksregierung
Düsseldorf - neben den Sorgentelefonen von
Städten und sozialen Einrichtungen - wieder ein
Zeugnis-Telefon an. Eltern sowie Schülerinnen
und Schüler können dort vor allem rechtliche
Fragen klären, etwa wenn sie die Notengebung für
ungerecht halten oder Fragen zur Schullaufbahn
haben.
Das Zeugnistelefon zu Fragen aus
den Schulformen Realschule, Gymnasium,
Gesamtschule, Sekundarschule und
Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg ist unter
der Rufnummer 0211 475-4002 an folgenden Tagen
erreichbar:
Freitag, 11.07.2025
Montag,
14.07.2025
Dienstag, 15.07.2025 jeweils von
10:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr
Zu Fragen aus den Schulformen
Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist
das Zeugnistelefon der Bezirksregierung bei den
jeweiligen Schulämtern der zehn kreisfreien
Städte sowie der fünf Kreise im Regierungsbezirk
Düsseldorf eingerichtet. Diese sind zu den
vorgenannten Zeiten unter folgenden Rufnummern
zu erreichen:
Kreis Wesel: 0281 207-2212
Kreis Kleve: 02821 85-496
Dinslaken: „Wir schaffen gemeinsam eine neue
KiTa“ – Baubeginn am Edithweg am 21. Juli
Die Stadt Dinslaken investiert in die Zukunft
unserer Kinder: Am 21. Juli 2025 beginnen die
Bauarbeiten für den Neubau einer modernen,
fünfgruppigen Kindertagesstätte am Edithweg.
"Eine hochwertige und pädagogisch wertvolle
Betreuung zu schaffen ist ein zentrales Anliegen
– dafür braucht es gut ausgestattete,
kindgerechte Räume und sichere Spielbereiche",
so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.
Der
Neubau wird diesem Anspruch gerecht und schafft
dringend benötigte Plätze in einem Umfeld, das
Entwicklung und Geborgenheit gleichermaßen
fördert.
Verantwortliche Projektsteuerung
Mit der Planung und Umsetzung des Projekts
ist die städtische Tochtergesellschaft ProZent
GmbH beauftragt. Sie begleitet die Maßnahme von
der Planung bis zur Realisierung und koordiniert
alle beteiligten Fachplanungen und Bauphasen.
ProZent GmbH Projektentwicklungsgesellschaft
der Stadt Dinslaken Stollenstraße 1, 46537
Dinslaken Telefon: 02064 / 970 29 0 E-Mail:
prozent@dinslaken.de
Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld der
Baustelle
Während der Bauphase kommt es in
Teilbereichen der Hedwigstraße, Edithweg und
Annettenweg zu Verkehrseinschränkungen und
temporären Sperrungen, die auch Teile
angrenzender Stellplatzflächen betreffen werden.
Aufgrund der sehr beengten örtlichen
Verhältnisse ist eine Durchführung und
Bestückung der Baustelle ohne solche Maßnahmen
leider nicht möglich.
Die Stadt wird die
Einschränkungen für die Anwohnerschaft so gering
wie möglich zu halten, bittet aber um
Verständnis dafür, dass die bauliche Umsetzung
keine andere Verkehrsführung zulässt. Ein
Verkehrslenkungsplan wird vorbereitet und die
entsprechenden Beschilderungen durch die Firma
VT Ripkens bis zum 21. Juli 2025 umgesetzt.
Geplanter Bauablauf:
- Start der
Baumaßnahme am 21. Juli 2025: ca. 4 Wochen
Entkernung
- Anschließend ca. 6 Wochen
Abbrucharbeiten
- Ab Herbst erfolgt der
Rohbau Beweissicherung zur Wahrung von
Eigentumsinteressen
Zur Absicherung der
umliegenden Wohnbereiche wird das Essener Büro
Löschmann + Schneider in den kommenden Wochen
eine Beweissicherung der Straßenränder der
geplanten Wegeführung zur Belieferung der
Baustelle der Hedwigstraße, des Edithwegs und
Annettenwegs durchführen. Die betroffenen
Anwohnenden werden hierzu gesondert informiert.
Wir bauen für die Zukunft – mit Ihrer
Unterstützung!
Dieses Projekt ist ein
wichtiger Schritt für die soziale Infrastruktur
in Dinslaken. Wir schaffen gemeinsam eine tolle
neue KiTa, von der viele Familien im Stadtteil
und auch im Stadtgebiet profitieren werden. Die
Stadtverwaltung dankt allen Menschen in
Dinslaken für ihr Verständnis, ihre Mitwirkung
und Unterstützung in der Zeit der Bauarbeiten.
Wesel: Eröffnung der
Trendsportanlage am Auesee
Im Sportentwicklungsplan der Stadt Wesel wurde
als Ziel festgelegt, die Aue als Standort für
den Freizeitsport zu stärken und den Auesee
weiter zu attraktiveren. So wurde bereits im
Jahr 2020 der Spielplatz am Auesee eröffnet,
gefestigte neue Wegeverbindungen sind auf der
Aueseewiese entstanden und im Jahr 2022 ist der
Minigolfplatz an den Auesee verlegt worden.

Vor wenigen Tagen wurde feierlich der neue
Skate- und Bike-Park eröffnet. Nun folgte die
Eröffnung der neuen Trendsportanlage, die einen
weiteren wichtigen Baustein für den Freizeit-
und Naherholungsbereich Aue-Park markiert. Der
Rat hat im Jahre 2022 beschlossen, eine
Trendsportanlage am Standort im südöstlichen
Bereich der Liegewiese (nahe der
Beachvolleyballanlage) zu errichten.
Mit
der Gesamtplanung wurde das Büro B.S.L.
Landschaftsarchitekten aus Soest beauftragt. Die
Baumaßnahme wurde durch die Fa. Langenfurth
Umwelt GmbH aus Voerde-Spellen durchgeführt. Im
Jahr 2022 wurde auf Initiative der Verwaltung
ein Bürgerbeteiligungsverfahren (vor Ort und
Online) zur Trendsportanlage durchgeführt.
Über 1300 Personen beteiligten sich daran.
Das Planungsbüro hat die Vorschläge ausgewertet
und für die Trendsportanlage eine
Calisthenics-Anlage, einen Boulder-Bereich sowie
ein Multifunktionsspielfeld mit Basketballkörben
und Fußballtoren planerisch umgesetzt.
Street Food & Beach Festival Moers 2025
Die „Street Food & Beach Festivals“ bieten den
Besuchern ein unvergleichliches karibisches
Urlaubsflair mit feinem Sandstrand, vielfältigem
Street Food, Palmen und mitreißender Live-Musik.
Die gelungene Kombination aus
abwechslungsreicher Live-Musik, entspannter
Strandatmosphäre, familienfreundlichem
Rahmenprogramm und außergewöhnlichem Street Food
macht den Festivalbesuch perfekt.
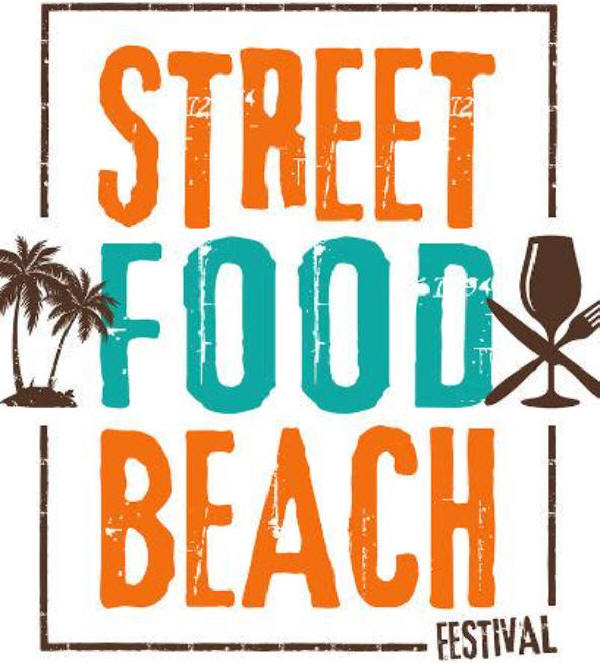
Der Eintritt zu den „Street Food & Beach
Festivals“ ist frei und die Standorte liegen
zentral in der Innenstadt. Dies trägt zur
Belebung der Innenstädte und zur Zufriedenheit
der Bürger bei. Erstklassiges Street Food,
erfrischende Cocktails und mitreißende
Live-Musik bieten ein wahres Festivalempfinden.
Die nachgestellte Strandlandschaft mit
gemütlichen Sitzgelegenheiten und lebendiger
Dekoration schafft die ideale Atmosphäre zum
Genießen und Verweilen. Mit einem
abwechslungsreichem Rahmenprogram und einer
breiten musikalischen Palette von DJs,
Solokünstlern und Live-Bands wird das Festival
zu einem Ereignis für die gesamte Familie.
Veranstaltungsdatum 10.07.2025 - 17:00
Uhr - 13.07.2025 - 20:00 Uhr Veranstaltungsort
Kastellplatz. 47441 Moers .
Neues
Booklet: „Frauenstimmen – Leben und Arbeiten am
Niederrhein“
Frauen stärken – Region stärken:
Der Zonta Club Niederrhein veröffentlicht ein
praxisnahes Booklet für Frauen, die sich auf dem
niederrheinischen Arbeitsmarkt orientieren und
Unternehmen, die Fachkräfte suchen. Mitgewirkt
haben etwa 100 berufstätige Frauen und
Fachleute.
Das Besondere: Das Booklet
steht kostenfrei zum Download bereit und darf
ausdrücklich von Unternehmen, Institutionen und
Netzwerken auf deren Websites eingebunden
werden. So profitieren nicht nur Frauen, sondern
auch Betriebe von der Reichweite und Wirkung für
potenzielle Bewerberinnen.
Der Leiter
der EntwicklungsAgentur Wirtschaft des Kreises
Wesel, Lukas Hähnel, begrüßt die Fertigstellung
des Booklets. Damit kann ein zielführender
Beitrag für die Gewinnung weiblicher Fachkräfte
für unsere innovative Region Niederrhein Kreis
Wesel, den Kreis Kleve und Duisburg geleistet
werden.
Die Leiterin der Fachstelle Frau
und Beruf des Kreises Wesel, Stefanie Werner,
betont dazu, wie wichtig es ist, dass es
weibliche Vorbilder für die vielfältigen
Berufsbilder im Kreisgebiet wie u.a. im
Baugewerbe, Handwerk, Tourismus, und in der
Wissenschaft gibt und dass sie sichtbar werden.
Sie tragen dazu bei, dass berufliche
Orientierung vielfältiger wird.
Vor dem
Hintergrund, dass gerade in den weiblich oder
auch männlich dominierten Berufen der
Fachkräftemangel besonders eklatant ist, sollte
diese Entwicklung in den Blick genommen werden.
Der Zonta Club Niederrhein (ZCN) präsentierte
bei der Niederrheinischen IHK das neue Booklet
„Frauenstimmen – Leben und Arbeiten am
Niederrhein“ - ein Gemeinschaftsprojekt mit
Partnerinnen und Partnern aus Arbeitsmarkt,
Gleichstellung und Wirtschaft aus dem Kreis
Wesel, dem Kreis Kleve und der Stadt Duisburg.

v.l.n.r: Judith Hemeier, IHK Niederrhein; Yvonne
Tertilte-Rübo, Gleichstellungsbeauftragte Stadt
Kleve; Elisabeth Koal,
Gleichstellungsbeauftragte Stadt Duisburg;
Stefanie Werner, Fachstelle Frau und Beruf Kreis
Wesel; Mechtild Janßen, Zonta Club Niederrhein;
Magdalena Kowalczyk, Kompetenzzentrum Frau und
Beruf Niederrhein "Competentia" (Bettina
Engel-Albustin, Fotoagentur Ruhr moers)
Auf über 110 Seiten zeigt es authentisch,
vielfältig und inspirierend, wie berufstätige
Frauen ihre Region erleben, wo sie Rat finden
und die passenden Netzwerke – und zeigt damit
auch Unternehmen, wie sie gezielt weibliche
Fachkräfte gewinnen können. WDR-Moderatorin
Steffi Neu unterstützte das Projekt aktiv im
Workshop mit Journalistinnen.

rechts im Bild, Sara Heynen, Firma Röchling
Industrials Xanten GmbH, mittig im Bild: Sabrina
Engelhardt, Firma Röchling Industrial Xanten
GmbH, Interviewpartnerinnen für den Kreis
Wesel/Fachstelle Frau und Beruf (Bettina
Engel-Albustin, Fotoagentur Ruhr moers)
„Machen statt abwarten – Schneller sein. Lasse
dich nur auf das Konstruktive ein“, ist einer
der Appelle an Frauen für mehr Sichtbarkeit.
Gemeinsam für Karrierechancen – gemeinsam für
den Niederrhein Das Booklet „Frauenstimmen –
Leben und Arbeiten am Niederrhein“ ist ab sofort
verfügbar unter:
https://www.zonta-niederrhein.de/aktivitaeten/
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der
Fachstelle Frau und Beruf, EntwicklungsAgentur
Wirtschaft Kreis Wesel per Mail an
frau-und-beruf@kreis-wese.de oder telefonisch
unter 0281 207-2022.
„Wie ist
es, ein Bürgermeister zu sein?“
‚Was
macht eigentlich…` lautet der Titel einer
Projektgruppe unter Leitung von Andrea Klaffki
(1. v. r.) von der Caritas Moers - Xanten. Am
Mittwoch, 2. Juli, wurde der Halbsatz
vervollständigt durch ‚… ein Bürgermeister?‘.
Und so wollten 25 Kinder im Rahmen der
Projektwoche ‚Vielfalt‘ der St.
Marien-Grundschule z. B. wissen: „Wie ist es,
ein Bürgermeister zu sein?“ (Antwort: „Super,
ich bin gerne Bürgermeister!“), „Wann beginnt
der Arbeitstag?“ („Zu Hause gegen 7.30 Uhr mit
den ersten E-Mails.“) oder „Was ist das Beste,
was du als Bürgermeister gemacht hast?“.

Foto: pst
Hier holte Christoph
Fleischhauer etwas aus und berichtete von einem
seiner ‚Herzensprojekte‘ – das Pflanzen von mehr
als 400 Bäumen pro Jahr. Seine Idee hat auch die
Politik aufgegriffen und entschieden.
In
diesem Zusammenhang konnte er dann die Frage
nach seiner „Macht“ erklären. Die liege nämlich
– anders als viele vermuteten – beim Rat der
Stadt Moers. Zum Abschluss zeigte das Moerser
Stadtoberhaupt der wissbegierigen Gruppe noch
den Ratssaal.
Moerser
Stadtteilhäppchen - Altstadt
- ein nicht nur kulinarischer Spaziergang
Bei Einkehr und Rundgang durch die Altstadt
erfahren Sie Interessantes über die
Stadtgeschichte. Zum Thema Kakao verkosten wir
Schokolade. Aber auch Stationen mit herzhafte
Häppchen fehlen nicht.

Geführt von Renate Brings Otremba.
Treffpunkt: Steinstraße
am ENNI-Mann Kosten: 34,20 Euro für Führung und
Häppchen
Weitere Infos zu den Stadtführungen.
Veranstaltungsdatum 12.07.2025 - 10:00
Uhr - 15:30 Uhr Veranstaltungsort Steinstraße 49
47441 Moers Veranstaltungsort Am Enni-Mann.
Schwafheimer Waldfest
Veranstaltungsdatum 12.07.2025 - 16:00
Uhr - 13.07.2025 - 18:00 Uhr Veranstaltungsort
Bolzplatz an der Dorfstraße / 47447 Moers
.Veranstalter AGS Schwafheimer Kirmes GbR.
Adresse Siedweg 49, 47447 Moers.
Vinyltreff
Monatlicher Schallplattenbasar am Niederrhein im
Gewerbegebiet Moers-Hülsdonk für alle
diejenigen, die die guten alten Schallplatten zu
schätzten wissen. Das Vinylgestöber findet bei
freiem Eintritt für Besucher statt. Kostenfreie
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Die Räumlichkeiten sind barrierefrei.
Veranstaltungsdatum 12.07.2025 - 10:00
Uhr -15:00 Uhr. Veranstaltungsort MUSIC & MORE,
Adresse Am Schürmannshütt 26, 47441
Moers-Hülsdonk
Routen-Tipps:
Immer am Wasser entlang
Ob historische Wassermühlen oder Badeparadies –
viele Strecken bieten sich gerade im Sommer an.
Eine leicht kühlende Brise auf der Haut und
leises Plätschern im Ohr – was könnte es
Schöneres geben? Sommererlebnisse dieser Art
bietet der Niederrhein dank seiner einmaligen
Wasserlandschaften.
Eine schöne Tour für
Rad-Fans ist zum Beispiel die
„Wachtendonker-Wasser-Weite“. Sie führt durch
die idyllische Niersgemeinde und die Umgebung.
Immer eine längere Pause wert ist der
historische Ortskern von Wachtendonk mit seiner
seit Mitte des 16. Jahrhunderts verbürgten
Straßenführung, zahlreichen herausragende
Einzelbauten der Zeit vor dem letzten großen
Stadtbrand von 1708 und der nahezu vollständigen
Erhaltung einer geschlossenen Dorfsiedlung des
17. und 18. Jahrhunderts.
Absteigen
lohnt sich auch an der Abtei Mariendonk auf
Grefrather Gemeindegebiet. Das in die
niederrheinische Landschaft eingebettete Kloster
ist ein beliebtes Fotomotiv. Eine erfrischende
Abkühlung bietet die „Blaue Lagune“: Das
ehemalige Baggerloch ist ein bekanntes
Badeparadies mit Wasserskianlage und
Hochseilgarten.
Mit einer Länge von etwa
20 Kilometern und einer Dauer von knapp 90
Minuten (ohne längere Pausen) ist die
„Wachtendonker-Wasser-Weite“ auch für Familien
mit Kindern gut geeignet. Ein bisschen länger
ist die „Wegberger Wassermühlentour“ (rund 28
Kilometer, etwa zwei Stunden). Sie vermittelt
einen wunderbaren Überblick über die Wahrzeichen
Wegbergs – die historischen Mühlen.
Am
Flüsschen Schwalm standen ursprünglich 25
Mühlen. Hinzu kamen weitere 15 an den
Nebenbächen – ein wahrer Mühlenreichtum. Heute
gibt es noch sieben an der Schwalm und vier an
deren Nebenbächen. Einige davon sind
Anlaufpunkte dieser Route.
Zu ihnen
zählt die Bischofsmühle, die 1572 erstmals
urkundlich erwähnt wurde. Das Wasserrad ist noch
gut erhalten. Ein imposanter Anblick ist Schloss
Tüschenbroich, an dem sich die gleichnamige
Ölmühle findet. Auch die Holtmühle, um ein
weiteres Beispiel zu nennen, lädt mit ihrem
großen vorgelagerten Weiher zu einer Rast ein.
Übrigens: Die Orientierung ist denkbar
einfach, denn die Tour führt in großen Teilen
über das bewährte Knotenpunktsystem des
Heinsberger Landes. Hier ist also „Radeln nach
Zahlen“ angesagt. Auch viele andere Strecken in
der Region ermöglichen wunderbare
Wasser-Erlebnisse.
Zu den beliebten
Klassikern zählt unter anderem der
Niers-Radwanderweg, der Niederrhein-Feeling pur
bietet: weite Wiesen und Felder, Pappeln und
Kopfweiden. Gleich drei Flüsse auf einmal –
nämlich Rhein, Issel und Lippe – vereint eine
Tour, die Hamminkeln, Hünxe, Raesfeld, Rees,
Schermbeck, Voerde und Wesel verbindet.
Ein herrliches Stück Europa ist auf dem
RurUfer-Radweg zu erleben: Von der Quelle in
Belgien geht es über den Niederrhein bis zur
Mündung im niederländischen Roermond.
Ein weiteres Highlight ist der
Niederrhein-Abschnitt des Rheinradwegs, der
insgesamt von den Schweizer Alpen bis zur
Nordsee führt. Weitere Inspirationen und Tipps
gibt es hier:
https://www.niederrhein-tourismus.de/sehen-erleben/radfahren

Ein wunderschönes Ensemble bilden Schloss
Tüschenbroich und die Mühle. Die Schlossanlage
liegt bei dem Dorf Tüschenbroich, etwa 25 km
westlich von Mönchengladbach im Quellgebiet der
Schwalm. Foto: Patrick Gawandtka
Hauseigentümer zweifeln an Klimaneutralität
2045: Fehlende Verbindung zwischen Politik und
Alltag bremst Wärmewende
- Jeder zweite Befragte glaubt nicht mehr daran,
dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird
- 92 % befürworten den Ausbau erneuerbarer
Energien, doch hohe Kosten, Unsicherheiten und
komplexe Förderprogramme bremsen Investitionen.
- Hauseigentümer wünschen sich verständliche
Informationen, individuelle Beratung und eine
digitale, vereinfachte Förderlandschaft

Quelle: co2online, Marc Beckmann
Die
gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online
hat im Juni fast 3.800 ihrer
Newsletter-Abonnenten, darunter 80 Prozent
Hauseigentümer, zur Energie- und Wärmewende in
Deutschland befragt. Jeder Zweite von ihnen
glaubt aktuell nicht mehr daran, dass
Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral
werden kann.
Ziele der Politik und
persönliche Ziele driften gefühlt auseinander
Persönliche Beweggründe wie Gesundheit,
Lebensqualität oder Kostenersparnis scheinen aus
Sicht der Hauseigentümer bei der politischen
Umsetzung der Wärmewende nur eine untergeordnete
Rolle zu spielen.
Stattdessen wird als
Hauptantrieb der Politik häufig eine
übergeordnete, globale Motivation vermutet, etwa
die Einhaltung internationaler
Klimaschutzabkommen, der Klimaschutz allgemein
oder die Energieunabhängigkeit. „Politische
Maßnahmen werden zunehmend nicht mehr mit der
persönlichen Lebensrealität in Verbindung
gebracht“, sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin
der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft
co2online. „Dies kann die Akzeptanz konkreter
Maßnahmen zur Wärmewende in der Bevölkerung
beeinträchtigen.“
Rückenwind für die
Wärmewende, aber auch Modernisierungshemmnisse
Die Umfrage zeigt aber auch, dass viele der
Befragten die Energie- und Wärmewende
unterstützen und auch selbst umsetzen. So finden
fast alle (92 Prozent) den Ausbau erneuerbarer
Energien in Deutschland wichtig und 87 Prozent
befürworten gesetzliche Vorgaben zum
Heizungstausch.
 
Fast zwei Drittel haben demnach bereits in
nachhaltige Technologien investiert. Zu hohe
Kosten, eine wahrgenommene Vollständigkeit und
unsichere Rahmenbedingungen halten weiterhin
viele Hauseigentümer davon ab, in die
Modernisierung ihres Hauses zu investieren.


Wechselnde Förderprogramme, unklare
Gesetzeslagen und politische Debatten
beeinflussen die Bereitschaft stark, weiter zu
investieren. Fördermittel zu kompliziert, aber
notwendig Auch wenn die Förderlandschaft in den
letzten Jahren angepasst und vermeintlich
vereinfacht wurde, empfinden 19 Prozent der
Befragten, die bereits Maßnahmen umgesetzt
haben, die Antragstellung nach wie vor als
kompliziert.
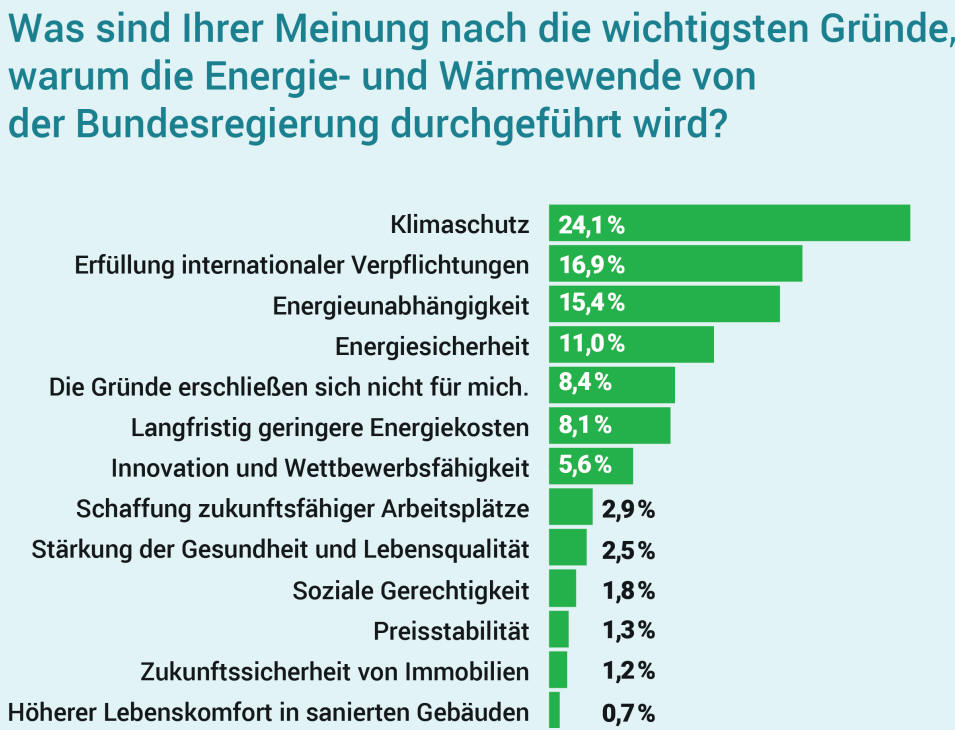
Für fast ein Drittel, die Maßnahmen planen,
ist aber ein positiver Förderbescheid Bedingung
für die Umsetzung. „Die Politik muss endlich
besser erklären, worin der konkrete Nutzen
politischer Maßnahmen besteht“, so Tanja Loitz.
„Kosten, Einsparungen und Fördermöglichkeiten zu
Modernisierungsmaßnahmen müssen ersichtlich und
leicht verständlich sein.
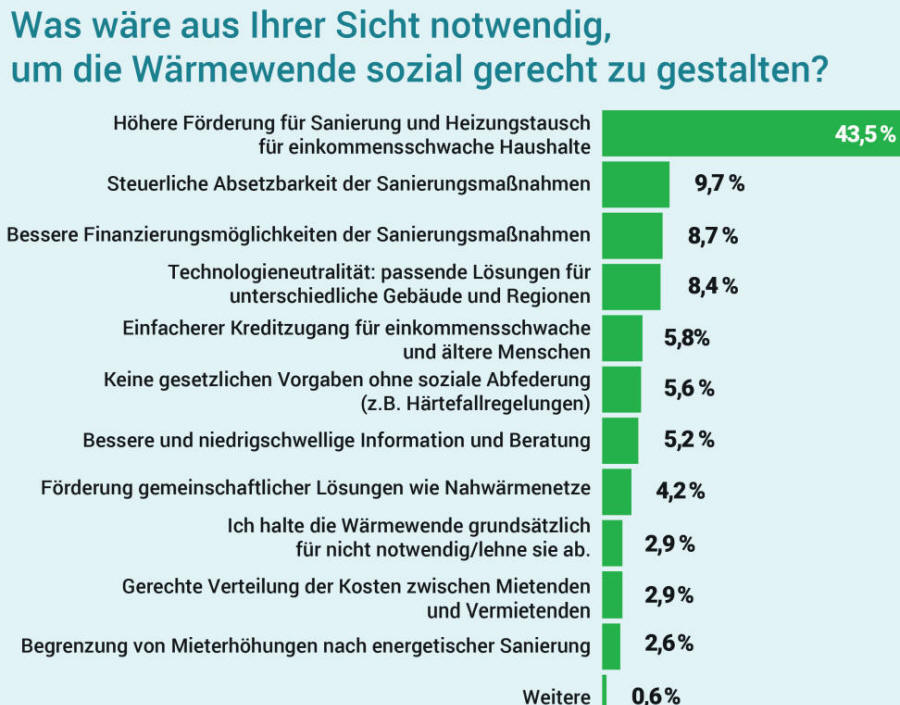
Individuelle und herstellerneutrale Beratungen
sorgen für hohe Zufriedenheit sowie
langfristigen Erfolg und gehören daher auf die
politische Agenda. Eine digitale, vereinfachte
und übersichtliche Förderlandschaft verstärkt
den Investitionsimpuls vieler Menschen.“
Über co2online Die gemeinnützige
Beratungsgesellschaft co2online
(www.co2online.de) steht für Klimaschutz, der
wirkt. Mehr als 50 Energie- und
Kommunikationsexperten machen sich seit 2003 mit
Kampagnen, Energierechnern und PraxisChecks
stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch
in privaten Haushalten auf ein Minimum zu
senken.
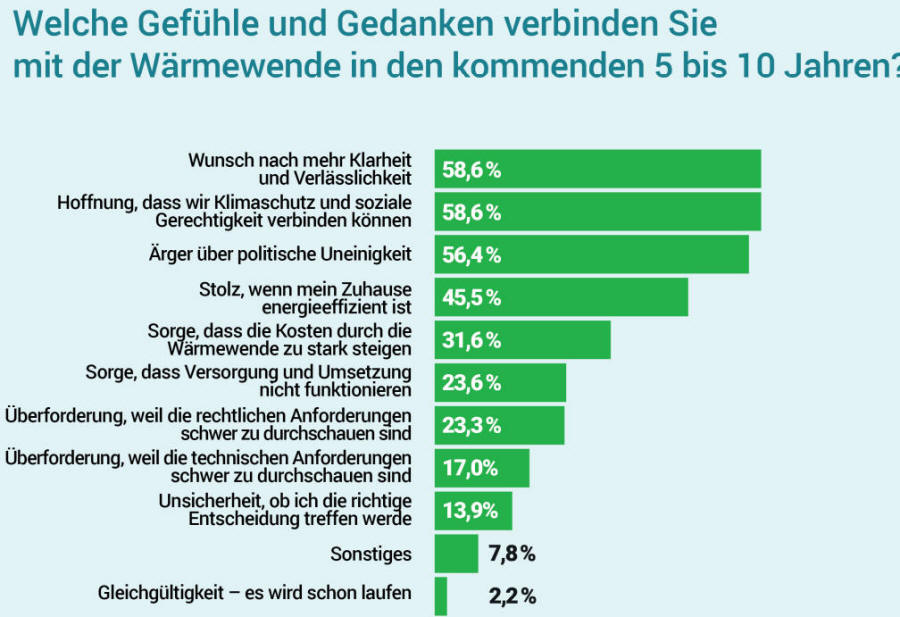
Die Handlungsimpulse, die diese Aktionen
auslösen, tragen messbar zur CO2-Minderung bei.
Im Fokus stehen Strom und Heizenergie in
Gebäuden, Modernisierung, Bau sowie Hilfe im
Umgang mit Fördermitteln. Unterstützt wird
co2online unter anderem vom
Bundesumweltministerium, dem Umweltbundesamt
sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.
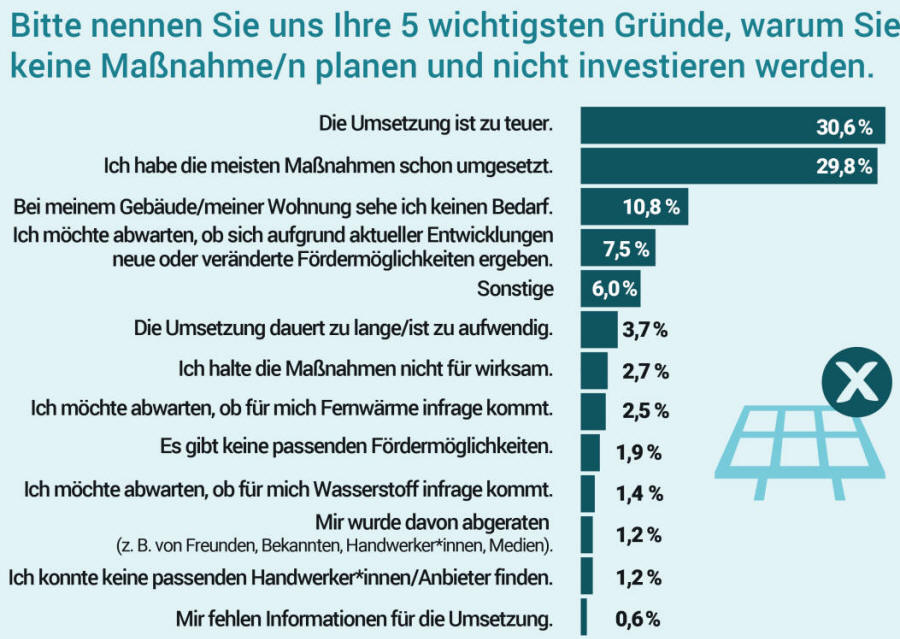

NRW: Baupreise für Wohngebäude im Mai 2025
um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen
* Wohngebäude: Preise für Rohbauarbeiten um
2,8 % gestiegen.
* Ausbaubauarbeiten an
Wohngebäuden verteuerten sich um 3,8 %.
*
Straßenbau bei allen Bauwerksarten mit höchstem
Preisanstieg.
Die Baupreise für
Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk) in
Nordrhein-Westfalen waren im Mai 2025 um 3,3 %
höher als ein Jahr zuvor. Wie Information und
Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt mitteilt, ist der Baupreisindex für
Wohngebäude im Vergleich zu Februar 2025 um
0,7 % gestiegen.
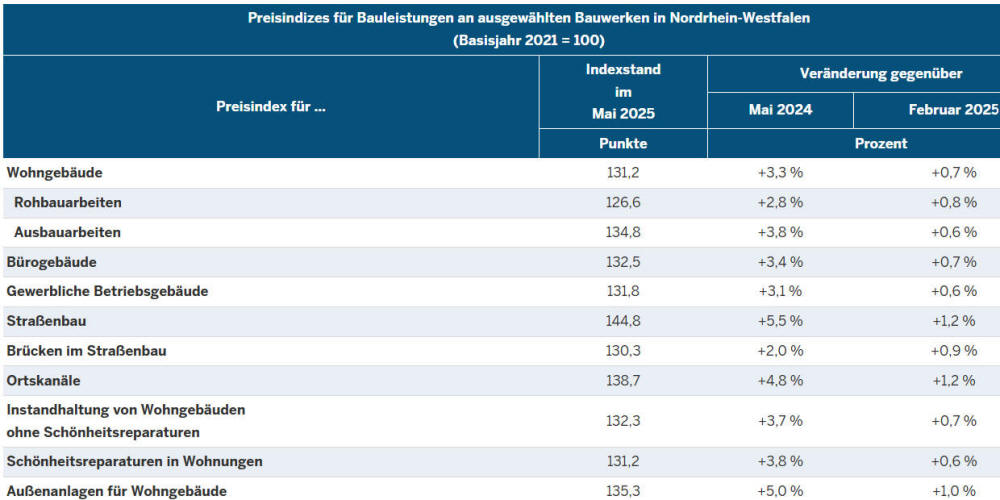
Rohbauarbeiten verteuerten sich um 2,8 %;
stärkster Anstieg im Bereich Gerüstarbeiten
Die Rohbauarbeiten für den Bau von Wohngebäuden
verteuerten sich im Mai 2025 gegenüber Mai 2024
um 2,8 %. Den stärksten Preisanstieg gegenüber
dem Vorjahresmonat gab es in diesem Bereich bei
Gerüstarbeiten mit 5,7 %, gefolgt von Zimmer-
und Holzbauarbeiten mit 5,2 % und den
Dachdeckungsarbeiten, die um 4,3 % stiegen.
Ausbauarbeiten um 3,8 % gestiegen;
Wärmedämm-Verbundsysteme mit
überdurchschnittlicher Preiserhöhung
Die
Preise für Ausbauarbeiten bei Wohngebäuden
stiegen im Mai 2025 gegenüber dem entsprechenden
Vorjahresmonat um 3,8 %. Betonwerksteinarbeiten
verzeichneten in diesem Bereich mit 10,7 % den
höchsten Preisanstieg. Eine
überdurchschnittliche Preiserhöhung von 8.4 %
wurde bei den Wärmedämm-Verbundsystemen
festgestellt.
Tapezierarbeiten
verteuerten sich um 7,9 %.
Die Preise für
Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und
Erdungsanlagen stiegen mit 0,5 % im gleichen
Zeitraum unterdurchschnittlich. Aufzugsanlagen
und Fahrtreppen waren 1,5 % günstiger als ein
Jahr zuvor.
Preise für weitere
Bauwerksarten
Der Straßenbau wies von allen
Bauwerksarten mit 5,5 % den höchsten
Preisanstieg zwischen Mai 2024 bis Mai 2025 auf.
Weiter verteuerten sich im genannten Zeitraum
auch die Preise für Außenanlagen für Wohngebäude
um 5,0 %. Die Preise für Ortskanäle stiegen um
4,8 % und für Schönheitsreparaturen in einer
Wohnung wurde ein Anstieg um 3,8 % festgestellt.
NRW: Zahl der
Anerkennungsverfahren ausländischer
Berufsabschlüsse innerhalb von 5 Jahren mehr als
verdoppelt
* Rund 21.500 Anträge auf Berufsanerkennung im
Jahr 2024 – 20,5 % mehr als ein Jahr zuvor.
* Stärkster Zuwachs bei Antragstellenden mit
Ausbildungsstaat Türkei.
* TOP 3: Pflege-,
Arzt- und Ingenieurberufe.
Die Zahl der
in NRW bearbeiteten Verfahren zur Anerkennung
von Berufsqualifikationen, die im Ausland
erworben wurden, hat sich gegenüber 2019 mehr
als verdoppelt. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, haben die zuständigen Stellen im Jahr
2024 insgesamt 21.567 Anerkennungsverfahren
bearbeitet.
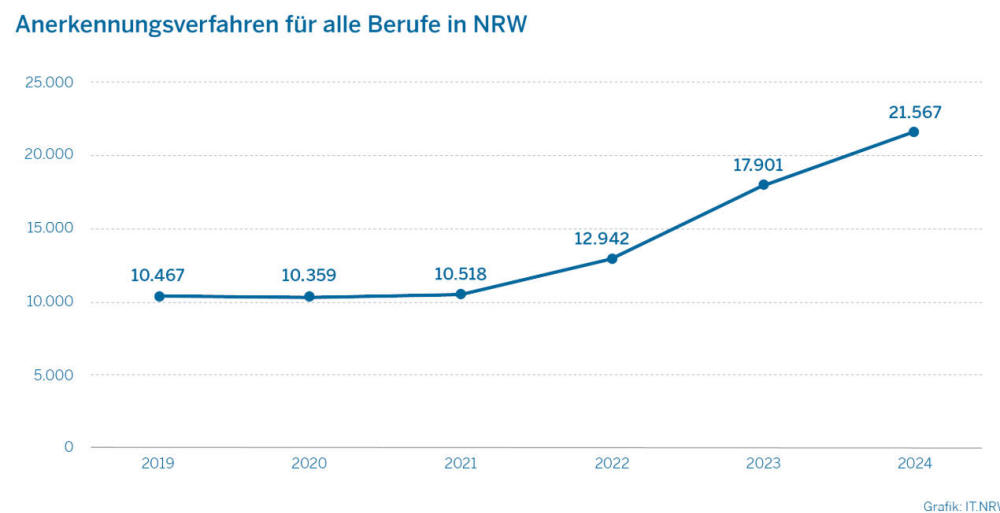
Vor fünf Jahren waren es 10.467 Anträge
gewesen. Seit 2020 ist die Zahl der
Anerkennungsverfahren jährlich gestiegen. 2024
war die Zahl der Anträge um 20,5 % höher als ein
Jahr zuvor, als 17.901 Verfahren bearbeitet
worden waren. In einem Anerkennungsverfahren
wird die Gleichwertigkeit zwischen einer im
Ausland erworbenen Berufsqualifikation und eines
deutschen Referenzberufes festgestellt.
Stärkster Zuwachs bei Antragstellenden aus dem
Ausbildungsstaat Türkei
Die meisten Anträge
auf Anerkennung wurden 2024 von Personen
gestellt, die ihre berufliche Qualifikation in
der Türkei erworben hatten: Mit 3.285
Anerkennungsverfahren gab es mehr als sieben Mal
so viele Anträge von Fachkräften aus der Türkei
wie vor fünf Jahren. Dahinter folgten
Antragstellende mit einer Berufsqualifikation
aus Syrien mit 2.088 Anträgen auf Anerkennung.
Ihre Zahl hat sich im Fünfjahresvergleich nahezu
verdoppelt (2019: 1.218).
Mit jeweils
über 1.400 Anerkennungsverfahren folgten
Antragstellende, die ihren Abschluss im Iran, in
Tunesien und in der Ukraine erworben hatten. Im
Fünfjahresvergleich ist die Zahl der
Anerkennungsverfahren aus diesen
Ausbildungsstaaten gestiegen: 2024 gab es mehr
als sechs Mal so viele Anträge aus der Ukraine,
fünf Mal so viele aus Tunesien und vier Mal so
viele aus dem Iran wie im Jahr 2019.
Die
meisten Anträge auf Anerkennung wurden von
Pflegefachkräften gestellt Wie ein Jahr zuvor
führte auch 2024 der Referenzberuf
Pflegefachkraft mit 7.968 bearbeiteten Anträgen
die Top-Liste der Berufe an, für die ein Antrag
auf Anerkennung gestellt wurde. Die meisten
Antragstellenden haben ihren Berufsabschluss als
Pflegefachkraft in der Türkei erworben (11,7 %
der Anträge).
Zum Referenzberuf
Pflegefachkraft zählen die Berufe
Pflegefachfrau/-mann sowie die Vorgängerberufe
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in,
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in sowie
Altenpfleger/-in. Auf Platz 2 folgte der
Referenzberuf Ärztin/Arzt mit 3.357
Anerkennungsverfahren. Davon wurde jede vierte
Berufsqualifikation in Syrien erworben. Mit
1.404 Anerkennungsverfahren folgte auf Platz 3
der Beruf Ingenieur/-in. Mehr als jeder vierte
Antrag für diesen Beruf wurde in der Ukraine
erworben.
Dienstag, 8. Juli 2025
Übung für Krisenstab und Einsatzleitung
Kreis Wesel
Der Krisenstab und die Einsatzleitung des
Kreises Wesel haben zahlreiche neue Mitglieder
gewinnen können, die im Fall einer Krise
mitarbeiten. Um den Ernstfall zu üben und die
Zusammenarbeit zu stärken, haben insgesamt rund
70 Personen an einer dreitägigen
Krisenstabsübung teilgenommen; neben
Mitarbeitenden der Kreisverwaltung gehörten auch
Mitglieder der Hilfsorganisationen im Kreis
dazu.
Die Übung wurde vom Institut der
Feuerwehr aus Münster geleitet. „Es ist wichtig,
den Ernstfall immer wieder zu proben und die
bestehenden Strukturen zu überprüfen und
gegebenenfalls anzupassen“, sagt Dr. Lars
Rentmeister, Vorstandsmitglied für Sicherheit
und Ordnung sowie Krisenstabsleiter.
„Bei Übungen dieser Art lernt man die handelnden
Personen kennen. Ich freue mich sehr, dass viele
neue Mitarbeitende aus der Verwaltung mit den
Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehren und der
Hilfsorganisationen Hand in Hand gearbeitet
haben.“
Die Mitglieder des Krisenstabs
hatten die Aufgabe, eine Starkregen-Lage zu
bewältigen. Ziel der Übung war es, die
Zusammenarbeit des Krisenstabs und der
Einsatzleitung auf den Prüfstand zu stellen und
gemeinsam die sich stetig verändernde Lage
abzuarbeiten. In dieser realistisch
aufwachsenden Lage waren alle Teilnehmenden der
Übung gefordert.
Dinslaken:
Flaggentag der Mayors for Peace
Flagge der Mayors for Peace vor dem Dinslakener
Rathaus am 8.7.2025
80 Jahre nach Hiroshima:
Städte rufen zu nuklearer Abrüstung und Frieden
auf
Vor 80 Jahren erlebten die Menschen
in den Städten Hiroshima und Nagasaki das
unbeschreibliche Grauen eines
Atombombenabwurfes. Seither warnen die
Überlebenden dieser Katastrophe vor den Folgen
des Einsatzes von Nuklearwaffen. In Deutschland
setzen auch in diesem Jahr am 8. Juli vor den
Rathäusern mehr als 600 Städte mit dem Hissen
der Mayors for Peace Flagge ein klares
Bekenntnis zu nuklearer Abrüstung, gegen Kriege
und für ein friedliches Zusammenleben der
Menschen weltweit.
Expert*innen des
Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI
gehen aktuell von rund 12.241 Atomsprengköpfen
weltweit aus. Fast alle neun Atommächte
modernisieren ihre Arsenale, besonders schnell
wächst das chinesische Atomwaffenarsenal. Zudem
läuft der New START-Vertrag, der 2021 für fünf
Jahre verlängert wurde und die Begrenzung
strategischer Kernwaffen zwischen den USA und
Russland regelt, Anfang des kommenden Jahres
aus. Bemühungen, diesen zu verlängern oder zu
ersetzen, sind augenscheinlich nicht in Sicht.
Es droht ein neuer nuklearer Rüstungswettlauf.

„In diesem Jahr jährt sich der Abwurf der
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki zum 80.
Mal. Der Einsatz dieser Massenvernichtungswaffen
brachte unermessliches Leid über die Menschen.
Die zahlreichen aktuellen Konflikte in der Welt
zeigen uns gerade heute, wie wichtig es ist,
dass wir als Mayors for Peace unsere Stimme
gegen die Aufrüstung von Atombomben erheben.
Deshalb fordern wir, gemeinsam mit mehr als
8.400 Städten weltweit, eindringlich nukleare
Abrüstung statt Aufrüstung. Atomwaffen sind ein
Risiko für die gesamte Menschheit“, so
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.
Was
ist der Flaggentag:
Am Flaggentag erinnern
die Mayors for Peace an ein Rechtsgutachten des
Internationalen Gerichtshofes in Den Haag vom 8.
Juli 1996. Der Gerichtshof stellte fest, dass
die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von
Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht
verstoßen.
Zudem stellte der Gerichtshof
fest, dass eine völkerrechtliche Verpflichtung
besteht, „in redlicher Absicht Verhandlungen zu
führen und zum Abschluss zu bringen, die zu
nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten
unter strikter und wirksamer internationaler
Kontrolle führen.“
Wer sind die Mayors
for Peace:
Die Organisation Mayors for Peace
wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima
gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor
allem für die Abschaffung von Atomwaffen 2 ein,
greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege
für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren.
Mehr als 8.480 Städte in 166 Ländern gehören dem
Netzwerk an, darunter rund 900 Städte in
Deutschland. Mehr als 600 Städte in Deutschland
beteiligen sich in diesem Jahr am Flaggentag.
Bundeshaushalt
2025: Der Bevölkerungsschutz wird gestärkt
„Der Bevölkerungsschutz steht vor wachsenden
Herausforderungen - sei es durch Extremwetter
oder technische Großschadenslagen, vor allem
aber geopolitische Spannungen. Die zusätzlichen
Haushaltsmittel sind ein erstes starkes Signal
und ein konkreter Beitrag zur Stärkung der
Resilienz unserer Gesellschaft, es werden in den
nächsten Jahren aber deutliche weitere
Investitionen notwendig sein“, so BBK-Präsident
Ralph Tiesler.
Die zusätzlichen
Finanzmittel fließen in mehrere strategisch
bedeutende Vorhaben:
• Die Warnung der
Bevölkerung kann so in notwendigem Umfang weiter
gestärkt und langfristig auf einem hohen
technologischen Niveau gehalten werden. Es wird
weiter in das MoWaS-System, in die NINA-WarnApp,
in Cell Broadcast sowie in den Ausbau des
Sirenennetzes investiert.
• Alle
Einsatzkräfte benötigen Ausrüstung und Technik,
die sie bestmöglich schützt und unterstützt. Das
beginnt bei den neu zu beschaffenden Fahrzeugen
des ergänzenden Katastrophenschutzes und geht
bis zu Messtechnik für Gefahrenstoffe aller Art.
• Schutzräume für die Bevölkerung sind
integraler Bestandteil eines effektiven
Zivilschutzes. Daher erarbeiten Bund und Länder
derzeit ein modernes Schutzraumkonzept, das
zügig Schutzmöglichkeiten in der Bundesrepublik
identifizieren und nutzbar machen soll. Im BBK
ist hierzu eine Pilotförderung zur Ausstattung
öffentlicher Zufluchtsorte im Haushaltsjahr 2026
vorgesehen.
• Kampagnen für den
Selbstschutz sollen sicherstellen, dass
Empfehlungen zur Notfallvorsorge und zum
Verhalten in Krisensituationen so an die
Bevölkerung weitergegeben werden, dass die
Menschen flächendeckend und in ihren jeweiligen
Lebenssituationen erreicht und angesprochen
werden.
• Die Aus- und Fortbildung im
Krisenmanagement kann jetzt endlich mit Hilfe
der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und
Zivile Verteidigung ausgebaut werden, sodass
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger
flächendeckend und über föderale Ebenen hinaus
über das gleiche Wissen verfügen, um komplexe
Krisen zu bewältigen.
• Vorhaben rund um
die Wassersicherstellung legen den Schwerpunkt
auf die Stärkung der leitungsgebundenen
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Hier
gilt weiter, Sicherheit durch Redundanz. Es
sollen zusätzlich mobile
Wassertransportkapazitäten geschaffen, die
Funktionsfähigkeit vorhandener
Trinkwassernotbrunnen sichergestellt und bei
Bedarf neue Bohrungen vorgenommen werden.
„Krisenprävention und Schutz der Bevölkerung
sind Gemeinschaftsaufgaben. Die zusätzlichen
Mittel helfen uns, diese Verantwortung noch
besser wahrzunehmen – vorausschauend,
professionell und nachhaltig. Diese
Investitionen sind Teil eines umfassenden
Prozesses, um Deutschland bis zum Ende des
laufenden Jahrzehnts zivilverteidigungstüchtig
aufzustellen und damit der aktuellen
Bedrohungslage Rechnung zu tragen“, betonte
Präsident Tiesler.
Das BBK arbeitet
hierbei eng mit den Ländern, kommunalen
Strukturen sowie ehrenamtlichen und
hauptamtlichen Einsatzkräften zusammen.
Moers: Kurzgeschichten am Mittag - zum
früheren Meertor
An den früheren Standorten der alten Stadttore
ist Interessantes über die Moerser
Stadtgeschichte zu erfahren. Viele historische
Entwicklungen laufen hier zusammen. Wir bleiben
stehen – und lauschen den Erzählungen rund um
das ehemalige Kirchtor und das Meertor.
Geführt von Eva-Maria Eifert Preis: 5 Euro
Weitere Infos zu den Stadtführungen. Event
details Veranstaltungsdatum 09.07.2025 - 11:30
Uhr - 13:30 Uhr Veranstaltungsort Neumarkt am
Friedrich-Denkmal Veranstalter Firma Stadt- und
Touristinformation Moers Adresse Kirchstraße
27a/b 47441 Moers
Zum Geleucht
mit dem Stadtteiltreff Neu_Meerbeck am 9. Juli
Ein Ausflug zum Geleucht auf der Halde
Rheinpreussen steht auf dem Programm für den
nächsten Stadtteiltreff Neu_Meerbeck am
Mittwoch, 9. Juli. Gästeführer Karl-Heinz
Domnick wird die Geschichte des ehemaligen
Zechenstandorts und Hintergründe zur
überdimensionalen Grubenlampe erläutern.

Geleucht auf der Halde Rheinpreussen
Treffpunkt ist um 16.50 Uhr direkt oben am
Geleucht. Wer selbst keine Fahrmöglichkeit hat,
kommt gerne um 16.30 Uhr zum Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck, Bismarckstraße 43b. Für den
Transport (auch mit Gehhilfe oder Rollator
möglich - Anmeldung erforderlich!) sorgen dann
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen und
Rückfragen telefonisch unter 0 28 41 / 201 -
530. Event details Veranstaltungsdatum
09.07.2025 - 16:30 Uhr - 18:00 Uhr
Veranstaltungsort Geleucht auf der Halde
Rheinpreussen Gutenbergstraße 47443 Moers.
Quiz
in Moers
Die drei besten Teams werden mit einem
Verzehr-Gutschein belohnt. Pro Team können
maximal 6 Teilnehmende antreten, die Startgebühr
beträgt 3 Euro pro Person. Anmelden könnt ihr
euch dienstags bis samstags ab 18 Uhr. Entweder
vor Ort bei dem Servicepersonal selbst oder ihr
ruft kurz an (02841 – 169 257 8).

Veranstaltungsdatum 09.07.2025 - 19:30
Uhr - 22:00 Uhr Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers. Veranstaltungsort
Jugend-Kultur-Zentrum 'Bollwerk 107'
"Most Wanted Employer 2025": Das
Ruhrgebiet punktet als attraktiver Arbeitgeber
Zahlreiche Organisationen aus dem Ruhrgebiet
gehören zu den beliebtesten Arbeitgebern im
Ranking "Most Wanted Employer 2025" der
Wochenzeitung DIE Zeit. Drei schafften es im
Gesamtranking unter die besten 20 (von 320.000):
Auf Platz neun findet sich das
Personalmanagement-Unternehmen "Pathos" mit
Standorten in Duisburg und Hagen.
Den
elften Platz sichert sich die codecentric AG aus
Dortmund. Platz 16 geht an die Personal-Agentur
Pluto mit Standorten in Dortmund und Essen.
Zudem stehen in gleich mehreren
Branchen-Rankings Arbeitgeber aus dem Ruhrgebiet
ganz oben an der Spitze: In der Rubrik
"Öffentliche Verwaltung, Administration,
Vereine" landet der Kindernothilfe e.V. mit Sitz
in Duisburg auf dem ersten Platz.
Im
Bereich "Immobilien" sichert sich die Tectareal
Property Management GmbH Platz eins. Die
Online-Plattform "Ausbildung.de" aus Bochum
steht ganz oben in der Kategorie "Internet". Im
Bereich "Healthcare" ist die Dr. Ausbüttel & Co.
GmbH aus Dortmund federführend, im Bereich
"Food" die "Die Meisterleister GmbH" aus Wesel.
Die Auszeichnung wird jährlich vergeben
und basiert auf echten Bewertungen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf kununu.
Analysiert wurden mehr als 320.000
Arbeitgeberprofile und mehr als 5,4 Millionen
Bewertungen von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern in Deutschland. Kununu ist eine
Online-Plattform, die es Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern ermöglicht, Erfahrungsberichte zu
teilen. idr
Moers: Kreativkurse
der vhs im Sommer
Malen, Zeichnen und plastisches Gestalten im
Sommer: Die vhs Moers – Kamp-Lintfort bietet im
Rahmen ihrer ‚Sommerakademie Malerei und
Bildhauerei‘ an fünf verschiedenen Terminen ein
breites Spektrum künstlerischer Möglichkeiten.
Ab Dienstag, 22., bis Freitag, 25. Juli,
können Interessierte im Garten eines
Künstlerhauses an der Römerstraße 490, jeweils
von 9 bis 16 Uhr neue kreative
Gestaltungsmöglichkeiten ausprobieren. Die
Workshops richten sich gleichermaßen an
Anfängerinnen und Anfänger wie auch an
Fortgeschrittene.
Mit Silver Clay
persönlichen Schmuck fertigen Ein ganz
persönliches Schmuckstück können die
Teilnehmenden des Kurses ‚Silver Clay‘ am
Freitag, 18. Juli, ab 10 Uhr fertigen. Das
japanische Material besteht aus reinem
Feinsilber und ist weich wie Ton. Nach dem
Formen, Trocknen und Brennen können die
Oberfläche der Schmuckstücke wie herkömmlicher
Schmuck bearbeitet und auch Steinchen eingesetzt
werden.
Der Kurs findet in den Räumen
der vhs Moers an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10
statt. Für alle Kurse ist eine rechtzeitige
Anmeldung telefonisch unter 0 28 41/201 – 565
oder online unter www.vhs-moers.de erforderlich.
Planwagenfahrt von Hiesfeld
nach Marienthal
Am Dienstag, 8.
Juli 2025 von 13:30 bis ca. 18:30 Uhr lädt
Gästeführer Heinrich Hülsemann zu einer ganz
besonderen Planwagenfahrt ein. Vom Startpunkt an
der Wassermühle in Hiesfeld geht es zum
historischen Bauernmuseum nach Marienthal, in
dem auf die Teilnehmer*innen eine spannende
Führung wartet.
Anschließend geht die
Fahrt weiter durch den Dämmerwald zum
Landgasthof Pannebäcker in Schermbeck. Dort wird
eine kleine Rast bei Kaffee und Kuchen
eingelegt, bevor die Rückfahrt zurück zum
Ausgangspunkt nach Hiesfeld beginnt. Die
Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro pro Person, die
direkt vor Ort beim Gästeführer entrichtet wird.
Im Preis inbegriffen sind die Führung im
Bauernmuseum sowie Kaffee / Kuchen im
Landgasthof. Der Treffpunkt befindet sich an der
Wassermühle in Hiesfeld. Eine verbindliche
Anmeldung nimmt das Team der Stadtinformation
unter Tel. 02064 – 66 222 oder per E-Mail an
stadtinformation@dinslaken.de gerne entgegen.
Der Niederrhein trat in die
Pedalen
Der 2. Raderlebnistag bot – trotz des
Regenwetters – zahlreiche Gelegenheiten, die
Region zu erkunden, knifflige Rätsel zu knacken
und hochwertige Preise zu gewinnen. Ohne
regenfeste Kleidung ging es in diesem Jahr
leider nicht: Zum 2. Niederrheinischen
Raderlebnistag hatte der Sommer eine Pause
eingelegt.
Erfreulicherweise waren am
Sonntag dennoch immer wieder einzelne Radler und
Gruppen zu sehen, die motiviert in die Pedalen
traten. Und: „Die Nutzung moderner Tools, die
das Event grundsätzlich noch attraktiver macht,
hat sich im zweiten Jahr etabliert: Viele
Menschen haben von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht und sich damit die Chance auf tolle
Preise gesichert.
Das ist das positive
Fazit des 2. Niederrheinischen Raderlebnistags“,
sagte Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der
Niederrhein Tourismus GmbH (NT), kurz nach
Abschluss der Veranstaltung. NT hatte die
dezentrale Großveranstaltung zusammen mit den
beteiligten Kommunen und mit freundlicher
Unterstützung der Sparkassen am Niederrhein und
des Energieversorgers NEW aus Mönchengladbach
„auf die Räder gestellt“.
Erneut war die
Registrierung der Radlerinnen und Radler auf
digitalem Weg über das Einscannen von QR-Codes
erfolgt. Die Online-Anmeldung – schon zwei
Wochen vor dem Event freigeschaltet – bot die
Chance auf attraktive Preise. Mitfahren war aber
auch ganz spontan und auch ohne Anmeldung
möglich.
Auf den verschiedenen Routen
konnten Fragen per QR-Code abgerufen und per
Smartphone richtig beantwortet werden – und
weiter ging’s zum nächsten ausgeschilderten
Infopunkt mit der nächsten Frage. Ob putzige
Alpakas am Schloss in Hamminkeln, der 57 Meter
tiefe Drususbrunnen in Emmerich, die historische
Altstadt Kempens oder das Museum BEGAS HAUS in
Heinsberg – beim 2. Raderlebnistag Niederrhein
konnten zahlreiche Genuss- und Erlebnisstationen
zum Verweilen, Entdecken und Genießen
angesteuert werden.
56 Kommunen auf
deutscher und niederländischer Seite hatten fast
100 Routen-Vorschläge zur Verfügung gestellt.
Die Strecken verbanden unter anderem Bedburg-Hau
und Goch, Wesel und Hünxe, Erkelenz und
Wassenberg oder Schwalmtal und Nettetal, um nur
einige Beispiele zu nennen. Für jeden Zeitplan,
jedes Alter und jedes Fitness-Level waren
passende Routen dabei.
„Wir sind dankbar
für das Engagement aller Kommunen, die dieses
Event mittragen und den Teilnehmenden damit ein
schönes Erlebnis am Niederrhein bereiten“, so
Baumgärtner. Nun ist die Spannung groß, wer sich
einen Preis „erfahren“ konnte. Bei der Auslosung
des Online-Gewinnspiels winken ein hochwertiges
Tourenrad, gesponsert von Radsport Claassen aus
Kempen, und ein Wertgutschein über 250 Euro vom
Best Western Plus Hotel Brüggen.
Hinzu
kommt ein Sonderpreis (für die meisten besuchten
Info-Punkte und richtig beantworteten
Rätselfragen) in Form einer NiederrheinCard mit
attraktiven Vorteilsangeboten der Region
Niederrhein. Ein weiterer Preis wurde im Rahmen
eines Fotowettbewerbs auf dem Instagramkanal
@niederrheintourismus_ ausgelobt.
Hier
gibt es einen Gutschein im Wert von 100 Euro vom
sonnenklar.TV Reisebüro Heyman-Tours in
Nettetal. „Die glücklichen Gewinnerinnen und
Gewinner werden von uns benachrichtigt“, sagt
Martina Baumgärtner.

Diese Teilnehmer hatten sich von Krefeld nach
Kempen aufgemacht. Foto: NT
Klever Lokalpolitik besucht Bienen-Haus im
Tiergarten
Alljährlich erhalten die
Mitglieder des Rates der Stadt Kleve von der
Stadtverwaltung symbolische Präsente zu ihren
Geburtstagen. In diesem Jahr werden
Bienenpatenschaften an die Stadtverordneten
verschenkt. Auf diese Weise verbindet die Stadt
Kleve eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag
mit der Unterstützung lokaler Imkerarbeit.

Imker Marco Janßen teilte sein Wissen über
Bienen mit den Lokalpolitikerinnen und
Lokalpolitikern.
Neben einer symbolischen
Urkunde sowie einem Glas Honig aus der
Produktion des Imkervereins Kleve-Kellen
erhielten die Politikerinnen und Politiker am
Mittwochmittag die Gelegenheit, das Bienen-Haus
im Klever Tiergarten zu besuchen. Mehr als 20
Ratsmitglieder folgten der Einladung von
Bürgermeister Wolfgang Gebing in die beliebte
Klever Freizeiteinrichtung.

Vor Ort wusste Imker Marco Janßen vom
Imkerverein Kleve-Kellen allerlei Wissenswertes
über die Arbeit der Honigbienen zu berichten.
Eindrucksvoll wurde die Bedeutung der Bienen für
unser Ökosystem deutlich. Bei bestem Wetter
konnte er in der „Bienen-Ecke“ des Klever
Tiergartens die dort in einer Holzhütte
untergebrachte gläserne Bienenbeute
präsentieren. Erst jüngst wurde darin ein neuer
Bienenschwarm angesiedelt.

Besucherinnen und Besucher können die
Honigbienen in dem vollverglasten Kasten hautnah
bei der Arbeit beobachten. Durch eine Öffnung in
der Rückwand des Kastens sowie der Holzhütte
können die Bienen ungestört nach draußen
fliegen. Besuch Bienen Tiergarten 2 Besuch
Bienen Tiergarten 1 Besuch Bienen Tiergarten 3
Die Stadt Kleve dankt allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für ihr Interesse und dem
Imkerverein Kleve-Kellen, insbesondere Marco
Janßen, für die spannenden Einblicke in die
Arbeit der Honigbienen.
Tierische Weinverkostung im Tiergarten Kleve
Sa., 19.07.2025 - 18:30 Uhr
Ein
exklusiver Abend mit ausgesuchten Weinen,
Fingerfood und einer abendlichen Führung
erwarten die Gäste bei den ersten Wine Tastings
im Tiergarten Kleve. Unter der fachkundigen
Leitung von Weinexperte Kilian Peters von der
Schlossbergkellerei Peters und Tiergartenleiter
Martin Polotzek erwartet die TeilnehmerInnen ein
unvergesslicher Abend voller Genuss und Natur.

Bei einem stimmungsvollen abendlichen
Spaziergang durch den Tiergarten haben die Gäste
die Möglichkeit, verschiedene erlesene Weine zu
verkosten. Die Weinverkostung wird von einer
Auswahl köstlicher Tapas begleitet, die das
Geschmackserlebnis perfekt abrunden.
Der
Ticketpreis für dieses exklusive Event beträgt
79 Euro und umfasst den abendlichen
Tiergarteneintritt zur Führung, die
Weinverkostung sowie die Verpflegung. Um eine
gemütliche Atmosphäre zu gewährleisten, ist die
maximale Teilnehmerzahl auf 25 Personen
begrenzt.
Mietwagen im Ausland: So vermeiden
Sie Ärger im Sommerurlaub
Mietwagenprobleme
im Urlaub sind ein häufiges Ärgernis.
Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)
Deutschland gibt Tipps, wie Reisende Ärger im
Ausland vermeiden können — und was Sie bei der
Buchung und am Schalter unbedingt beachten
sollten.

Mietwagenvertrag im Ausland: Genau hinschauen
schützt vor Extrakosten. © Foto: Adobe Stock /
crizzystudio
Typische Beschwerde beim
EVZ: Ohne Zusatzversicherung kein Mietwagen
Ein Verbraucher buchte über ein
Vergleichsportal einen Mietwagen für seinen
Spanienurlaub – inklusive Vollkasko ohne
Selbstbeteiligung. Am Urlaubsort legte er den
Voucher am Schalter des Autovermieters vor. Der
Mitarbeiter druckte einen Vertrag mit deutlich
höherem Betrag aus. Auf Nachfrage erklärte er,
das Fahrzeug sei nicht ausreichend versichert –
im Schadensfall müsse der Verbraucher selbst
aufkommen.
Nur mit einer
Zusatzversicherung („Super Relax“) für 300 Euro
habe man ein „Rundum-sorglos-Paket“. Trotz
mehrfachen Hinweises auf die bereits
abgeschlossene Vollkaskoversicherung blieb der
Mitarbeiter hartnäckig – und verweigerte die
Fahrzeugübergabe ohne Zusatzversicherung. Aus
Angst, ohne Auto dazustehen und die bereits
gezahlten Kosten zu verlieren, unterschrieb der
Verbraucher. Erst mit Unterstützung des EVZ
Deutschland erhielt er die 300 Euro zurück.
Wichtig zu wissen: Bei Mietwagenbuchungen
über Preisvergleichsportale sind meist drei
Parteien beteiligt: das Vergleichsportal, ein
Mietwagenvermittler und die eigentliche
Mietwagenfirma. Der verbindliche Mietvertrag
kommt in der Regel erst vor Ort am Schalter der
Mietwagenfirma zustande.
Checkliste:
Mietwagen im Ausland - darauf sollten Sie achten
Versicherungsschutz: Am besten Vollkasko ohne
Selbstbeteiligung. Meist wird dieser Schutz
bereits bei Mietwagenvermittlern (z. B. Auto
Europe, Rentalcars oder HolidayCars) auf
Preisvergleichsportalen gebucht. Vor Ort
versuchen Autovermieter dann zusätzlich, eigene
Premium-Versicherungen zu verkaufen (oft unter
erheblichem Druck) oder diese unterzuschieben.
Den richtigen Ansprechpartner kennen: Die
Vermittler sind Ansprechpartner für Fragen rund
um die Reservierung (z. B. die Erstattung der
Vorauszahlung bei Stornierung). Für Probleme mit
dem Fahrzeug oder vor Ort abgeschlossener
Zusatzleistungen ist hingegen die Mietwagenfirma
zuständig.
Bewertungen lesen: Vorab
unabhängige Bewertungsseiten (z. B. Trustpilot,
Google, Tripadvisor) prüfen: Fällt die
Mietwagenfirma am Urlaubsort durch unschöne
Praktiken auf?
Kreditkarte bereithalten:
In der Regel wird eine Kreditkarte auf den Namen
des Fahrers verlangt. Debitkarten werden häufig
grundlos abgelehnt. Tipp: Vorab über
Zahlungsmodalitäten informieren.
Vertrag
gut prüfen: Nur unterschreiben, wenn alles
verstanden wurde. Bei Bedarf Übersetzungs-App
nutzen (z. B. Google Lens oder Microsoft
Translator). Nicht blind den Aussagen der
Mitarbeiter vertrauen.
Automatik oder
E-Auto auf Gebirgsinseln: Um Kupplungsschäden zu
vermeiden (die oft in Rechnung gestellt werden),
in bergigen Regionen auf Automatik oder E-Auto
setzen. Mehr dazu hier.
Rückgabe
dokumentieren: Fahrzeug bei Abholung und
Rückgabe fotografieren oder filmen, um bei
späteren Streitigkeiten über Schäden etwas in
der Hand zu haben.
Was tun bei Ärger am
Mietwagenschalter?
Wenn es am Schalter zu
Problemen rund um den Mietwagen kommt – zum
Beispiel die Debitkarte nicht akzeptiert, eine
Zusatzversicherung aufgedrängt oder damit
gedroht wird, dass man den Mietwagen nicht
bekommt, sollten Urlauber zunächst ruhig
bleiben. Kann man auf den Mietwagen nicht
verzichten und fühlt sich gezwungen, die
Bedingungen einzugehen, sollte man sich direkt
bei der Geschäftsleitung und beim Vermittler
beschweren und dies auch dokumentieren (z. B.
mit einem handschriftlichen Hinweis im Vertrag,
dass man zum Abschluss einer Zusatzversicherung
gedrängt wurde). So hat man später bessere
Chancen, seine Rechte durchzusetzen.
Kommt man selbst nicht weiter, kann man sich bei
Problemen mit Anbietern aus dem EU-Ausland,
Island, Norwegen oder dem Vereinigten Königreich
kostenlos an das EVZ Deutschland wenden.
Kontaktaufnahme über unser Online-Formular.

Nach historischem Tiefstand: Zahl der
Adoptionen steigt 2024 um 1,7 %
• Anteil der Stiefkindadoptionen mit 74 % auf
neuem Höchststand, vor allem wegen mehr
Adoptionen durch Stiefmütter in
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
•
Tiefstand bei Adoptionsbewerbungen und zur
Adoption vorgemerkten Kindern
• Auf jedes
vorgemerkte Adoptivkind kommen fünf potenzielle
Adoptivfamilien
Nach dem historischen
Tiefstand im Jahr 2023 hat die Zahl der
Adoptionen wieder leicht zugenommen: Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
wurden im Jahr 2024 in Deutschland 3 662 Kinder
adoptiert. Das waren 1,7 % oder 61 Kinder mehr
als im Jahr zuvor, als die Zahl der Adoptionen
auf den tiefsten Stand seit der deutschen
Vereinigung gesunken war.

Gleichzeitig erreichte der Anteil der
Stiefkindadoptionen 2024 einen neuen
Höchststand: Fast drei Viertel (74 %) der Kinder
wurden von ihren Stiefmüttern oder vätern
angenommen, also den (neuen) Partnerinnen oder
Partnern der rechtlichen Elternteile. Weitere 22
% der Adoptivkinder kamen in
verschiedengeschlechtliche und 3 % in
gleichgeschlechtliche Paarfamilien, bei denen
die Paare das Kind gemeinsam adoptierten. In
knapp 2 % der Fälle wurden die Kinder von
sonstigen Einzelpersonen angenommen.
Nur
knapp 2 % der Kinder aus dem Ausland adoptiert –
am häufigsten aus Thailand Die Kinder waren zum
Zeitpunkt der Adoption im Schnitt 5,3 Jahre alt,
gut jedes zweite von ihnen (51 %) war jünger als
2 Jahre. Vor der Adoption war mit 72 % der
Großteil der adoptierten Kinder bei einem
leiblichen Elternteil mit Stiefelternteil
aufgewachsen, 10 % wurden aus einem Krankenhaus
und 9 % aus einer Pflegefamilie heraus
adoptiert.
In weiteren 3 % der Fälle
schloss die Adoption an eine anonyme Geburt oder
die Abgabe über eine Babyklappe und in 2 % an
eine Heimerziehung an. Insgesamt 7 % der Kinder
besaßen vor der Adoption keinen deutschen Pass,
wobei nur 2 % der adoptierten Kinder aus dem
Ausland angenommen wurden – und zwar am
häufigsten aus Thailand, Südafrika oder Sri
Lanka.
Bei knapp einem Viertel (23 %)
aller Adoptionen im Jahr 2024 wurde im Vorfeld
eine Adoptionspflege durchgeführt
(§ 1744 BGB).
Diese Probephase ist gesetzlich vorgeschrieben,
wenn sich die Beteiligten noch nicht kennen, und
dient vor allem dazu, eine Bindung zwischen dem
Kind und der künftigen Adoptivfamilie
aufzubauen. Bei den im Jahr 2024 adoptierten
Kindern dauerte diese Phase im Schnitt 16
Monate.
Stiefkindadoptionen gewinnen
langfristig an Bedeutung 43 % der Adoptivkinder
im Jahr 2024 wurden von ihren Stiefmüttern und
weitere 31 % von ihren Stiefvätern angenommen.
Während die Kinder bei der Adoption durch eine
Stiefmutter im Schnitt nur 2 Jahre alt waren,
lag das Durchschnittsalter bei der Adoption
durch einen Stiefvater mit 11,4 Jahren fast
sechsmal so hoch.
Eine Erklärung für
diesen Unterschied kann die Form der
Partnerschaft der Stiefmütter geben: Bei etwa
vier von fünf (79 %) Adoptionen durch
Stiefmütter handelte es sich um Frauen in
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die
keine Angaben zum Kindsvater gemacht haben. Dies
entsprach gut einem Drittel (34 %) aller
Adoptionen im Jahr 2024 (2023: 31 %).
Nach aktueller Gesetzeslage kann die Partnerin,
die das Kind nicht geboren hat, die
Rechtsstellung eines leiblichen Elternteils nur
über eine Stiefkindadoption erlangen (§§ 1591, 1592, 1741, 1766a BGB).
Die Zahl dieser Adoptionen durch Stiefmütter in
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ohne
Angaben zum Kindsvater stieg 2024 im Vergleich
zum Vorjahr überdurchschnittlich um 10 % oder
110 Fälle auf 1 243 Adoptionen.
Der
Anstieg trug maßgeblich dazu bei, dass die
Stiefkindadoptionen insgesamt weiter an
Bedeutung gewonnen haben: Seit 2014 ist ihr
Anteil an allen Adoptionen von 58 % auf den
neuen Höchststand von 74 % im Jahr 2024
gewachsen, 2023 hatte er bei 73 % gelegen.
Jedes vierte Kind gemeinsam von einem
Paar adoptiert
Jedes vierte Adoptivkind
(25 %) wurde 2024 gemeinsam von einem Paar
angenommen. Mit durchschnittlich 3,4 Jahren
waren diese Kinder etwas jünger als bei
Adoptionen durch Einzelpersonen (5,9 Jahre). In
22 % der Fälle handelte es sich bei den neuen
Adoptiveltern um verschieden- und in 3 % um
gleichgeschlechtliche Elternpaare. Dabei
überwogen unter den gleichgeschlechtlichen
Paaren mit 74 % deutlich die rein männlichen
Paare.
Während sie häufiger Jungen als
Mädchen adoptiert hatten (Jungenanteil: 74 %),
war es bei den rein weiblichen Paaren umgekehrt
(Mädchenanteil: 64 %). Deutlich weniger
Adoptionsbewerbungen und für eine Adoption
vorgemerkte Kinder Trotz des leichten Anstiegs
im Jahr 2024 liegt die Zahl der Adoptionen seit
2009 relativ stabil zwischen rund 3 600 und
4 100 Fällen.
Während die Adoptionen
2023 auf einen historischen Tiefstand gesunken
waren, traf dies im Jahr 2024 auf die
Adoptionsbewerbungen und die Zahl der zur
Adoption vorgemerkten Kinder zu: Die
Adoptionsbewerbungen sanken 2024 um 14 % auf
3 440 und die für eine Adoption vorgemerkten
Kinder um 26 % auf 665 Fälle. Rechnerisch
standen im Jahr 2024 damit jedem vorgemerkten
Adoptivkind fünf potenzielle Adoptivfamilien
gegenüber.
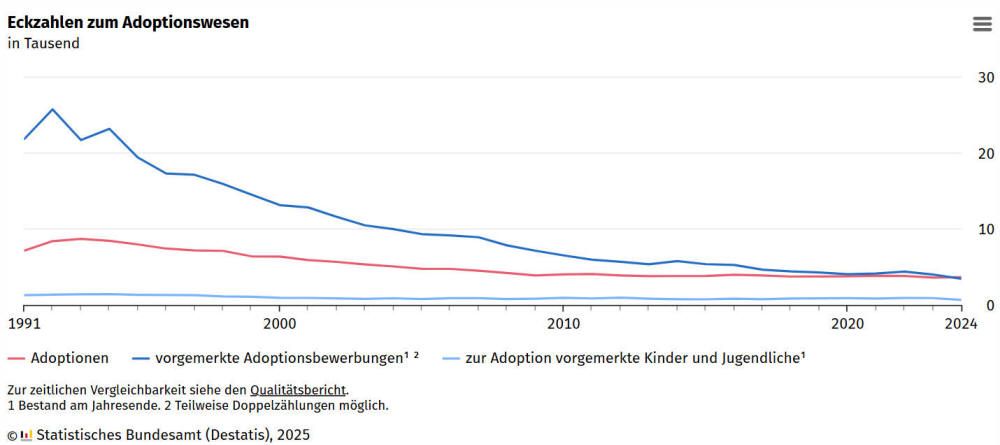
Mehr als 4 % der 19-Jährigen in NRW
absolvierten einen Freiwilligendienst
* Über 70 % der Freiwilligendienstleistenden
zwischen 17 und 20 Jahren alt.
* Höchste
Anteile insgesamt in Leverkusen und im
Rheinisch-Bergischen Kreis.
* Knapp 60 % der
Freiwilligendienstleistenden im Bereich
„Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“,
fast 18 % im Bereich „Militär“.
Zum
Zensusstichtag am 15. Mai 2022 leisteten
25.940 Personen in NRW einen Freiwilligendienst.
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen
als Statistisches Landesamt mitteilt,
absolvierten somit 0,2 % der
nordrhein-westfälischen Bevölkerung ein
Freiwilliges Soziales Jahr, einen
Bundesfreiwilligendienst oder einen Freiwilligen
Wehrdienst.
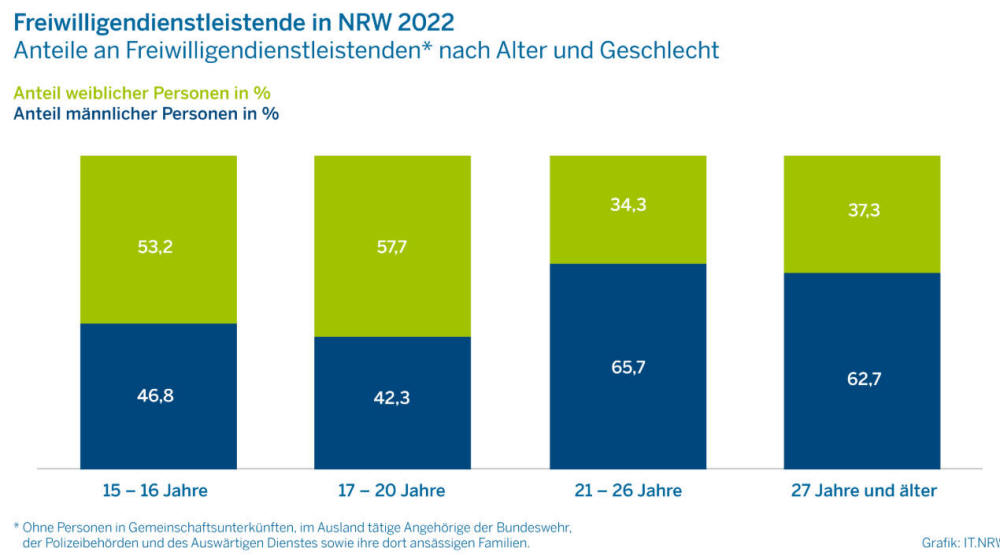
Den höchsten Anteil verzeichneten die
19-Jährigen, von denen 4,4 % einen
Freiwilligendienst leisteten. Über 70 % waren
zwischen 17 und 20 Jahren alt Mit 70,3 % waren
im Mai 2022 mehr als zwei Drittel der Personen,
die ein Freiwilliges Soziales Jahr, einen
Bundesfreiwilligendienst oder einen Freiwilligen
Wehrdienst leisteten, zwischen 17 und 20 Jahren
alt. 13.370 Personen und somit 51,5 % der
Freiwilligendienstleistenden in NRW waren
weiblich.
Demgegenüber absolvierten
12.570 Männer – also 48,5 % der Personen – einen
Freiwilligendienst. In den jüngeren
Altersgruppen überwog der Frauenanteil. Bei den
15- bis 16-Jährigen waren 53,2 % der Personen
weiblich, bei den 17- bis 20-Jährigen waren es
57,7 %. Wiederum dominierte der Männeranteil mit
fast zwei Dritteln in den Altersgruppen ab 21
Jahren: 65,7 % männliche Personen waren es bei
den 21- bis 26-Jährigen sowie 62,7 % Männer bei
den 27-Jährigen und Älteren.
In der
Stadt Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen
Kreis wohnten die meisten „Freiwilligen“
Ausschließlich in der Altersspanne von 17 bis 26
Jahren können sowohl das Freiwillige Soziale
Jahr als auch der Bundesfreiwilligendienst und
der Freiwillige Wehrdienst absolviert werden.
Eine regionale Betrachtung aller 17- bis
26-Jährigen zeigt, dass im Mai 2022 mit einem
Anteil von jeweils 2,0 % die meisten
Freiwilligendienstleistenden in der Stadt
Leverkusen oder im Rheinisch-Bergischen-Kreis
wohnten. Zum Vergleich: Im Durchschnitt über
alle Kreise und kreisfreien Städte in NRW waren
1,2 % der Personen im Alter zwischen 17 und 26
Jahren Freiwilligendienstleistende.
Im
Bereich „Gesundheit, Soziales, Lehre und
Erziehung“ wurden knapp 60 % und beim Militär
fast 18 % der Dienste geleistet Zum
Zensusstichtag 2022 waren mit 58,6 % die meisten
der gemäß ILO-Definition unter
https://www.ilo.org/regions-and-countries/europe-and-central-asia/european-union-eu/germany
erwerbstätigen Freiwilligendienstleistenden in
der Berufsklasse „Gesundheit, Soziales, Lehre
und Erziehung“ tätig. Darunter werden u. a.
Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit oder
Gesundheits- und Altenpflege zusammengefasst.

Am zweithäufigsten war mit 17,5 % der
Tätigkeitsbereich „Militär“ vertreten, da ein
Freiwilligendienst auch in Form eines
Freiwilligen Wehrdienstes erfolgen kann. Im
Vergleich der Altersgruppen zeigen sich
deutliche Unterschiede: Während mit 67,8 % mehr
als zwei Drittel der Personen im Alter von 17
bis 20 Jahren einen Freiwilligendienst im
Bereich „Gesundheit, Soziales, Lehre und
Erziehung“ ausübten, waren in der Altersgruppe
der 21- bis 26-Jährigen die beiden Hauptbereiche
fast gleich stark vertreten: Im Bereich
„Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“
waren 42,6 % der Freiwilligendienstleistenden
tätig, beim Militär 40,6 %. Bei den 27-Jährigen
und Älteren wiederum lag ein Freiwilligendienst
beim Militär mit 38,6 % auf Platz 1.
Montag, 7. Juli 2025
50 Jahre Kreis Wesel: Mobilitätsquiz und
Wettbewerb „Schönste Busgeschichte“
Die Kreisverwaltung Wesel veranstaltet im Rahmen
ihres 50-jährigen Jubiläums ein Quiz zum Thema
Mobilität im Kreis Wesel sowie einen Wettbewerb
zur Auswahl der „schönsten Busgeschichte“. Im
Zeitraum vom 7. Juli bis zum 27. Juli 2025
können Menschen ab 18 Jahren aus dem Kreis Wesel
am Gewinnspiel teilnehmen und haben die Chance,
attraktive Preise zu gewinnen.
Beim
Mobilitätsquiz müssen die Teilnehmenden acht
Fragen zum Thema Mobilität im Kreis Wesel
beantworten. Die Platzierung der Gewinner
richtet sich nach der Anzahl der richtig
beantworteten Fragen. Bei gleicher Anzahl
richtig beantworteter Fragen entscheidet das
Los.
Den oder die Erstplatzierte
erwartet ein Gutschein für eine Ballonfahrt für
eine Person über den Niederrhein. Der oder die
Zweitplatzierte erhält einen Gutschein für das
Fahrgastschiff River Lady und der Dritte Platz
kann sich über ein Präsentpaket „Feine
Schatzkiste“ freuen. Neben dem Quiz findet auch
ein Wettbewerb zur „schönsten Busgeschichte“
statt.
Aus allen eingesandten Beiträgen
wird die „schönste Busgeschichte“ durch eine
Jury ausgewählt. Als Sonderpreis für die
„schönste Busgeschichte“ können zwei Tickets für
den Grünkohl-Express vom Historischen
Schienenverkehr Wesel e.V. am 18. Oktober 2025
gewonnen werden. Außerdem wird die „schönste
Busgeschichte“ durch den Kreis Wesel
veröffentlicht.
Das Quiz sowie die
Teilnahme- und Datenschutzbedingungen werden ab
dem 7. Juli 2025 unter https://beteiligung.nrw.de/k/-r97f9bCK frei
geschaltet. Ebenfalls unter diesem Link gibt es
ab dem 7. Juli ein Textfeld, in dem die
„schönste Busgeschichte“ eingetragen werden
kann. Die Gewinner des Quiz und des Wettbewerbs
„schönste Busgeschichte“ werden per E-Mail über
den Gewinn benachrichtigt.
Kreisausschuss tagte im Alten Landratsamt in
Moers
Der Kreisausschuss am
Donnerstag, 3. Juli 2025, tagte nicht in Wesel,
sondern im historischen Gebäude „Altes
Landratsamt“ in Moers. Im Rahmen des
Jubiläumsjahres wurde der Sitzungsort verlegt,
um die Wurzeln des Kreises wertzuschätzen.
Genauso wie der vorherige Kreisausschuss in
Dinslaken tagte, trafen sich die
Ausschussmitglieder nun in der ehemaligen
Kreisstadt.
Der Moerser Bürgermeister
Christoph Fleischhauer begrüßte die
Ausschussmitglieder als Hausherr. Im Anschluss
an den Kreisausschuss führte die Leiterin des
Grafschafter Museums, Diana Finkele, die
Ausschussmitglieder durch die Dauerausstellung
„Demokratiegeschichte“.
Die Ausstellung
ist interaktiv und zeichnet die Entwicklung der
Demokratie in Moers nach, beginnend im frühen
20. Jahrhundert. Besonderes Augenmerk wird in
der Ausstellung auf jüdisches Leben in Moers
gelegt: Die Besuchenden erhalten zu Beginn eine
Ausweiskarte eines Moerser Bürgers oder einer
Bürgerin und können mit dieser die Biografie der
Person nach und nach erforschen. Täter und Opfer
sind abgebildet, und auch die Geschichte des
Alten Landratsamtes wird erzählt.
In der
Sitzung des Kreisausschusses ging es unter
anderem um die Vorstellung des
nordrhein-westfälischen Förderprogramms
„NRWeltoffen“. Ziel des Programms ist es,
Handlungskonzepte zur Prävention gegen
Rechtsextremismus und Rassismus zu entwickeln.
Das partizipative Konzept sieht vor, dass
Förderstrategien entwickelt, umgesetzt und
anschließend evaluiert und weiterentwickelt
werden.
Die Fachstelle der Demokratie
der Stadt Moers wurde vom Kreis Wesel
beauftragt, diese Strategien für den gesamten
Kreis umzusetzen. Diana Finkele stellte in einer
Präsentation dar, was die Fachstelle bereits
umgesetzt hat: Von Filmen über jüdische
Mitbürgerinnen und Mitbürger über einen
Austausch mit dem Academic College in Tel Aviv
bis hin zu interaktiven Ausstellungen zum Thema
Holocaust.
Landrat Ingo Brohl: „In
diesem Jahr feiern wir nicht nur 50 Jahre Kreis
Wesel, sondern gedenken 80-Jahre Ende des
zweiten Weltkriegs und damit der Befreiung
Deutschlands vom Naziregime durch die
Alliierten. Insbesondere vor diesem Hintergrund
ist es überaus wichtig, dem Thema
Demokratiegeschichte besonderen Raum zu geben.
Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung
ist keine Selbstverständlichkeit, wir sind
weltweit nur eine von zwanzig echten Demokratien
- deshalb gilt es, die Werte von Freiheit,
Rechtsstaatlichkeit und Toleranz zu fördern und
zu verteidigen.“
Die Förderung ist auf
einen Höchstbetrag von 73.500 Euro pro
Haushaltsjahr und Kreis/kreisfreie Stadt
begrenzt. Ausgehend von diesem Höchstbetrag
beträgt der jährliche Eigenanteil des Kreises 20
Prozent und damit 18.375 Euro.
Dinslaken und Wasserspiele: Technische Arbeiten
bis kommende Woche Überschwemmung an der
Duisburger Straße.
Nachdem die
Dinslakener Wasserspiele auf der Duisburger
Straße und auf dem Neutorplatz wegen der
Hitzewelle wieder angestellt worden war, hatte
sich auf der Duisburger Straße eine
Überschwemmung gebildet. Grund dafür sind
verschlammte Leitungen, die ein Rücklaufen des
Wassers in den Wasserkreislauf der Wasserspiele
verhindert haben.

Da für die Reinigung der Leitungen ein
spezial Gerät erforderlich ist, können die
Arbeiten erst im Laufe der nächsten Woche
durchgeführt werden. Anschließend sollen die
Wasserspiele wieder angestellt werden.
Dinslaken: Bildungszentrum Hagenstraße
fertiggestellt: ganzheitliche Bildung und
nachhaltige Stadtentwicklung
Mit
einem Festakt und zahlreichen Gästen aus
Politik, Verwaltung, Bauwesen und
Stadtgesellschaft hat die Stadt Dinslaken am
heutigen Freitag, 4. Juli 2025, die
Gesamtfertigstellung des Bildungszentrums
Hagenstraße gefeiert. Nach mehr als einem
Jahrzehnt beginnend mit der Entscheidung die
Schulen in Dinslaken grundsätzlich zu sanieren,
anschließender Planung, Entwicklung und Bau ist
ein einzigartiges Ensemble entstanden, das
Bildung, Betreuung, Bewegung und Begegnung
beispielhaft miteinander verbindet.

Symbolische Schlüsselübergabe am Bildungszentrum
Hagenstraße
Im Ratsbeschluss am
09.07.2013 wurde die Hagenschule in ein
Sanierungspaket aufgenommen und zwei Jahre nach
Gründung der ProZent (2014) wurde am 15.03.2016
die Umsetzung der Schule als erster Bauabschnitt
beschlossen. Das Bildungszentrum Hagenstraße
steht für einen zukunftsweisenden Wandel in der
städtischen Bildungslandschaft und setzt neue
Maßstäbe für ganzheitliche Entwicklung,
Nachhaltigkeit und soziale Teilhabe.
Das
Bildungszentrum Hagenstraße ist weit mehr als
die Summe seiner Teile. Es vereint eine moderne,
ganztagstaugliche Grundschule, eine fünfgruppige
Kindertagesstätte und eine großzügige
Dreifachsporthalle mit Gymnastikraum zu einem
offenen, vernetzten Campus. Mit der
Fertigstellung der naturnah und klimaangepasst
gestalteten Außenanlagen ist nun ein vielseitig
nutzbarer Ort entstanden, der Lernen, Spiel,
Sport, Natur und Gemeinschaft in idealer Weise
zusammenführt. Der zentrale Platz dient als
Schulhof und Veranstaltungsfläche, die neuen
Spiel- und Bewegungsbereiche fördern
Kreativität, Gesundheit und Teamgeist.
Die Architektur der einzelnen Gebäude und
Freiraumgestaltung orientieren sich an den
Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und
Familien. Helle, offene Räume, barrierefreie
Zugänge, differenzierte Lern- und Spielzonen
sowie nachhaltige Materialien schaffen eine
Umgebung, in der sich alle wohlfühlen und
entfalten können. Die pädagogische Verzahnung
von Kita, Schule und Sporthalle erleichtert
Übergänge, fördert die Zusammenarbeit und
ermöglicht individuelle Bildungsbiografien von
Anfang an.
Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel betont die herausragende Bedeutung des
Bildungszentrums für die Stadt und ihre
Zukunftsfähigkeit: „Mit dem Bildungszentrum
Hagenstraße haben wir in Dinslaken ein
bedeutendes und nachhaltiges Bildungsprojekt
erfolgreich umgesetzt. Hier werden Bildung,
Betreuung und Bewegung nicht nur nebeneinander,
sondern miteinander gedacht und gelebt. Die enge
Nachbarschaft von Kita, Schule und Sporthalle
ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die
Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen.
Besonders stolz bin ich darauf, dass wir trotz
aller Herausforderungen, von der Pandemie bis zu
gestörten Lieferketten, im Zeit- und
Kostenrahmen geblieben sind. Das verdanken wir
dem Engagement, dem Weitblick und der
Zusammenarbeit aller Beteiligten. Dieses
Bildungszentrum ist ein Versprechen an die
nächste Generation: Wir investieren in ihre
Zukunft, in Chancengerechtigkeit und in ein
starkes, lebendiges Dinslaken. Ich danke allen,
die diesen Ort mit Engagement, Kreativität und
Ausdauer möglich gemacht haben“, unterstreicht
Bürgermeisterin Eislöffel.
Mario Balgar,
Geschäftsführer der ProZent GmbH, hebt die
außergewöhnliche Teamleistung bei der
Entwicklung des Gesamtprojektes und die
partnerschaftliche Zusammenarbeit aller
Beteiligten hervor: „Vom ersten Entwurf bis zur
letzten Pflanzung war dieses Projekt ein
Gemeinschaftswerk vieler Hände und Köpfe. Es war
uns wichtig, die Nutzer*innen, die Verwaltung,
die Planer*innen sowie die ausführenden
Unternehmen frühzeitig und kontinuierlich
einzubinden.
Die drei Gebäude wurden
nicht als Einzelbauten, sondern als
gestalterisch aufeinander abgestimmtes Ensemble
entworfen, das in seiner architektonischen
Einheitlichkeit das Bildungszentrum als Ganzes
erlebbar macht. Nur so konnten wir ein
Gesamtkonzept schaffen, das wirklich zu
Dinslaken passt und den Bedürfnissen der
Menschen vor Ort gerecht wird. Wir haben Wert
gelegt auf Nachhaltigkeit, Funktionalität und
eine Architektur, die Identität stiftet. Das
Ergebnis ist ein Campus, der offen, einladend
und zukunftsfähig ist.“
Ludger Zech,
Schulleiter der Hagenschule, beschreibt die
positiven Veränderungen für Kinder, Lehrkräfte
und Familien: „Das Bildungszentrum Hagenstraße
eröffnet unserer Schule ganz neue Perspektiven.
Die modernen, lichtdurchfluteten Räume, die
flexible Raumstruktur und die direkte Anbindung
an die Sporthalle und die Freianlagen
ermöglichen einen Unterricht, der auf die
Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten ist.
Wir
können differenzieren, fördern, Projekte
durchführen und Bewegung in den Schulalltag
integrieren. Besonders wertvoll ist die enge
Zusammenarbeit mit der Kita und der Sporthalle –
das erleichtert den Übergang für die Kinder und
schafft ein Gemeinschaftsgefühl, das weit über
den Unterricht hinausgeht.“
Tanja Buhren,
stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte
Hagenstraße, betont die Vorteile für die
frühkindliche Entwicklung: „Unsere Kita ist ein
Ort, an dem Kinder sich sicher, geborgen und
inspiriert fühlen. Die neuen Räume und das
naturnahe Außengelände laden zum Entdecken,
Forschen und Spielen ein. Wir legen großen Wert
auf individuelle Förderung, Partizipation und
die Zusammenarbeit mit den Familien.
Die
Nähe zur Schule und zur Sporthalle ermöglicht es
uns, Übergänge behutsam zu begleiten und die
Kinder auf ihrem Bildungsweg optimal zu
unterstützen. Besonders freue ich mich über die
vielen grünen Flächen, die Bobbycar-Rennstrecke
und die nachhaltigen Elemente wie die
Dachbegrünung und die Regenwassernutzung.“
Sozialdezernentin Dr. Tagrid Yousef betont:
„Wer in Bildung investiert, baut nicht nur
Schulen - sondern die Grundlage für eine starke,
gerechte und lebenswerte Stadt. Das
Bildngszentrum Hagenstr ist genau das. Denn hier
wächst nicht nur Wissen - hier wächst Dinslaken
zusammen.“
Die Planung und Umsetzung der
Außenanlagen lagen in den Händen des
Fachdienstes 8.2 – Grünflächen und sind weit
mehr als ein Rahmen für die Gebäude. Sie sind
integraler Bestandteil des pädagogischen
Konzepts und ein Beispiel für klimaangepasste
Freiraumgestaltung in der Stadt. Der zentrale
Platz fungiert als Treffpunkt, Veranstaltungsort
und Schulhof.
Baumgruppen, Sitzstufen, naturnahe
Spielbereiche und klimaangepasste
Regenwasserbewirtschaftung schaffen eine
abwechslungsreiche, nachhaltige und einladende
Umgebung. Die sichere Führung von Fuß- und
Radverkehr und moderne Fahrradabstellanlagen
fördern einen umweltfreundlichen Schulweg.
Mit dem Bildungszentrum Hagenstraße hat die
Stadt Dinslaken nicht nur in moderne Gebäude
investiert, sondern in die Zukunftsfähigkeit des
gesamten Stadtteils. Das Projekt zeigt, wie
Bildung, Betreuung, Sport, Nachhaltigkeit und
soziale Teilhabe in einem stimmigen
Gesamtkonzept verwirklicht werden können.
Der vom Rat beschlossene Kostenrahmen in
Höhe von 16,191 Mio. € konnte nahezu genau
eingehalten werden - mit tatsächlichen
Gesamtkosten von 16.201 Mio. €, die sich unter
dem Einfluss der Pandemie und dem
Kriegsgeschehen in der Ukraine minimal
gesteigert haben - das unterstreicht die
haushalterische Verantwortung der Stadt.
Maßgeblich beteiligt waren dabei die
projektleitenden Architekten/innen Caren Mötter
und Jochen Albri.
Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel abschließend: „Das
Bildungszentrum Hagenstraße ist ein Ort, an dem
Kinder und Jugendliche ihre Potenziale
entfalten, Familien Unterstützung finden und die
Stadtgesellschaft zusammenwächst. Es ist ein
Symbol für die Kraft gemeinsamer Anstrengung,
für Innovationsbereitschaft und für das
Vertrauen in die Zukunft.“
Wesel:
Erweiterung der „FrauenWege“
Mit
der Erweiterung der „FrauenWege“ in der
Sandstraße in Wesel werden drei Gedenktafeln für
bemerkenswerte Weseler Frauen eingeweiht. Die
Tafeln erinnern an das Engagement und die
spannenden Lebensgeschichten dieser
inspirierenden Persönlichkeiten. So haben
Interessierte die Möglichkeit, ihre Geschichten
zu entdecken, während sie durch die Sandstraße
schlendern.
Die Bauverein Wesel AG kann
auf eine stolze Tradition seit 1908
zurückblicken und bringt über 100 Jahre
Erfahrung im Wohnungsbau mit. Als eine der
größten Wohnbaugesellschaften der Region bietet
sie mehr als 2.400 Wohnungen an. Mit einem
starken Engagement für soziale Integration und
das Wohl ihrer Mieter setzt sich die Bauverein
Wesel AG aktiv für erschwinglichen Wohnraum in
der Region ein.
Anlässlich des 750-jährigen
Stadtjubiläums hatte die damalige Frauengruppe
e. V. die Idee, Porträts von engagierten Frauen,
die in der Hansestadt Wesel Spuren hinterlassen
haben, in der Sandstraße auszustellen und
dauerhaft anzubringen.
Die Bauverein
Wesel AG, die mehrere Wohnobjekte in der
Sandstraße besitzt, unterstützte damals das
Projekt der Frauengruppe. Auf Anregung der
Gleichstellungsstelle der Stadt Wesel hat sich
die Bauverein AG nun erneut bereit erklärt, die
Fortführung dieses Projekts zu fördern, indem
sie weitere Fassaden für neue Porträtaufnahmen
zur Verfügung stellt.
Die Gedenktafeln
wurden von Ursula Bröcheler, einer Grafikerin
aus Wesel, gestaltet. Sie hatte bereits 2008 die
Kacheln in der Sandstraße entworfen. Die neuen
Tafeln haben ein anderes Design, und die
Biografien der Frauen sind jetzt über einen
QR-Code abrufbar. Alle Hinweistafeln wurden
aktualisiert.

Bedeutende Frauen
• Erna Suhrborg
Erna Suhrborg wurde
1910 in Krefeld geboren und war ausgebildete
Lehrerin im Kunstgewerbe. Sie lebte von 1943 bis
zu ihrem Tod 1995 in Wesel. Unbeeinflusst von
aktuellen Kulturströmungen und ohne Beachtung
der Entwicklungen und Verhältnisse innerhalb der
rheinischen Kunstszene erarbeitete die
finanziell unabhängige Künstlerin ihren eigenen,
abstrakten, gegenstandslosen Malstil.
Andeutungen von Landschaften und
Naturimpressionen finden sich in ihren frühen
Werken und in ihrem expressionistischen
Spätwerk. In einer Schaffenszeit von mehr als 50
Jahren entstanden Kunstwerke von bemerkenswerter
Qualität. Ihre Bilder wurden in verschiedenen
Städten ausgestellt. Zum 100. Geburtstag
würdigte die Stadt Wesel ihr Werk durch eine
Ausstellung.
Das Städtische Museum
Wesel vergibt alle drei Jahre den von Gabriele
und Hans-Dieter Suhrborg gestifteten „Erna
Suhrborg-Preis“. Die Auszeichnung wird an
bildende Künstlerinnen vergeben, die sich, wie
die Namensgeberin des Preises, durch eine hohe
Qualität ihres künstlerischen Schaffens
auszeichnen, ohne ein künstlerisches
Hochschulstudium abgeschlossen zu haben.
Gleichzeitig verleiht die Stadt Wesel seit
2020 einen Nachwuchspreis an Schülerinnen.
• Eva Maria Falk
Eva Maria Falk wurde
1934 in Wesel geboren. Ihre Eltern
bewirtschafteten ein Anwesen am Auesee. Ihre
Motorsportkarriere begann mit einem Lehrgang auf
dem Nürburgring, wo sie von Wolfgang Graf Berghe
von Trips und Bernd Rosemeyer junior trainiert
wurde. Zunächst fuhr sie kleinere Rallyes,
später auch internationale Rennen in Polen,
Monaco, Portugal und Griechenland.
Der
Höhepunkt ihrer Karriere war der Große
Straßenpreis von Argentinien 1964, bei dem sie
den dritten Platz belegte und die Damenwertung
gewann. Nach dem Unfalltod von von Trips
übernahm sie seine Kolumne in der BILD-Zeitung
und fuhr zusammen mit Rosemeyer die neuesten
Automobile.
1964 endete ihre aktive
Karriere, und sie kehrte nach Wesel zurück. Sie
arbeitete zunächst in einer
Mercedes-Niederlassung und dann bei der
Bauunternehmung F. C. Trapp. Eva Maria Falk
starb 1982 im Alter von 48 Jahren nach einem
langen Krankenhausaufenthalt. Bei der Recherche
zu dieser interessanten Persönlichkeit wurde
entdeckt, dass Eva Maria Falk ursprünglich unter
dem Namen F a l c k geboren wurde. Doch durch
die ständige Verwechslung und die kreative
Schreibweise von Dritten hat sich der Name Falk
etabliert.
• Ingeborg ten Haeff
Ingeborg ten
Haeff wurde 1915 in Düsseldorf geboren und wuchs
in Wesel auf. Nach dem Tod ihres Vaters
heiratete ihre Mutter erneut. Die Familie zog
1928 nach Berlin. In den Kreisen der Avantgarde
der 1930er Jahre lernte sie ihren ersten
Ehemann, Dr. Lutero Vargas, den Sohn des
brasilianischen Präsidenten, kennen. Sie folgte
ihm in seine Heimat.
In Rio de Janeiro
ergaben sich Kontakte zur kulturellen Szene, die
durch viele europäische Emigranten geprägt war.
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie
von ihrem Mann geschieden. Ein neues Leben
begann für sie in der New Yorker Galerie des
Kunsthändlers Israel Ber Neumann, der zahlreiche
europäische Künstler vertrat, die vor der
Verfolgung durch die Nationalsozialisten
geflüchtet waren.
Dort kam sie mit der
klassischen Moderne in Europa in Kontakt und
lernte schließlich ihren zweiten Ehemann, den
Architekten und Stadtplaner Paul Lester Wiener,
kennen. Mit ihm bereiste sie Mittel- und
Südamerika und sammelte präkolumbische Kunst. In
den späten 1950er Jahren begann sie, sich der
Malerei zu widmen, und studierte an der
University of New York.
Kurz darauf
folgten erste Einzelausstellungen, unter anderem
im Hudson River Museum. Mit dem Tod ihres
zweiten Ehemannes (1967) zog sich Ingeborg ten
Haeff in eine künstlerische Pause zurück. 1969
heiratete sie John Lawrence Githens, der als
Professor für Russisch am Vassar College in
Poughkeepsie, New York, tätig war. In ihren
Portraitarbeiten der 1970er Jahre zeigte sie
abstrahierte Motive.
Ten Haeffs Spätwerk
war charakterisiert durch eine Rückkehr zur
Zeichnung. Im Jahr 2006 kehrte die Künstlerin
gemeinsam mit ihrem Ehemann anlässlich einer
Ausstellung im Städtischen Museum noch einmal
nach Wesel zurück.
Ingeborg ten Haeff
lebte ein bemerkenswertes und künstlerisch
erfülltes Leben, das sich kraftvoll gegen die
Normen einer damals überwiegend männlich
geprägten Gesellschaft behauptete. Ihre
Kreativität und Entschlossenheit machten sie zu
einer inspirierenden Persönlichkeit. Sie
verstarb 2011 in New York. Mit ihrer
Lebensgeschichte hinterlässt sie ein bleibendes
Erbe, das Frauen ermutigt, ihre Träume zu
verfolgen und ihre Stimmen zu erheben.
Wesel: Preisverleihung STADTRADELN 2025
Die Stadt Wesel beteiligte sich in diesem Jahr
zum siebten Mal am STADTRADELN. Die Aktion fand
in der Zeit vom 04.05.2025 bis zum 24.05.2025
statt. In drei Aktionswochen dokumentierten
Bürger*innen alle mit dem Fahrrad zurückgelegten
Kilometer – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum
Einkaufen oder in der Freizeit.
Wesel
nahm gemeinsam im Verbund mit zwölf anderen
Kommunen im Kreis Wesel sowie dem Kreis Wesel an
der Mobilitätskampagne teil. Ziel war es,
möglichst viele Teilnehmer*innen fürs
STADTRADELN zu gewinnen und so für das Radfahren
im Alltag in der Breite der Bevölkerung zu
werben.
Das STADTRADELN 2025 war für die
Stadt Wesel ein Erfolg. Insgesamt nahmen in
diesem Jahr 1.692 aktive Fahrradfahrer*innen in
70 Teams an der Aktion teil. Gemeinsam legten
sie ca. 322.640 km zurück und vermieden damit
ca. 52 Tonnen CO2. Im Vorjahr nahmen 1.439
Bürger*innen in 86 Teams teil und radelten
zusammen 292.220 Kilometer, wodurch ca. 50
Tonnen CO2 vermieden werden konnten.
Zu
den teilnehmenden Teams gehörten z.B. Vereine,
Schulen, Unternehmen, Kitas sowie Teams aus
Freunden und Familien. So legte die Stadt Wesel
gemeinsam mit den Weseler Fahrradfahrer*innen
mehr Kilometer zurück als im Vorjahr und
positionierte sich kreisweit hinter der Stadt
Moers auf dem 2. Platz.
Preistragende
Stadtradeln 2025 - Auszeichnungen
Folgende
Teams und Fahrradfahrer*innen haben in den
verschiedenen Kategorien die meisten Kilometer
zurückgelegt:
Beste Kita:
Inklusive KiTa
Kartäuserweg, ca. 5.262 km
Beste
Grundschulklasse:
2b Elche,
Konrad-Duden-Gemeinschafts-Grundschule, ca.
6.615 km
Beste Klasse einer weiterführenden
Schule:
9b, Konrad-Duden-Gymnasium, ca. 4.296
km
Bestes Team (absolut – Kilometer):
Konrad-Duden-Gemeinschafts-Grundschule, ca.
33.886 km
Bestes Team (relativ – Kilometer
pro Fahrer*in):
MotiMuTo-Team, ca. 1.594 km
Bestes Unternehmen:
Marien-Hospital Wesel,
ca. 20.946 km
Bestes Ratsmitglied:
Prof.
Dr. Christoph Lohmann, 842 km
Zudem wurden
Preise an drei Teilnehmer*innen verlost. Dadurch
würdigt die Stadt Wesel auch diejenigen, die das
Fahrrad nur für kurze Strecken im Alltag nutzen.
Einzige Bedingung für die Berücksichtigung in
der Verlosung war, dass das Team der ausgelosten
Person mindestens 50 Kilometer zurückgelegt hat.
Die Gewinner der Verlosung sind:
Nicole Dulder-van der Linden (Kita Kiek in den
Busch): ca. 99 km
Sandra Dickneite
(Konrad-Duden-Gymnasium): ca. 94 km
Carina
Hubbert (Lauffreunde HADI Wesel): ca. 464 km
Die Stadt Wesel setzte sich beim Wettbewerb der
Stadträte des Kreises Wesel als „bestes
Kommunalparlament“ durch.
Kosten und
Sponsoring
Im Haushalt stehen für das
STADTRADELN Mittel in Höhe von 4.000 Euro zur
Verfügung. Davon werden ca. 85 Prozent vom Land
NRW im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit der AGFS
gefördert.
Zudem unterstützt die Westenergie
AG das STADTRADELN in Wesel mit 500 Euro.
Fahrradfreundliches Wesel
Amtsblatt
Die Stadt
Moers hat ein Amtsblatt veröffentlicht. Alle
veröffentlichten Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter
EAC Europa Challenge: ACV mittendrin
bei großem Verkehrsmittel-Vergleich
Der ACV und Automobilclubs der
Interessengemeinschaft European Automobile Clubs
(EAC) haben eine typische Urlaubsreise quer
durch Europa simuliert: von Frankfurt am Main
bis nach Zadar in Kroatien. Der umfassende
Realitätscheck verschiedener Verkehrsmittel
wurde in einem Video festgehalten.
Wer
sich in Deutschland und Europa auf längere
Strecken begibt, muss meist Kompromisse
eingehen: Soll es schnell, günstig,
klimafreundlich oder bequem sein? Jedes
Verkehrsmittel hat seine Stärken und Schwächen –
doch wie groß die Unterschiede tatsächlich sind,
erleben Reisende selten im direkten Vergleich.
Deshalb sind der ACV Automobil-Club Verkehr
und seine Partner im Verbund der European
Automobile Clubs (EAC) nun zu einem
außergewöhnlichen Praxistest angetreten. Vier
Teams machten sich bei der „Europa Challenge“
mit den vier gängigen Verkehrsmitteln auf den
Weg: Verbrenner, Elektroauto, Flugzeug und Bahn.
Auf rund 1.200 Kilometern von Frankfurt am Main
bis nach Zadar an der kroatischen Adriaküste
wollten die Automobilclubs herausfinden: Welches
Verkehrsmittel überzeugt in welchen Kategorien?
Vier Verkehrsmittel im Praxistest
Bei den
Autos setzte der österreichische Automobilclub
ARBÖ auf den Verbrenner, einen Hyundai Kona, der
als bewährter Standard zuverlässig seine
Kilometer absolvierte. Für das Team des ACV und
des ARCD im Elektroauto, einem Kia EV3, war es
spannender: Würde das Laden auch im Ausland
problemlos funktionieren? Ist die oft
beschworene Reichweitenangst auf einer
Urlaubsfahrt tatsächlich ein Thema? Und wie groß
fällt der zeitliche Unterschied im Vergleich zum
Verbrenner aus?
Für die Anreise mit der
Bahn nahm der Automobilclub KS die längste
Reisezeit in Kauf: 23,5 Stunden inklusive
Umstiegen. Dabei stellte sich die Frage, wie
familienfreundlich und alltagstauglich eine über
Landesgrenzen führende Bahnfahrt wirklich ist –
insbesondere mit Blick auf Verspätungen und
unvorhersehbare Unterbrechungen.
Im
Flugzeug startete der EAC mit der vermeintlich
schnellsten und komfortabelsten Option. Doch wie
viel Zeit kosten An- und Abreise zum Flughafen
tatsächlich? Wie schneiden die Gesamtkosten ab?
Und wie fällt der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu
anderen Verkehrsmitteln aus?
Neutraler
Vergleich statt Empfehlung
„Mit der Europa
Challenge haben wir die Vorteile unserer
länderübergreifenden Zusammenarbeit im EAC
genutzt, um die Stärken und Schwächen der
Verkehrsmittel neutral darzustellen – ohne
erhobenen Zeigefinger und ohne Empfehlung an die
Reisenden“, sagt Holger Küster, ACV
Geschäftsführer und Präsident des EAC. „Am Ende
ist es immer eine individuelle Entscheidung, wie
man reisen möchte. Aber es braucht verlässliche
politische Rahmenbedingungen, damit alle
Verkehrsmittel ihr Potenzial für nachhaltiges
Reisen entfalten können.“
Einen
ausführlichen Bericht zur EAC Europa Challenge
mit allen Erfahrungen der Teams sowie Zahlen und
Fakten stellt der ACV in seinem digitalen
Mitgliedermagazin zur Verfügung:
https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-03/verkehrspolitik
UNESCO-Welterbe: „Gemeinsam handeln“
Vor der Eröffnung der 47. Sitzung des
UNESCO-Welterbekomitees am 6. Juli in Paris
erklärt die Präsidentin der Deutschen
UNESCO-Kommission Maria Böhmer:
Ich freue
mich, dass das UNESCO-Welterbekomitee in diesem
Jahr über die Aufnahme der Schlösser König
Ludwigs II. von Bayern in die Welterbeliste
beraten wird. Neuschwanstein, Linderhof,
Herrenchiemsee und das Königshaus am Schachen
begeistern Menschen aus aller Welt. Hier
verschmelzen Architektur, Kunst und Natur zu
einer imposanten Inszenierung.
Das
Welterbe lebt durch die Menschen, die es
entdecken, pflegen und weitergeben. Es schafft
Verbindungen über Generationen und Kontinente
hinweg und öffnet Räume für Bildung und Dialog.
Die große Errungenschaft der Welterbekonvention
besteht darin, die Bedeutung unseres gemeinsamen
Menschheitserbes über Grenzen hinweg zu
vermitteln und Verantwortung dafür zu
übernehmen.
Heute stehen wir vor
gewaltigen Herausforderungen: Klimawandel,
Kriege, Naturkatastrophen, Bauvorhaben und ein
Besucheraufkommen, das sensible Orte an ihre
Belastungsgrenzen bringt, bedrohen das Welterbe.
Sein Schutz muss mit den Anforderungen der
Nachhaltigkeitswende in Einklang gebracht
werden. Digitalisierung, Tourismusmanagement und
Katastrophenvorsorge sind dafür ebenso zentral
wie die Vereinbarkeit von Denkmalpflege und
erneuerbaren Energien.
Die
internationale Zusammenarbeit in der UNESCO
bedeutet dabei ganz konkret: Erfahrungen
austauschen, Monitoring betreiben, miteinander
Strategien entwickeln, Ressourcen mobilisieren.
Die UNESCO unterstützt Staaten durch Leitlinien
und Wissenstransfer, finanziert und koordiniert
Schutzmaßnahmen. Denn nur gemeinsam können wir
das Welterbe für die Zukunft bewahren. Ich bin
mir sicher, dass die 47. Sitzung des
Welterbekomitees dafür wichtige Impulse setzen
wird.
Hintergrund
Das
UNESCO-Welterbekomitee tagt vom 6. bis 16. Juli
2025 in Paris. Es ist das wichtigste mit der
Umsetzung der Welterbekonvention betraute
Gremium und entscheidet in der Regel jährlich
über die Einschreibung neuer Kultur- und
Naturstätten in die Welterbeliste und befasst
sich mit dem Erhaltungszustand eingeschriebener
Stätten.
Dem Komitee gehören 21
Vertragsstaaten der Welterbekonvention an.
Derzeit sind das Argentinien, Belgien, Bulgarien
(Vorsitz), Griechenland, Indien, Italien,
Jamaika, Japan, Kasachstan, Katar, Kenia,
Libanon, Mexiko, Ruanda, St. Vincent und die
Grenadinen, Sambia, Senegal, Südkorea, die
Türkei, die Ukraine und Vietnam.
Für die
UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt
sind in diesem Jahr rund 30 Stätten nominiert.
Deutschland hat in diesem Jahr mit
Neuschwanstein, Linderhof, dem Königshaus am
Schachen und Herrenchiemsee die Schlösser König
Ludwigs II. von Bayern zur Aufnahme in die
Welterbeliste vorgeschlagen.

Foto UNESCO-Kommission Deutschland
Auf
der Liste des UNESCO-Welterbes stehen derzeit
1.223 Kultur- und Naturstätten in 168 Ländern.
56 davon gelten als bedroht. Deutschland
verzeichnet aktuell 54 Welterbestätten.
Gefährdete Stätten Das UNESCO-Komitee wird den
Erhaltungszustand von etwa 250 Welterbestätten
prüfen, insbesondere der 56 Orte, die zurzeit
auf der Liste des gefährdeten Welterbes
verzeichnet sind.
Sie sind etwa durch Kriege, den Klimawandel,
Naturkatastrophen oder Baumaßnahmen bedroht.
Externer Link: Neben Einzelmaßnahmen wird
das Komitee über Programme und internationale
Finanzierungsprojekte beraten, mit denen Staaten
beim Schutz und Erhalt ihrer Welterbestätten
unterstützt werden sollen.

4,2 Millionen Photovoltaikanlagen in
Deutschland installiert
• Neuer
Höchstwert: Knapp 14 % der gesamten
Stromeinspeisung im Jahr 2024 aus Photovoltaik
• Wert der importierten Photovoltaikanlagen
in den ersten vier Monaten 2025 gegenüber
Vorjahreszeitraum um knapp 22 % zurückgegangen,
Exporte um knapp 33 %
• Produktion von
Solarmodulen und Solarkollektoren im 1. Quartal
2025 um knapp 51 % beziehungsweise gut 10 %
gegenüber Vorjahresquartal gesunken
Nach
wie vor setzen immer mehr Unternehmen und
private Haushalte in Deutschland auf die Energie
der Sonne zur Stromerzeugung. Im März 2025 waren
auf Dächern und Grundstücken hierzulande gut 4,2
Millionen Photovoltaikanlagen mit einer
Nennleistung von insgesamt rund 98 300 Megawatt
installiert, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt.
Damit nahm die Zahl
der Anlagen gegenüber dem Vorjahresmonat um 23,7
% zu, die installierte Leistung stieg im selben
Zeitraum um 21,9 %. Im März 2024 hatte es gut
3,4 Millionen Photovoltaikanlagen mit einer
Nennleistung von insgesamt rund 80 700 Megawatt
gegeben.
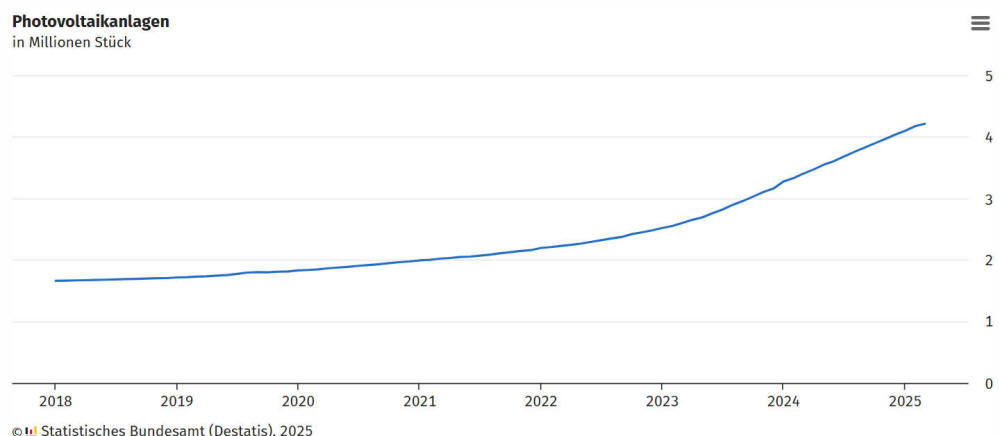
Erfasst werden alle Photovoltaikanlagen, die
in die Netze der öffentlichen Versorgung
einspeisen und über einen Stromzähler verfügen,
der die eingespeisten Strommengen misst.
Kleinere Anlagen, wie etwa die sogenannten
Balkonkraftwerke, fallen daher in der Regel
nicht darunter.
Anteil von Photovoltaik
an der gesamten Stromerzeugung nimmt weiter zu
Durch den Betrieb von Photovoltaikanlagen
wurden 2024 hierzulande rund 59,5 Millionen
Megawattstunden Strom ins Netz eingespeist.
Damit entfielen 13,8 % der gesamten inländischen
Stromproduktion auf Photovoltaik – ein neuer
Höchstwert.
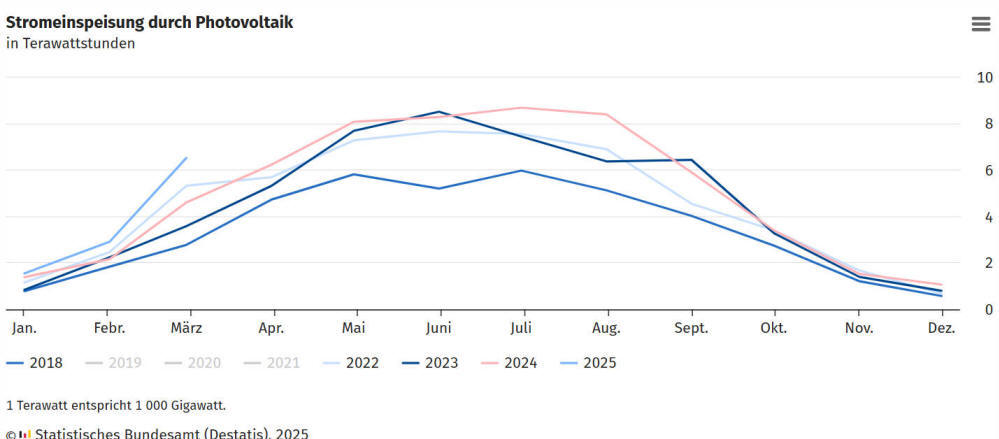
2023 hatte Photovoltaik einen Anteil von
12,0 % an der gesamten Stromeinspeisung
ausgemacht. Rekordmonat für Solarstrom in
Deutschland war bisher der Juli 2024: Mit knapp
8,7 Millionen Megawattstunden wurde mehr als ein
Viertel (27,4 %) des eingespeisten Stroms in
jenem Monat mithilfe von Photovoltaikanlagen
erzeugt.
China wichtigster Lieferant von
Photovoltaikanlagen für den deutschen Markt
Daten zu Importen und Produktion von
Photovoltaikanlagen in den ersten Monaten 2025
können einen ersten Hinweis auf die Entwicklung
der installierten Anlagen in diesem Jahr geben.
Die Importe von Photovoltaikanlagen sind
in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 stark
zurückgegangen: Von Januar bis April sank der
Wert der eingeführten Solarzellen und
Solarmodule gegenüber dem Vorjahreszeitraum um
mehr als ein Fünftel (21,5 %) auf gut
402 Millionen Euro. Auch der Wert der
exportierten Photovoltaikanlagen sank in diesem
Zeitraum von rund 189 Millionen Euro auf knapp
127 Millionen Euro – ein Rückgang von knapp
einem Drittel (32,9 %). Im Jahr 2024 sind
Photovoltaikanlagen im Wert von gut
1,8 Milliarden Euro nach
Deutschland
importiert worden. Gegenüber dem Vorjahr hatte
sich der Wert damit bereits knapp halbiert
(-49,2 %). China ist aus deutscher Sicht mit
Abstand das wichtigste Herkunftsland für
Photovoltaikanlagen: 85,8 % der nach Deutschland
eingeführten Photovoltaikanlagen kamen 2024 aus
der Volksrepublik. Danach folgten mit großem
Abstand die Niederlande (7,5 %) und Dänemark
(1,2 %).
Der Importwert von
Photovoltaikanlagen war 2024 mehr als dreimal so
hoch wie der Exportwert dieser Waren aus
Deutschland. Exportiert wurden im vergangenen
Jahr Photovoltaikanlagen im Wert von gut
510 Millionen Euro – mehr als die Hälfte
(56,6 %) weniger als ein Jahr zuvor. Diese
gingen zu einem großen Teil in europäische
Staaten.
Die wichtigsten Abnehmer waren
2024 Österreich (12,8 %), Italien (11,3 %) und
die Schweiz (11,2 %). Produktion von
Solarmodulen und Solarkollektoren mit deutlichen
Rückgängen Die Produktion von Solarmodulen für
Photovoltaikanlagen ist in Deutschland im
1. Quartal 2025 ebenfalls deutlich gesunken:
Gegenüber dem Vorjahresquartal ging die Zahl der
produzierten Solarmodule um mehr als die Hälfte
(50,7 %) auf gut 227 000 Stück zurück.
Weniger stark als bei Solarmodulen fiel der
Produktionsrückgang bei Solarkollektoren aus.
Diese wandeln Sonnenenergie in Wärme um, sowohl
für die Warmwassererzeugung als auch zum Heizen.
Während im 1. Quartal 2024 noch knapp 21 300
Solarkollektoren hergestellt wurden, waren es
von Januar bis März 2025 rund 19 100. Das
entspricht einem Rückgang von 10,3 %. Bereits im
vergangenen Jahr ist die Produktion von
Solarmodulen hierzulande deutlich
zurückgegangen.
2024 wurden gut
1,5 Millionen Solarmodule zum Absatz produziert.
Damit hatte sich die Produktion gegenüber dem
Vorjahr mehr als halbiert (-56,2 %). 2023 waren
knapp 3,5 Millionen solcher Module hergestellt
worden. Ein ähnlich starker Rückgang zeigt sich
bei den Solarkollektoren: Im Jahr 2024 wurden in
Deutschland knapp 88 900 Stück produziert, mehr
als die Hälfte (53,7 %) weniger als noch ein
Jahr zuvor (192 000).
NRW:
Obstbaubetriebe erwarten 2025 die höchste
Süßkirschenernte der vergangenen zehn Jahre
* Nach einer ersten Schätzung werden
1.567 Tonnen Kirschen auf 140 Hektar Anbaufläche
geerntet.
* Erntemenge von Süßkirschen um
fast 40 % und Sauerkirschen um über 20 % über
dem Vorjahr.
Die nordrhein-westfälischen
Obstbaubetriebe erwarten in diesem Sommer mit
1.567 Tonnen Kirschen eine um 37,5 % höhere
Ernte als im Vorjahr. Wie Information und
Technik Nordrhein-Westfalen als statistisches
Landesamt nach einer ersten Ernteschätzung
mitteilt, wird bei Süßkirschen eine Erntemenge
von 1.400 Tonnen erwartet.
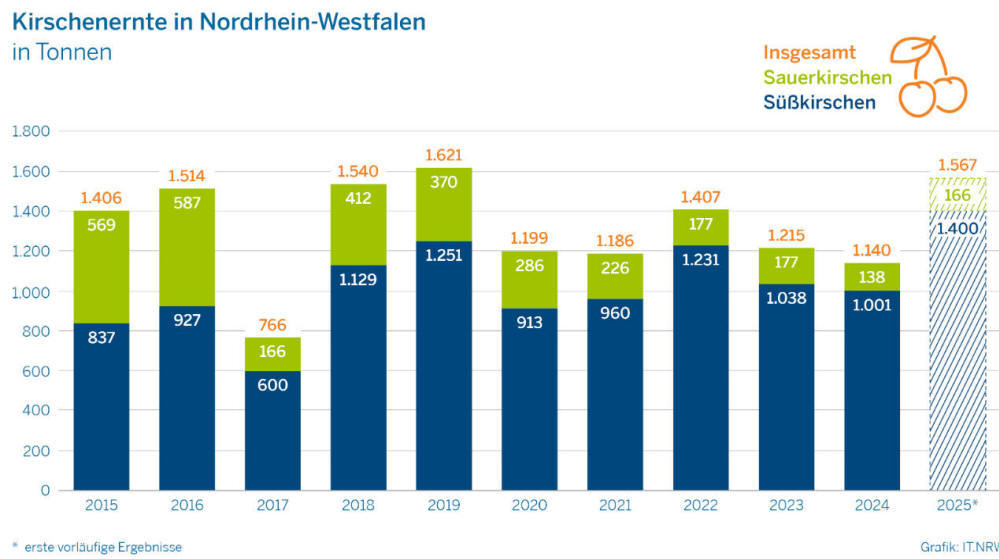
Das wären nicht nur 39,8 % mehr als 2024,
sondern auch die höchste Erntemenge innerhalb
der vergangenen zehn Jahre. Auch bei
Sauerkirschen rechnen die Obstbaubetriebe mit
166 Tonnen mit einer um 20,4 % höheren
Erntemenge als im Jahr zuvor. Wie das
Statistische Landesamt weiter mitteilt, stehen
die Kirschbäume der nordrhein-westfälischen
Obstbaubetriebe auf einer Fläche von 140 Hektar:
Süßkirschen werden auf 118 Hektar und
Sauerkirschen auf 22 Hektar angebaut. Die
Flächenangaben stammen aus der letzten
Baumobstanbauerhebung im Jahr 2022.
|