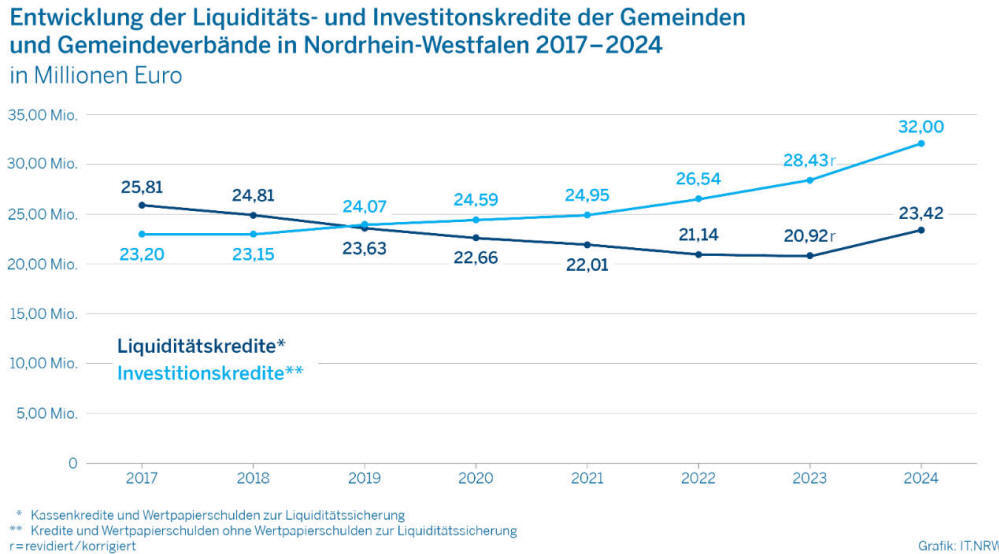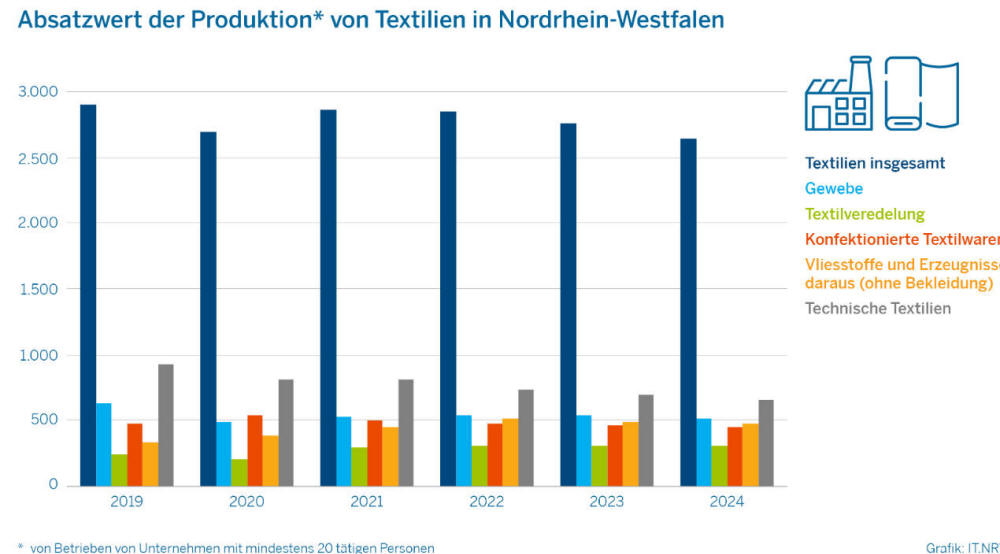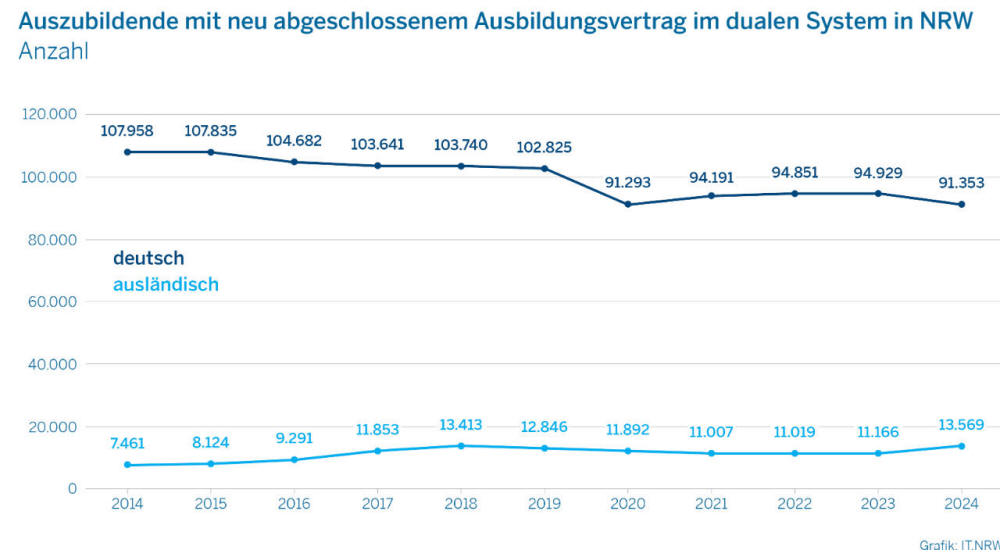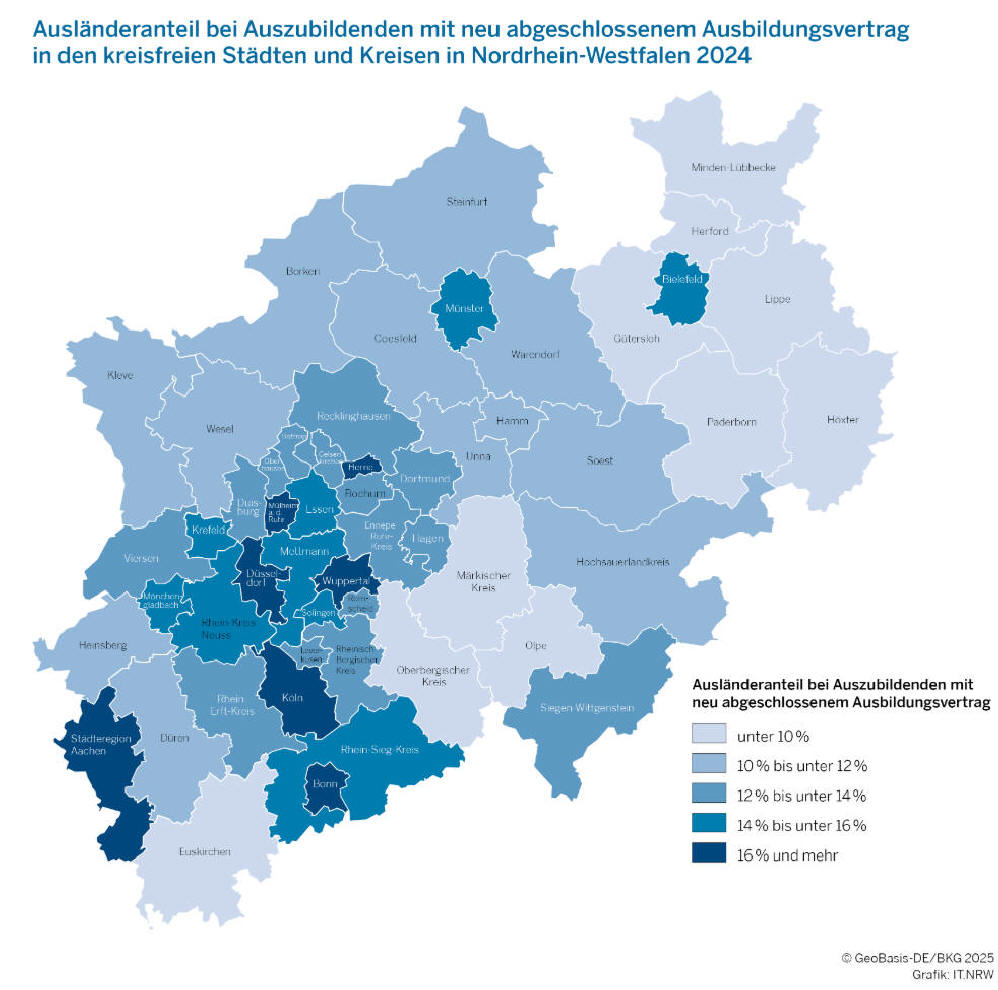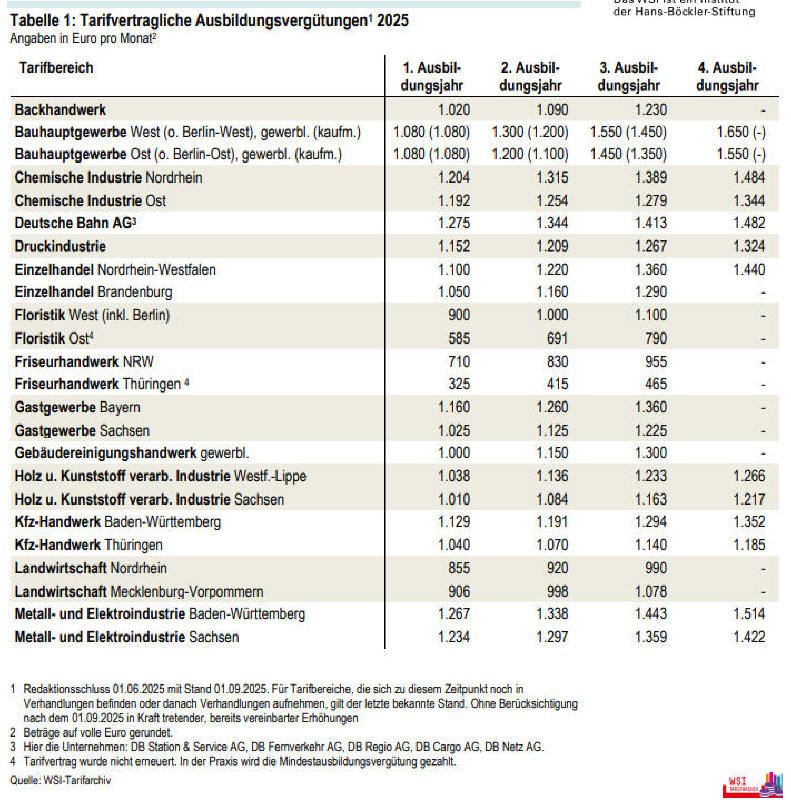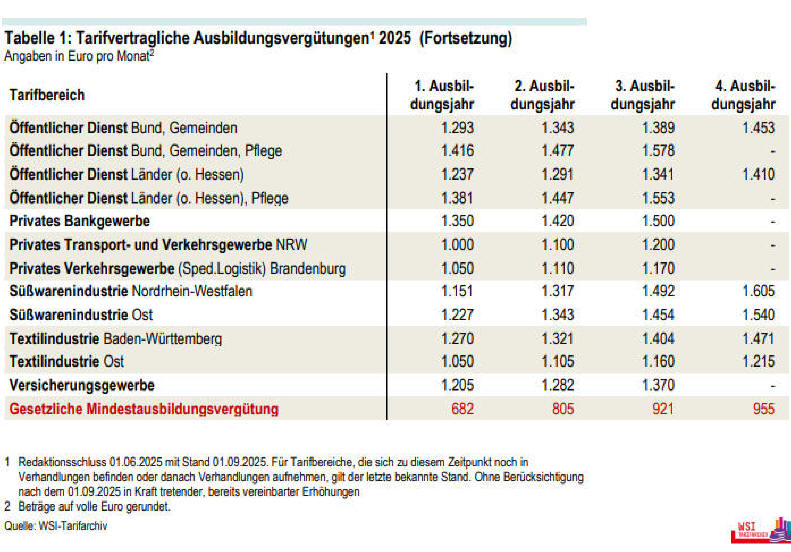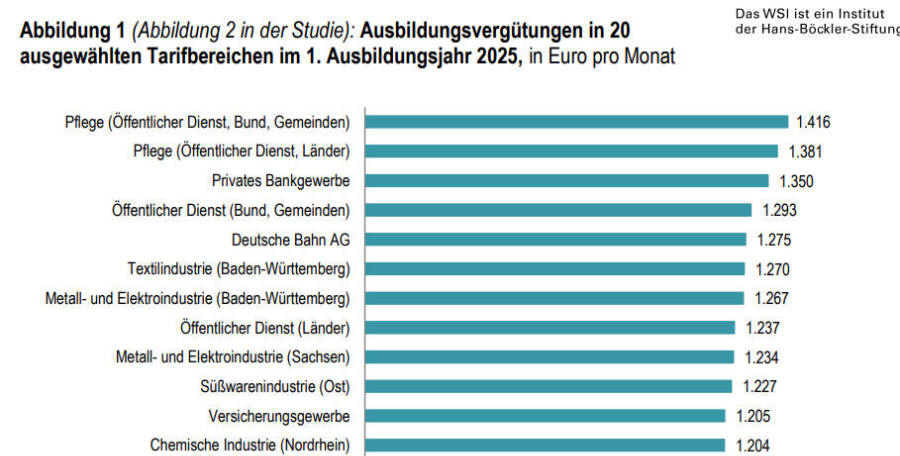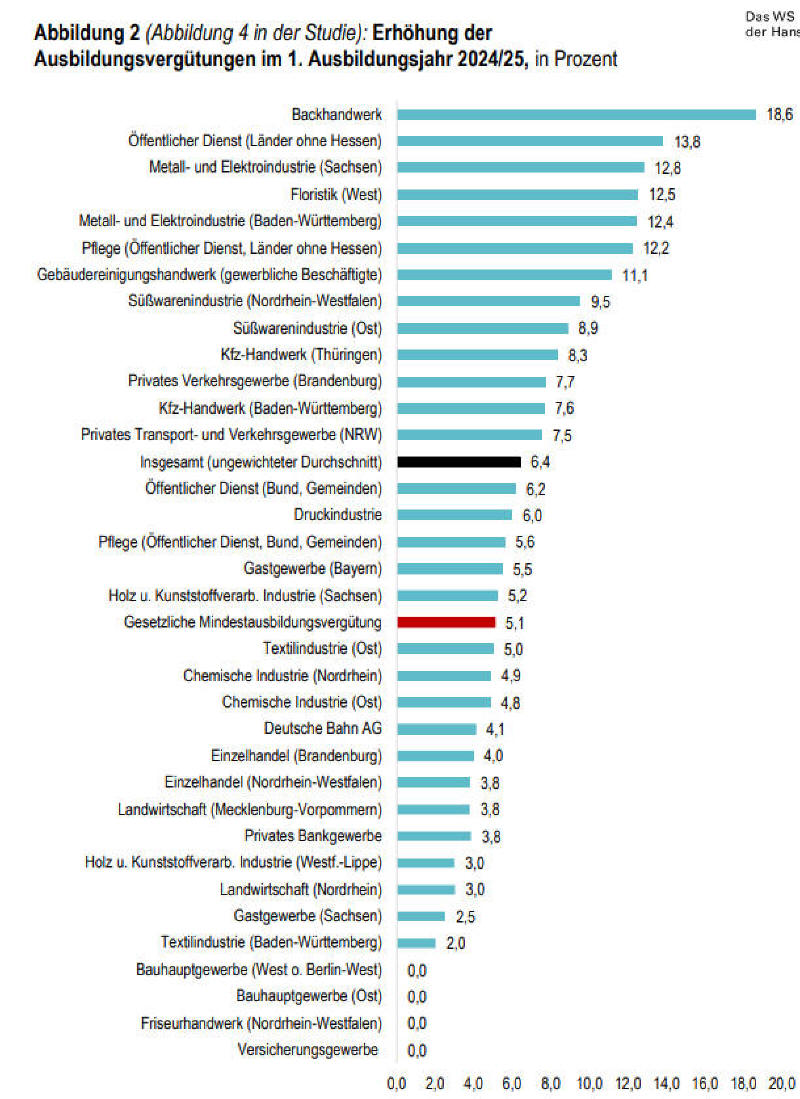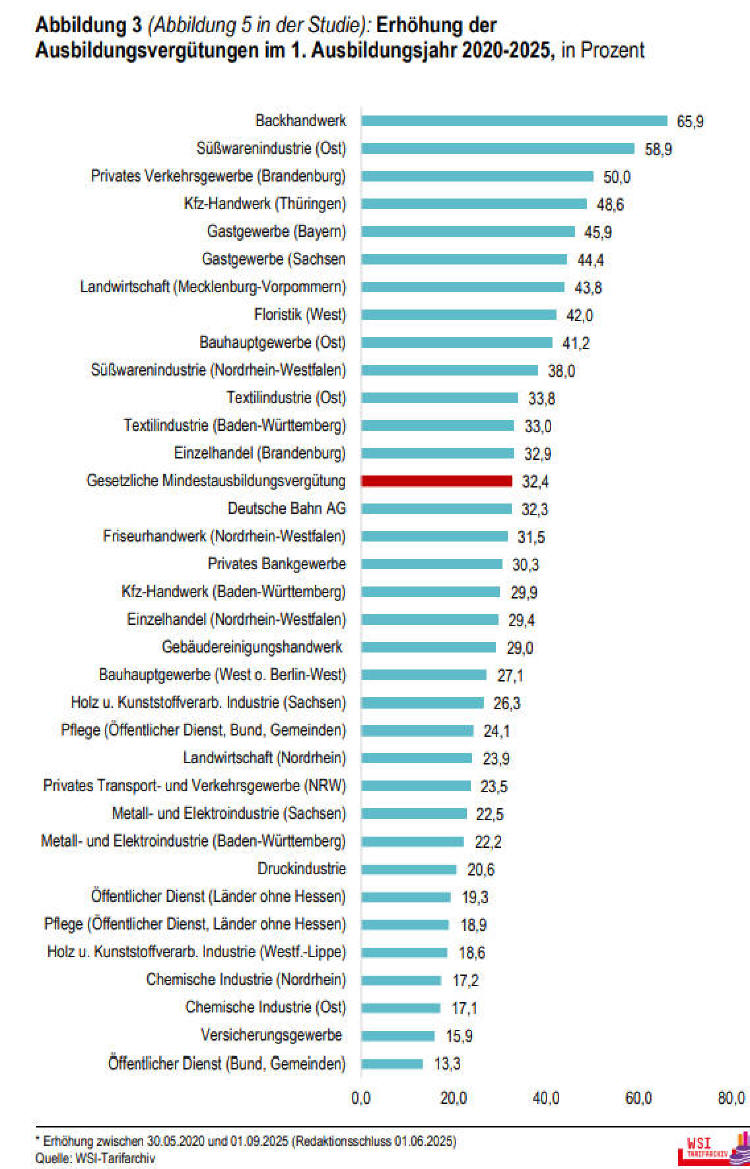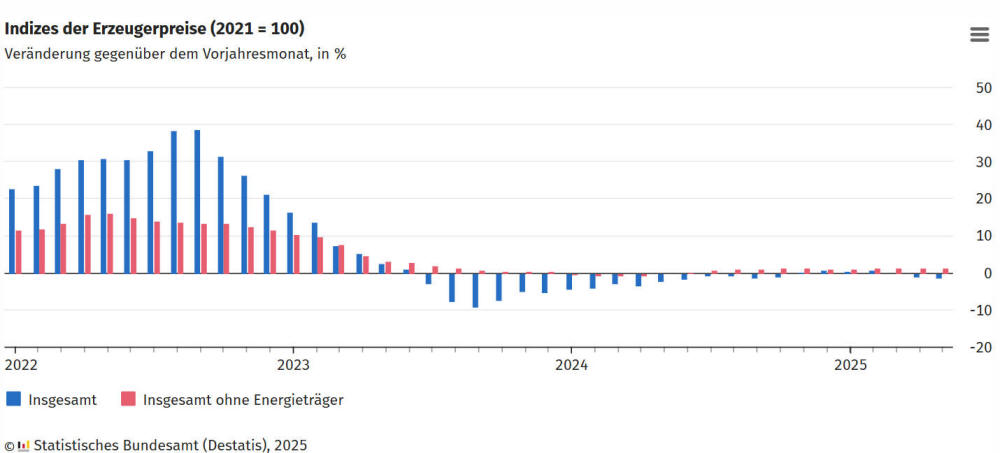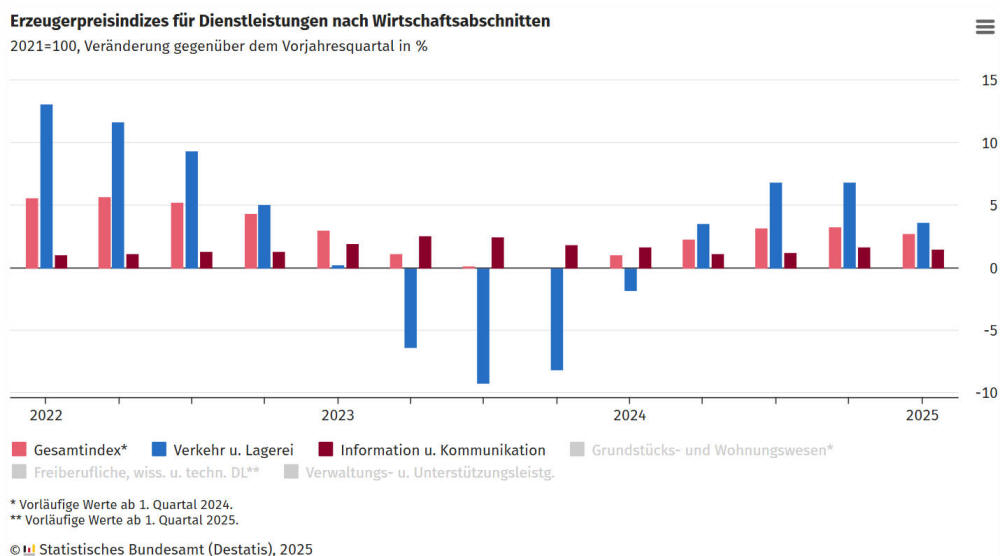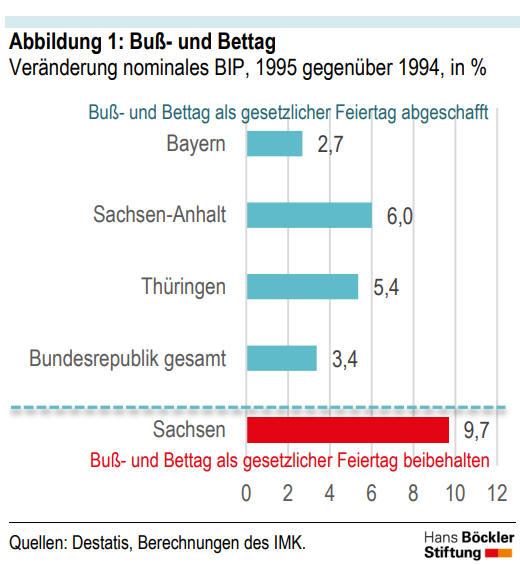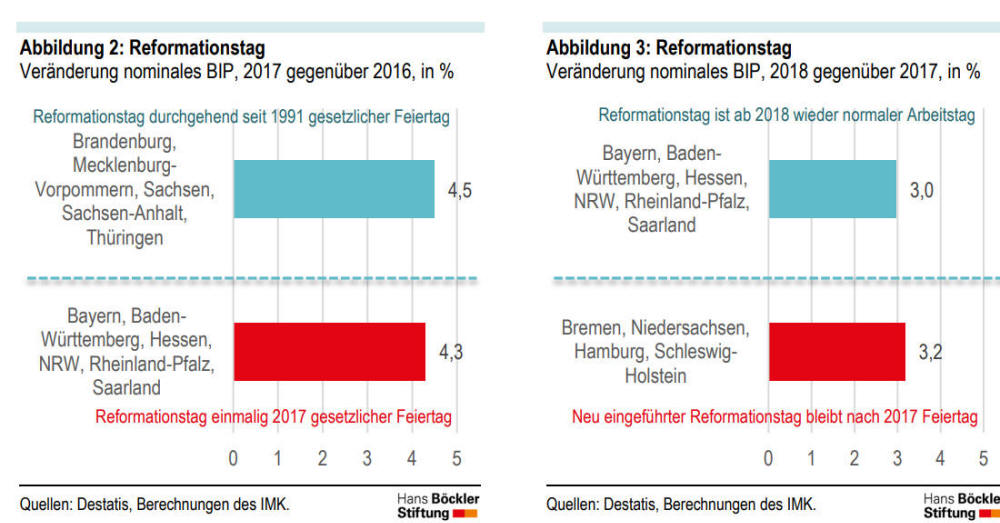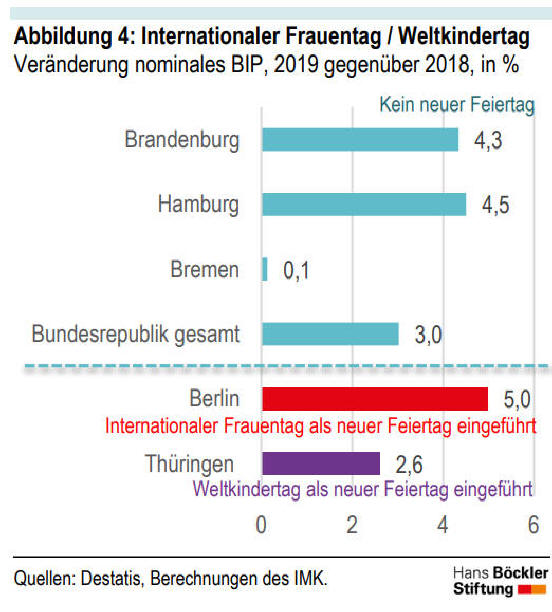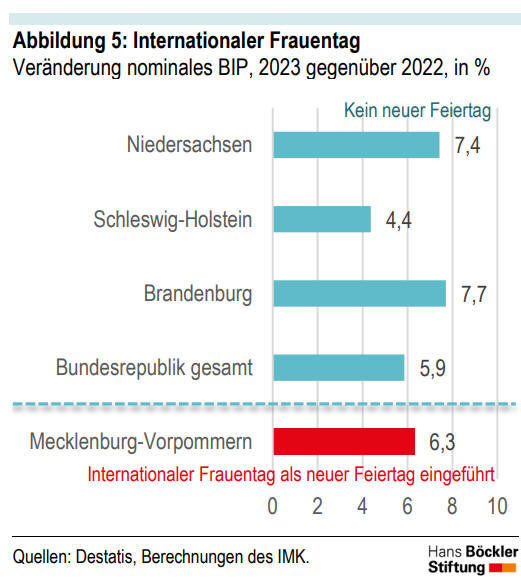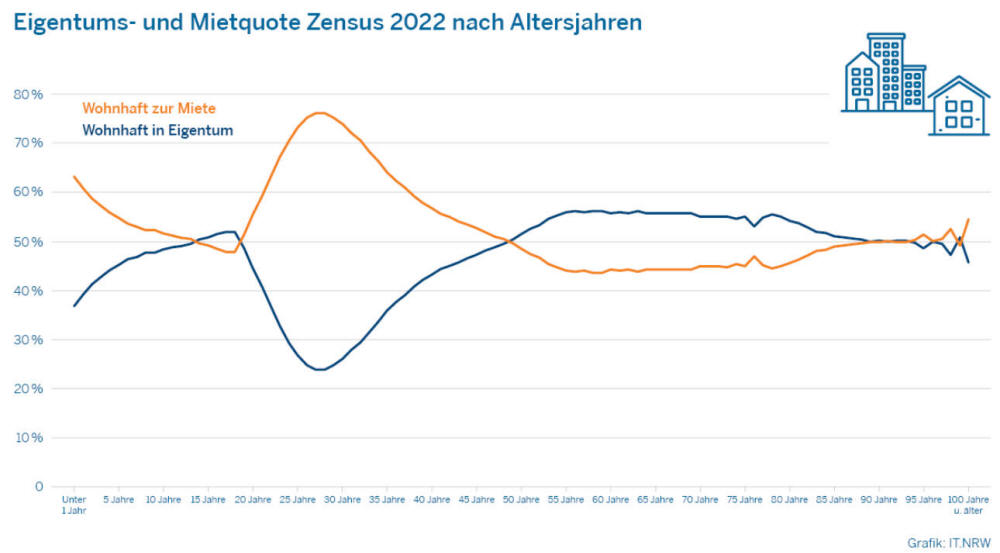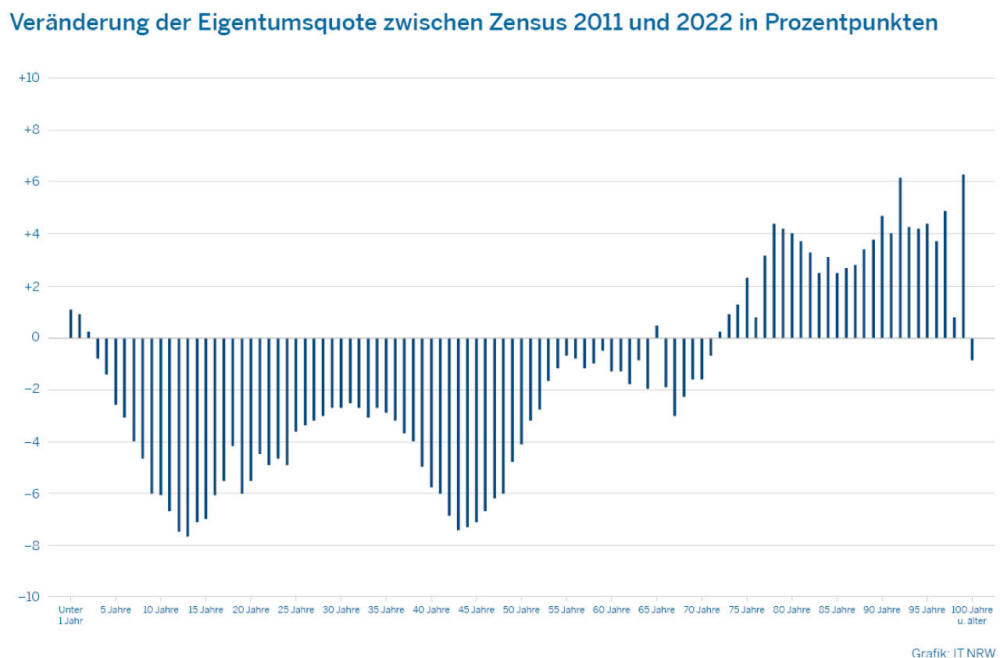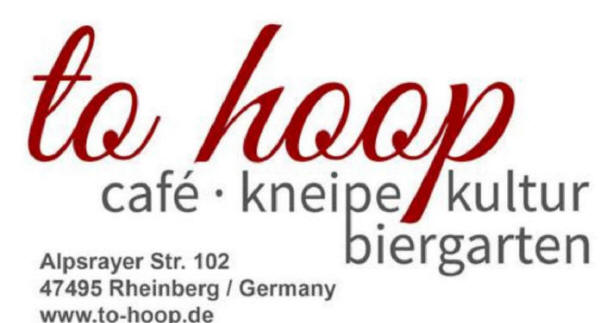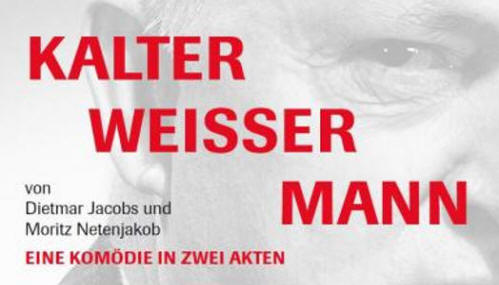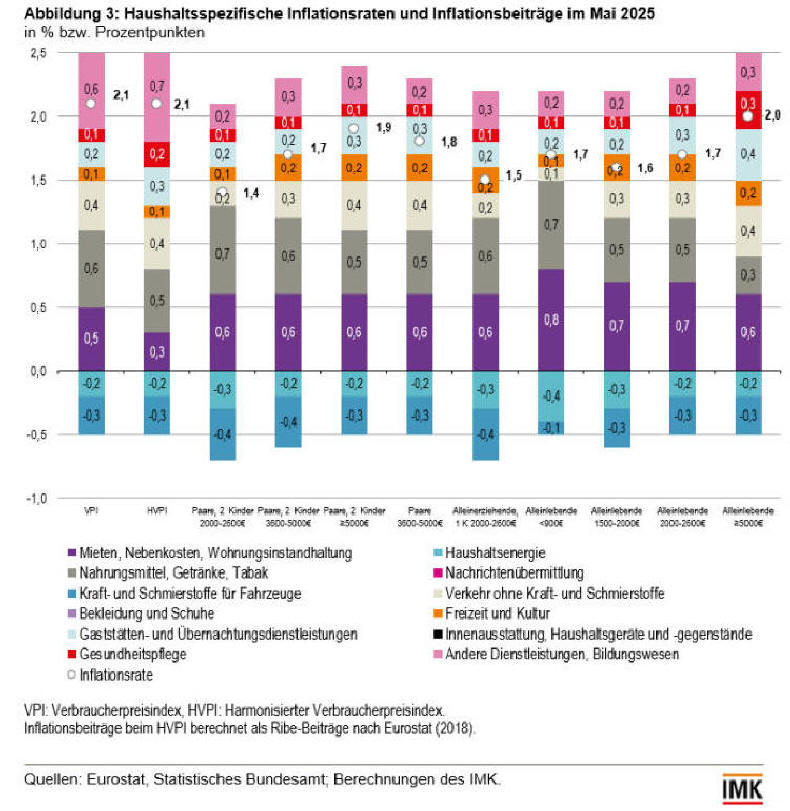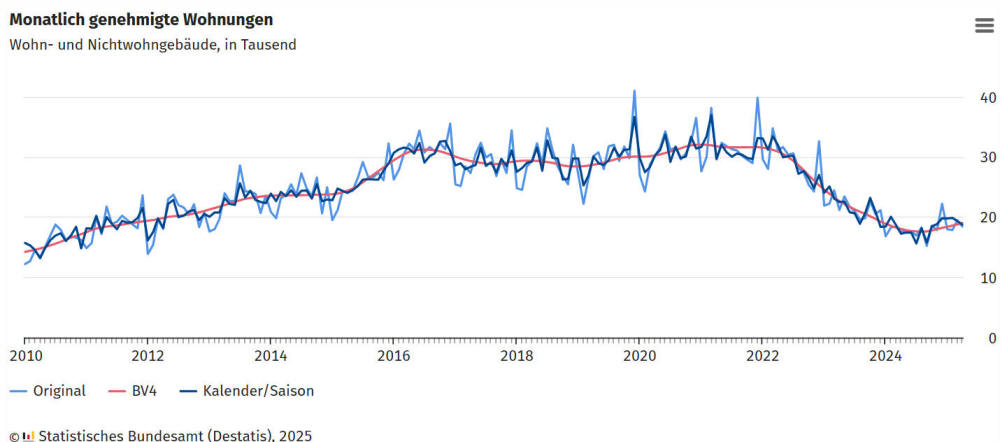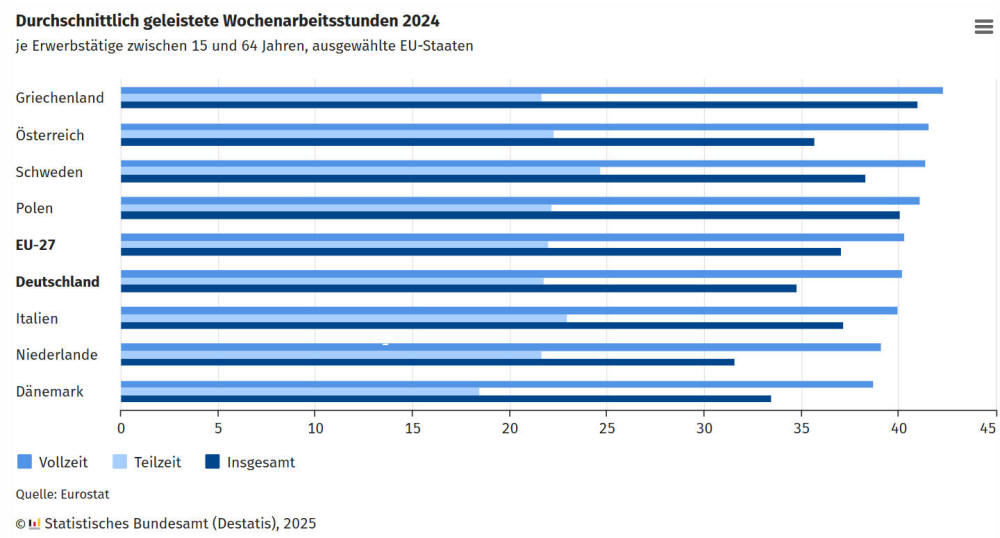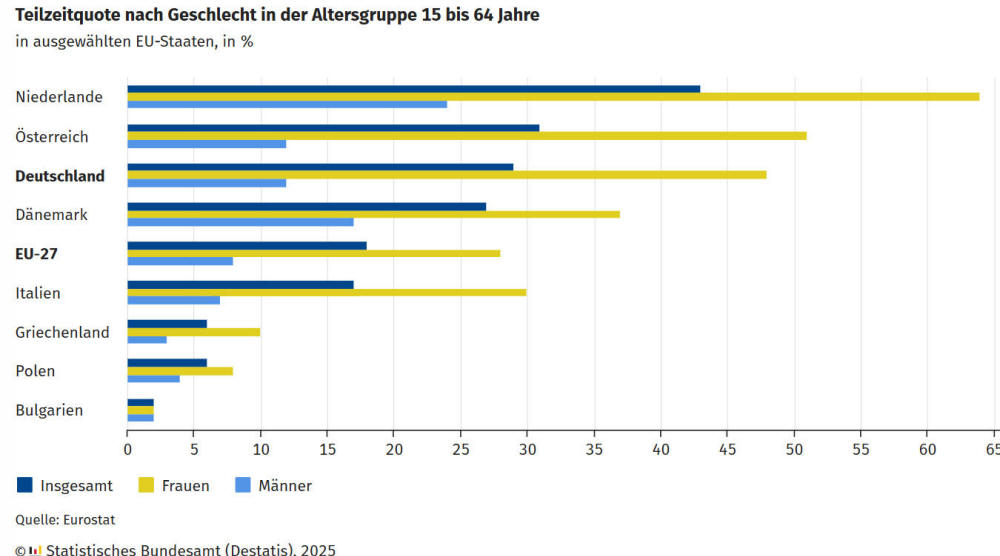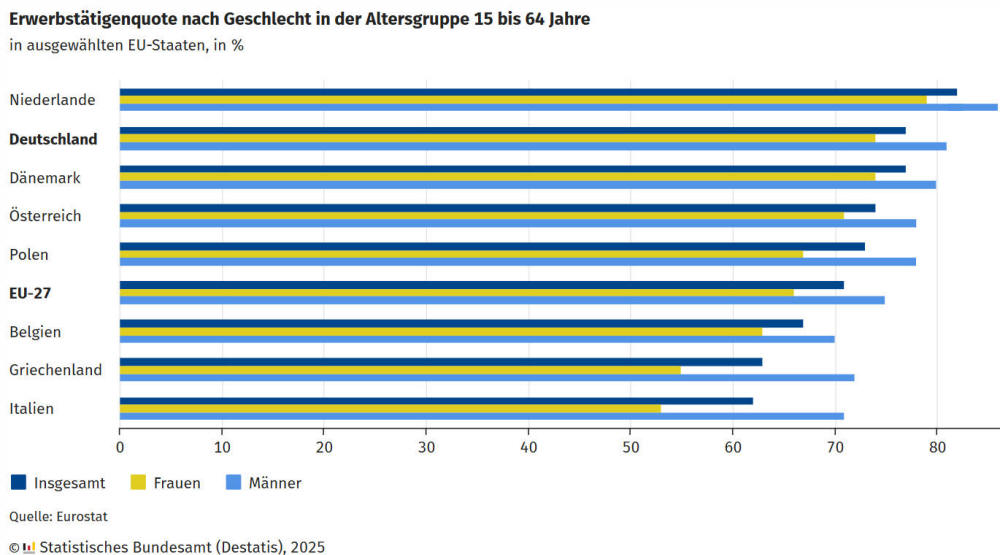|
Samstag, 28., Sonntag, 29. Juni 2025
Verband Wohneigentum kritisiert
Stromsteuer-Beschluss "Regierung verspielt
Vertrauen"
Der gemeinnützige Verband Wohneigentum
kritisiert in aller Schärfe den Beschluss der
Bundesregierung, die Stromsteuer nur für
Industrie und Landwirtschaft abzusenken und
Verbraucher*innen von dieser Entlastung
auszunehmen. "Das ist den Bürgerinnen und
Bürgern nicht vermittelbar, die seit Jahren
unter steigenden Kosten leiden und dringend
Entlastung bei den Wohnkosten brauchen. Hier
wird eine wichtige Chance vertan", erklärt
Verbandspräsident Peter Wegner.
Wegner
warnt: "Wer seine Regierungsarbeit mit
kassierten Wahlversprechen und einem Bruch des
Koalitionsvertrags beginnt, verspielt Vertrauen
und leistet Politikverdrossenheit Vorschub."
Der gemeinnützige Eigentümerverband fordert
dringend dazu auf, den Koalitionsvertrag
einzuhalten und die Stromsteuer für alle auf das
europäische Mindestmaß zu senken. Die
Energie-Transformation im Gebäudebereich werde
vor allem in Richtung Strom gedacht, so Wegner,
"eine Stromkosten-Entlastung kann die
Energiewende unterstützen, die sich sonst viele
nicht werden leisten können."
„WasserVision – Wasser ist Leben“:
Nachhaltigkeitsbildung in Wesel
Am
Dienstag, 24. Juni 2025, war die bundesweite
Bildungsveranstaltung „WasserVision – Wasser ist
Leben.“ zu Gast in Wesel. Rund 390 Schülerinnen
und Schüler des Andreas-Vesalius-Gymnasiums
setzten sich im Bühnenhaus der Stadt Wesel
intensiv mit dem Thema Wasser als zentrale
Lebensgrundlage auseinander.

Der Kreis Wesel, Fachdienst Umwelt und die
Fachstelle Europa und nachhaltige
Kreisentwicklung, unterstützte das
Bildungsprojekt gemeinsam mit der Weseler STAR
Piping Systems GmbH und unterstreicht damit die
Bedeutung eines nachhaltigen und
verantwortungsvollen Umgangs mit der Ressource
Wasser – lokal wie global.

Die interaktive Veranstaltung vermittelte Wissen
zu Wasserverbrauch, -verschmutzung, Klimawandel
und globaler Gerechtigkeit mit dem Ziel,
Jugendliche zu sensibilisieren und zu
motivieren, sich aktiv für eine zukunftsfähige
Wasserwirtschaft einzusetzen.
Moers: Hitze zu Wochenbeginn wirkt auf
Abfallabfuhr - Abfalltonnen und gelbe Säcke
sollten zu Wochenbeginn ab sechs Uhr an Straßen
stehen
Für die kommende Woche
erwarten Meteorologen auch am Niederrhein
hochsommerliche Bedingungen. Bei gerade zu
Wochenbeginn angekündigten Temperaturen jenseits
der 30-Grad-Marke lauern besonders bei
körperlichen Arbeiten im Freien Gefahren. Um
denen vorzubeugen, wird die ENNI Stadt & Service
Niederrhein (Enni) vom kommenden Montag, 30.
Juni 2025 bis einschließlich Mittwoch, 2. Juli
2025 die Arbeitszeiten in der Abfallentsorgung
anpassen.
Dann werden die Müllwerker
bereits um sechs Uhr in ihre Touren durch das
Stadtgebiet starten, wo sie täglich bis zu 1.000
Abfalltonnen leeren. Der zuständige
Abteilungsleiter Ulrich Kempken bittet daher
anders als sonst üblich, die Abfalltonnen für
den Restabfall, das Altpapier und die Bioabfälle
bereits abends zuvor oder am Abfuhrtag bis sechs
Uhr an die Straßen zu stellen.
Auch
Sperrgut und gelbe Tonnen und Säcke sollten dann
ausnahmsweise früher herausgestellt sein. „Ich
denke, dass Moerser uns in dieser Situation
unterstützen“, dankt Kempken Bürgern schon jetzt
für das Verständnis, wenn es früh morgens
eventuell etwas lauter als üblich wird.
Notfallsanitäterschule für den Kreis
Wesel wurde auf den Weg gebracht
Der Kreis Wesel ist seinem Ansinnen, eine
Notfallsanitäterschule im Kreisgebiet
anzusiedeln, ein großes Stück weitergekommen.
Nach intensiver Vorbereitung konnte am Montag,
23. Juni, dem Ausschuss für Gesundheit,
Bevölkerungs- und Verbraucherschutz der Entwurf
eines Gründungsvertrags präsentiert werden.
Die Notfallsanitäterschule entsteht in
Kooperation mit der Stiftung Krankenhaus
Bethanien. Sie wird in deren Räumlichkeiten in
Moers errichtet werden und ab dem
Ausbildungsjahr 2026 eine auf den Kreis und
seine Bedürfnisse abgestimmte Ausbildung von
Notfallsanitätern ermöglichen. Diese wichtige
Entwicklung wurde vom Fachausschuss einstimmig
befürwortet.
Die weitere Beratung
erfolgt im Kreisausschuss und Kreistag. Der
Kreistag wird am Donnerstag, 10. Juli,
abschließend über das Vertragswerk abstimmen.
Notfallsanitäter gehören zur Standardbesatzung
von Rettungsfahrzeugen. Sie sind für die
medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten
zuständig und führen eigenständig diagnostische
Maßnahmen durch.
Sie leisten erweiterte
medizinische Hilfe und koordinieren den
Transport ins Krankenhaus. Sowohl die Stadt
Moers als auch der DRK Kreisverband Niederrhein
e. V. können sich grundsätzlich vorstellen, ihre
Notfallsanitäter künftig an der kreiseigenen
Schule ausbilden zu lassen. Die Schule wird
allen interessierten Akteuren im Rettungsdienst
offenstehen.
50 Jahre Kreis Wesel: Jetzt Kopfweiden
Bonsai gewinnen!
Im Rahmen seines Jubiläumsjahres verlost der
Kreis Wesel insgesamt fünf Bonsai Versionen des
Kreis Weseler Wappenbaums: der Kopfweide. Das
Gewinnspiel läuft von Montag, 30. Juni 2025, bis
Freitag, 4. Juli 2025. Teilnehmende
(Mindestalter 18 Jahre) müssen begründen, warum
gerade Sie einen Kopfweiden-Bonsai erhalten
sollten.
Die Gewinner werden ausgelost.
Das Gewinnspiel sowie die Teilnahme- und
Datenschutzbedingungen werden ab dem 30. Juni
2025 unter https://beteiligung.nrw.de/k/-L13jp7TVfrei
geschaltet. Landrat Ingo Brohl: „Die Kopfweide
ist weit mehr als nur ein Baum – sie ist ein
lebendiges Symbol für unsere niederrheinische
Heimat und steht wie kaum etwas Anderes für die
Natur- und Kulturlandschaft im Kreis Wesel.
Gerade im Jubiläumsjahr ist es uns ein
Anliegen, dieses besondere Stück Heimat auf ganz
persönliche Weise erlebbar zu machen. Mit
unseren Kopfweiden-Bonsais bringen wir ein
kleines, aber bedeutungsvolles Stück
Kreisgeschichte direkt zu den Menschen.“
Eingetopft sind die Kopfweiden-Bonsais in
individuelle Tontöpfe, die von den Schülerinnen
und Schülern der kreiseigenen Förderschulen
Hilda-Heinemann-Schule (Moers), Bönninghardt
Schule (Alpen) und der Schule am Ring (Wesel)
haben im Rahmen ihres Kunst-Unterrichts
angefertigt wurden.
Die Gewinner werden
per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt und
können dann ihre Bonsais bei der Kreisverwaltung
in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel,
abholen.

Kopfweiden-Bonsai
Wesel: Auch mit Gerüst und Bildfolie ein
historisch anziehender Anlaufpunkt – Arbeiten am
Berliner Tor beginnen
Seit einigen Tagen laufen die vorbereitenden
Arbeiten für die Sanierung des Gesimses am
Berliner Tor. Dazu wird derzeit an der Ostseite
des bekannten Weseler Baudenkmals ein
Fassadengerüst montiert. Dieses Gerüst
ermöglicht den Fachfirmen einen gefahrlosen
Zugang zu den beschädigten Stellen.
Um
den optischen Eindruck des Tores zu erhalten,
wird das Fassadengerüst mit einer Bildfolie
versehen. So können Gäste sowie Weselerinnen und
Weseler den Anblick ungestört genießen. Hinter
der Folie beginnen Anfang Juli die Arbeiten, die
schließlich in einer Sanierung des Gesimses
münden werden.
Der erste Bauabschnitt
wird voraussichtlich bis in den Herbst dauern.
Anschließend werden auf Grundlage der gewonnenen
Erkenntnisse die weiteren Schritte geplant und
umgesetzt. Trotz Gerüst und Bauarbeiten gastiert
das beliebte Brauprojekt weiterhin im Berliner
Tor. Aufgrund des Gerüsts erfolgt der Zugang
jedoch über die Westseite, also aus Richtung der
Fußgängerzone.
Bahnhof
Dinslaken: Bahnsteigerneuerung startet Anfang
Juli
Neubau des Bahnsteigs an Gl. 1/2
•
Fertigstellung des Bahnhofs im kommenden Jahr
• Investition durch Bund, VRR und DB in Höhe
von rund acht Mio. Euro
Die Deutsche Bahn (DB) startet Anfang Juli mit
der Bahnsteigerneuerung am Dinslakener Bahnhof,
der 1856 eröffnet wurde. Baufachleute der DB
beginnen mit der Erneuerung des Bahnsteigs an
Gleis 1/2. Der Bahnsteig wird auf einer Länge
von rund 220 Metern modernisiert und behält
seine Höhe von 76 cm, um einen stufenfreien
Zustieg in die Züge zu ermöglichen. Der
Bahnsteig erhält eine komplett neue Ausstattung
mit modernen Sitzgelegenheiten und Vitrinen.
Auch das Bahnsteigdach wird auf der gesamten
Länge erneuert. Die Bauteams sanieren auch die
Treppe, die aus der Unterführung zum Bahnsteig
an Gleis 1/2 führt.
Insgesamt investieren
der Bund, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und die
Deutsche Bahn rund acht Millionen Euro in die
Modernisierung.
Dinslakens
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel zeigt sich
mit den Ergebnissen für eine Verbesserung der
Situation am Bahnhof vorerst zufrieden. Kurz
nach Ihrem Amtsantritt hatte sie mit
Unterstützung der Bundestagsabgeordneten und
ehemaligen Bürgermeisterin der Stadt Dinslaken
Sabine Weiß, dem Landtagsabgeordneten Stefan
Zimkeit und Mitarbeitenden aus der
Stadtverwaltung persönliche Gespräche mit der
Deutschen Bahn geführt, um eine Verbesserung der
Situation am Bahnhof herbeizuführen. „Als
ehemalige Berufspendlerin die täglich auf den
Zugverkehr nach Düsseldorf angewiesen war, fand
ich den Zustand unseres Bahnhofs schon damals
eine Zumutung.
In vielen Gesprächen und
Arbeitsterminen wurden gute Lösungen für den
Bahnhof und das Empfangsgebäude erarbeitet.
Erste Verbesserungsmaßnahmen werden bereits
umgesetzt. Mit den Plänen für die Restaurierung
des gesamten Bahnhofsgebäudes bin ich sehr
zufrieden. Probleme bereitet aktuell die
schwierige Haushaltssituation der Stadt
Dinslaken. Trotz der schwierigen Finanzlage der
Stadt halten wir an diesen Plänen fest. Wir
benötigen Investitionen in die Zukunft, auch in
finanziell schwierigen Zeiten. Der Bahnhof ist
für viele Menschen in unserer Stadt ein Ort, den
sie täglich aufsuchen, und auch das Eingangstor
für Gäste unserer Stadt.
Sie gewinnen
hier am Bahnhof, den ersten Eindruck von unserer
Stadt. Mir ist es ein großes Anliegen, dass sich
sowohl die Dinslakenerinnen und Dinslakener als
auch unsere Gäste am Bahnhof sicher und
willkommen fühlen. Die Nachteile durch die
Baustelle nehmen viele Menschen in unserer Stadt
sicherlich gerne in Kauf, wenn nun endlich erste
Verbesserungen am Bahnhof dadurch erreicht
werden.“
Auswirkungen auf den Zugverkehr
Für die Bahnsteigarbeiten sind Sperrpausen
notwendig, also Zeiten, in denen keine Züge
fahren. Hierfür können die Bauteams die
geplanten Sperrungen während der Bauarbeiten auf
der Ausbaustrecke zwischen Emmerich und
Oberhausen nutzen. Von Freitag, 27. Juni, bis
Sonntag, 24. August, ist die Strecke zwischen
Oberhausen Hbf und Wesel bzw. Bocholt / Arnhem
Centraal komplett gesperrt.
Die Züge der
Linien RE 5 (RRX, National Express), RE 19
(VIAS) und RE 49 (DB Regio) fallen auf dem o.g.
Abschnitt aus. Als Ersatz fahren Busse. Die
konkreten Auswirkungen auf den Zugverkehr finden
Sie hier.
Die Fahrplanänderungen sind in den
Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn
enthalten und werden über Aushänge an den
Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie
unter bahn.de sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.
Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist
Baulärm leider nicht zu vermeiden. Wir bitten
die Reisenden und Anwohner:innen um Verständnis.
Auswirkungen auf das Bahnhofsumfeld
Die
Baumaßnahme soll bis August 2026 andauern. In
dieser Zeit wird es immer wieder
unterschiedliche Baupausen geben. Mit möglichen
Einschränkungen muss jedoch während der gesamten
Zeit gerechnet werden.
Die Arbeiten
erfolgen straßenseitig von der Bahnstraße aus.
Die bauausführende Firma nutzt dafür mehrere
Flächen der Stadt Dinslaken für die
Baustelleneinrichtung und zur Lagerung
verschiedener Güter. Auch die Fläche des
Parkplatzes am Sendemast in der Bahnstraße und
ein Teil des Wendehammers in der Bahnstraße
werden mitgenutzt.
Während der Maßnahme
werden in diesen Bereichen daher keine
Stellplätze zur Verfügung stehen.
Ersatzstellplätze werden auf der ehemaligen
Wendeschleife der Straßenbahn, westlich des
Empfangsgebäudes, angeboten. Dazu wird die
Fläche in den kommenden Wochen Stück für Stück
hergerichtet und mit einer Schotterschicht
versehen.
Die hier entstehenden
Stellplätze werden entsprechend markiert.
Die Stellplätze im Wendehammer der Bahnstraße
sowie auf dem Parkplatz am Sendemast stehen wie
gewohnt zur Verfügung, bis die Ersatzstellplätze
hergestellt und freigegeben sind. Nach Abschluss
der Arbeiten im August 2026 stehen sowohl die
Stellplätze in der Bahnstraße als auch die
Möglichkeiten in der Wendeschleife zum Parken
zur Verfügung.
Verkehrsführung
Im
Zuge der Baumaßnahme wird die Verkehrsführung im
Bereich Bahnhofsplatz und Bahnstraße geändert.
Es erfolgt eine entsprechende Beschilderung im
Straßenraum. Da der Wendehammer der Bahnstraße
während der Baumaßnahme nur einseitig befahrbar
ist, muss die Bahnstraße zwischen Bahnhofsplatz
und der Fläche am Sendemast als Einbahnstraße
ausgewiesen werden. Das Befahren der Bahnstraße
zwischen Wielandstraße bzw.
Wilhelm-Lantermann-Straße und der Fläche am
Sendemast ist in beide Richtungen möglich.
Über das Sanierungsprogramm S3
Die
Deutsche Bahn verfolgt mit einem übergreifenden
Sanierungsprogramm das Ziel, die Bahn bis 2027
wieder auf Kurs zu bringen und somit an die
Wachstumsziele der Strategie „Starke Schiene“
anzuknüpfen. Das Programm setzt drei klare
Prioritäten: Die Sanierung der Infrastruktur,
die Stabilisierung des Bahnbetriebs und die
Stärkung der Wirtschaftlichkeit. Weitere
Informationen zum Sanierungsprogramm finden Sie
auf der Presseseite der Deutschen Bahn.
Weitere Entwicklung des Bahnhofsgebäudes
Das
Bahnhofsgebäude ist Ende 2024 in das
Landesprogramm „Schöner Ankommen in NRW“
aufgenommen worden. Durch die Förderung soll es
gelingen, die Attraktivität der Bahnhofsgebäude
zu steigern. Die Deutsche Bahn hat gemeinsam mit
der Stadt Dinslaken und der
Bahnflächenentwicklungsgesellschaft (BEG/
NRW.URBAN) ein Grobkonzept erarbeitet, das
aktuell weiterentwickelt wird.
Die
Grobplanung sieht vor, das Empfangsgebäude
grundsätzlich zu erhalten und vollständig zu
sanieren. Die Empfangshalle soll dabei ihren
ursprünglichen Charakter zurückerhalten. Zwei
Flächen zur Versorgung der Reisenden sollen
erhalten bleiben und einen Beitrag zur
attraktiveren Gesamterscheinung des Bahnhofs
leisten.
Teile der ehemaligen Gaststätte
sowie rückwärtige Gebäudeteile sollen für die
Nutzung einer Fahrradstation umgebaut werden.
Die Fahrradstation soll Platz für ca. 450
Fahrräder bieten. Im Obergeschoss des
Empfangsgebäudes ist eine Nutzung durch eine
gemeinnützige Einrichtung mit dem Schwerpunkt
von Integrations- und Bildungskursen vorgesehen.
Große
Blaulichtmeile am Samstag in Wesel
Kreis Wesel feiert 50 Jahre – mit Blaulichtmeile
rund um Kreishaus und Kreisleitstelle. Am 28.
Juni lädt der Kreis Wesel von 11 bis 17 Uhr zur
großen Blaulichtmeile rund um Kreishaus,
Kreispolizeibehörde und Kreisleitstelle an der
Reeser Landstraße in Wesel ein. Anlass ist das
50-jährige Bestehen des Kreises Wesel.
Zahlreiche Polizei-, Feuerwehr- und
Rettungsorganisationen präsentieren sich mit
Einsatzfahrzeugen, Vorführungen, einem bunten
Bühnenprogramm, Führungen durch die Leitstelle
sowie Mitmachaktionen für Kinder. Für das
leibliche Wohl sorgen Food-Trucks und Stände.
Landrat Ingo Brohl: „Ich lade herzlich
ein, die Arbeit unserer Einsatzkräfte hautnah zu
erleben – für die ganze Familie ein spannender
Tag!“ Weitere Infos, das Bühnenprogramm und
Hinweise zur Anreise sind zu finden unter:
www.kreis-wesel.de/veranstaltungskalender/blaulichtmeile-rund-um-das-kreishaus
Landrat Ingo Brohl besucht Projekte der
Grafschaft Moers: Moderner Wohnraum mit sozialem
Anspruch
Im Rahmen eines Vor-Ort-Termins besuchte Landrat
Ingo Brohl am Mittwoch, 25. Juni 2025, gemeinsam
mit Geschäftsführerin Svenja Zimmermann und der
kaufmännischen Leitung Bianca Riepe von der
Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
vier Wohnprojekte in Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn
und Kamp-Lintfort.
Das erste Projekt
führte nach Sonsbeck, wo zwei moderne und
barrierefreie Neubauten entstanden sind. Danach
wurde ein umfassend saniertes Wohnquartier in
Neukirchen-Vluyn besichtigt. Das Projekt zeigt
beispielhaft, wie Bestandsgebäude mit einem
Fokus auf energetische Sanierung und
sozialverträgliche Mietpreise zukunftsfähig
gemacht werden können. Drittes Ziel war
Kamp-Lintfort.
Dort wurden in einem
bestehenden Quartier drei barrierefreie
Neubauten im Zuge einer gelungen Nachverdichtung
gebaut. „Uns ist es wichtig, dass sich unsere
Neubauprojekte - die mit sozialen Fördermitteln
errichtet werden - weder in der Optik der
Außenhülle des Gebäudes noch im Hinblick auf den
Wohnkomfort im Inneren der Wohnungen vom
freifinanzierten Wohnungsbau unterscheiden.
Wir legen Wert auf eine funktionierende
Nachbarschaft und die hohe Nachfrage bestätigt
uns, dass wir mit unserem Angebot den Wünschen
unserer Kunden entsprechen“, so Svenja
Zimmermann, Geschäftsführerin der Grafschaft
Moers.
Bei allen Projekten kamen
Wärmepumpen flächendeckend zum Einsatz, selbst
bei der Sanierung der älteren Gebäude in
Neukirchen-Vluyn. Wo aufgrund baulicher
Gegebenheiten keine Fußbodenheizung möglich war,
wurden größere Heizkörper installiert, um die
Energieeffizienz dennoch zu gewährleisten.
Abgerundet wurde der Besuch mit einer
Besichtigung eines modernen Studentenwohnhauses
direkt neben der Hochschule Rhein-Waal in
Kamp-Lintfort. Das architektonisch markante
Gebäude in Betonoptik bietet zeitgemäßen und
bezahlbaren Wohnraum für Studierende. Zudem
wurde in Kamp-Lintfort ein Wohn- und
Geschäftshaus besichtigt, das sich speziell im
Wohnbereich an Studierende richtet.
Landrat Ingo Brohl: „Die Projekte der Grafschaft
Moers zeigen eindrucksvoll, wie
sozialverantwortlicher Wohnungsbau heute
gelingen kann – modern, nachhaltig und für alle
Generationen und Bedarfe gedacht. Besonders
beeindruckt hat mich, mit wie viel Weitsicht
hier sowohl in neue Quartiere investiert als
auch bestehender Wohnraum klug weiterentwickelt
wird. Das ist gelebte Daseinsvorsorge, wie wir
sie am Niederrhein brauchen. Mein großer Dank
gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihr
Engagement, mit der Grafschaft gute Projekte
umzusetzen, guten Wohnraum zu betreiben und ein
solides kommunales Unternehmen zu haben.“
Die Grafschaft Moers GmbH ist mit rund 2.200
Wohnungen einer der bedeutendsten Anbieter von
Wohnraum am linken Niederrhein. Seit der
Gründung im Jahr 1954 steht das Unternehmen für
sozialen Wohnungsbau, Nachhaltigkeit und
langfristige Bestandshaltung.
Der Kreis
Wesel ist Mehrheitsgesellschafter der kommunale
Wohnbaugesellschaft, verfolgt aber die
Strategie, dass sich auch die kreisangehörigen
Kommunen als Gesellschafter beteiligen können.
Aktuell sind dies Alpen, Schermbeck,
Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Xanten. Die
Grafschaft verfolgt das Ziel, bezahlbaren
Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu
sichern.
„Wohnraum für alle“ – dieser
Gründungsgedanke prägt bis heute die Arbeit der
Grafschaft. Dabei versteht sich das Unternehmen
als Bindeglied zwischen traditionellen Werten
und modernen Wohnkonzepten: konservativ im Sinne
des Werterhalts, modern im Sinne der
konsequenten Weiterentwicklung.
Neben
dem Neubau und der Bewirtschaftung von Wohnraum
übernimmt die Grafschaft auch Aufgaben im
Bereich Städtebau und Infrastrukturentwicklung.

v.l. Landrat Ingo Brohl, Svenja Zimmermann
(Geschäftsführerin Grafschaft Moers), Bianca
Riepe (Kaufmännische Leitung Grafschaft Moers)
Dinslaken: Optimierte
Sperrmüllanmeldung
Infolge des
kürzlich bereitgestellten digitalen
Serviceportals der Stadt Dinslaken wird das
Dienstleistungsportfolio stetig optimiert und
erweitert. So sind mittlerweile ca. 80 digitale
Dienstleistungen im Serviceportal nutzbar. Einer
von diesen Services ist die digitale
Sperrmüllanmeldung. Dieser Service wurde
entsprechend verbessert.
Das
Antragsformular hat sich daher optisch
verändert, bleibt allerdings, wie gewohnt, über
die bekannten Kanäle (Website, Abfall-App,
Serviceportal) digital verfügbar.
Sperrmüllanmeldungen können somit weiterhin rund
um die Uhr eingereicht werden. Die Nutzung der
digitalen Anmeldung bieten den Vorteil, dass die
Anmelder*innen eine Bestätigungsemail erhalten.
Grundsätzlich ist es beim Sperrmüll wichtig,
Folgendes zu beachten:
- Anmeldung bis
Mittwoch 12 Uhr für die folgende Woche, die
Abholtage für Ihre Straße finden Sie im
Abfallkalender oder in der APP.
-
Haushaltsübliche Mengen, 3m³ also ungefähr so
viel, wie ein halber PKW-Stellplatz
- Der
Sperrmüll muss bis 6:30 Uhr an der Straße
stehen
- Achten Sie darauf, dass der
Sperrmüll frühestens am Vorabend der Abholung
rausgestellt wird
- Melden Sie
Elektrogroßgeräte und Metallgegenstände extra an
- Beachten Sie was in den Sperrmüll darf,
z.B.: Bauschutt, Müllsäcke und Restmüll werden
nicht mitgenommen.
Wesel:
Interkulturelle Tage 2025 - Programm
In Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat der
Stadt Wesel hat die Stadt Wesel ein buntes und
abwechslungsreiches Programm für die
Interkulturellen Tage auf die Beine gestellt.
Die Interkulturellen Tage fördern den
kulturellen Austausch und stärken den sozialen
Zusammenhalt in Wesel. Durch vielfältige
Veranstaltungen wird das Bewusstsein für die
Bedeutung einer multikulturellen Gemeinschaft
geschärft.

Vorstellung des Programms
•
3. Juli 2025
Der Startschuss fällt am
Donnerstag, 3. Juli 2025, mit dem Kino
International. Die Vorstellung beginnt um 15:30
Uhr im Comet Kino Center in der Dudelpassage.
Die Flüchtlingshilfe Wesel e. V. unterstützt
und organisiert diesen Programmpunkt.
Um
17:00 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Ulrike
Westkamp die Ausstellung „Schau mich an –
Gesichter der Vielfalt“ im Rathaus Wesel, 1.
Etage, Flur vor dem Büro der Bürgermeisterin.
Die Ausstellung zeigt 22 eindrucksvolle
Portraits von geflüchteten Menschen aus Wesel
und vereint Bilder mit persönlichen Zitaten und
einfühlsam erzählten Kurzgeschichten.
Sie erzählt von Herkunft und Flucht, von
Ankommen, Wurzeln schlagen und von dem Wunsch,
Teil einer neuen Gesellschaft zu werden, ohne
die eigene Geschichte zu verlieren. Das
Fotoprojekt ist eine Kooperation des
Integrationsbüros der Stadt Wesel und der vhs
Wesel-Hamminkeln-Schermbeck. Die Ausstellung
kann von Donnerstag, 3. Juli 2025, bis Freitag,
19. September 2025, während der Öffnungszeiten
des Rathauses besichtigt werden.
Ab 18:00
Uhr findet im Ratssaal ein Empfang für neu
eingebürgerte Deutsche durch die Bürgermeisterin
statt. Mit dem Empfang soll die Entscheidung für
die deutsche Staatsbürgerschaft in feierlichem
Rahmen gewürdigt werden.
•
4. Juli 2025
Am Freitag, 04. Juli
2025, 17:00 Uhr, werden Auszeichnungen als
Wertschätzung für Verdienste in der
Integrationsarbeit, gestiftet von der
Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe,
vergeben. Es handelt sich um die letzte
Auszeichnung in der aktuellen Wahlperiode des
Integrationsrates. Daher wurde in diesem Jahr
entschieden, dass alle sieben eingegangenen
Vorschläge als würdig erachtet werden, eine
Wertschätzung zu erhalten. Jede der
vorgeschlagenen Personen und Initiativen erhält
ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro.
2025
werden ausgezeichnet:
Dieter und Anneliese
Kloß
Klaus-Jürgen Ziegler
BSV Viktoria
Wesel 1910 e.V.
Mehrgenerationenhaus Bogen
Horst Kästner (Malteser Integrationsdienst)
Schahin Dietrich Sharif Pakdaman
Katja
Bördner Bertz
Sie alle leisten einen
wertvollen Beitrag für ein respektvolles,
vielfältiges und solidarisches Zusammenleben in
Wesel. Integration und Chancengleichheit wird
durch ihren Einsatz im Ehrenamt, im
Bildungsbereich oder im Sportverein ganz konkret
gelebt.
Die Verleihung 2025 wird von mehreren
Weseler Schulen unterstützt, darunter die Schule
am Ring, die GGS Innenstadt sowie das
Andreas-Vesalius-Gymnasium. Schülerinnen und
Schüler der teilnehmenden Schulen werden die
Veranstaltung mit vielfältigen Darbietungen
bereichern. Es werden musikalische Aufführungen
und Theatervorstellungen präsentiert, die die
kreative und künstlerische Vielfalt der jungen
Generation zeigen. Die Veranstaltung findet an
der Schule am Ring statt.
•
5. Juli 2025
Der „Bunte Markt der
Möglichkeiten“ am Samstag, 5. Juli 2025, ist ein
vielfältiges und lebendiges Event, das eine
Mischung aus Informationen, Kulturangeboten und
Unterhaltung bietet. Viele Vereine oder
Organisationen präsentieren sich in der Zeit von
11:00 Uhr bis 14:00 Uhr mit ihren Angeboten im
Rathausinnenhof. Besucherinnen und Besucher
erwartet eine Vielzahl an Mitmachangebote,
Angebote für Kinder und ein musikalisches
Rahmenprogramm mit Fesghandis Ramezani.
Ein besonderes Highlight ist das musikalische
Bühnenprogramm, unter anderem mit:
One
Billion Rising – ein kraftvoller Tanz gegen
Gewalt an Frauen,
der Musikgruppe
„handgemacht“ der Lebenshilfe Dorsten,
der
Tanzgruppe Bodywave mit orientalischem Tanz
…
und weiteren tollen Beiträgen.
Wer die
kulturelle Vielfalt und bunte Gesellschaft in
Wesel feiern will, ist herzlich eingeladen
vorbeizuschauen.
•
Zahlen
8.265 Menschen mit einer
ausländischen Staatsangehörigkeit leben in
Wesel. Sie stammen aus über 100 Ländern.
Die
stärksten Gruppen kommen aus
Türkei - 1.272
Ukraine - 863
Arabische Republik Syrien - 825
Polen - 525
Serbien - 423
Irak - 362
Auf zum zweiten Raderlebnistag
Niederrhein im Kreis Wesel!
Am Sonntag, 6. Juli 2025, lädt der Niederrhein
erneut zu einem der größten Radfahrevents
Deutschlands ein. In 56 deutschen und
niederländischen Kommunen stehen 99 individuell
befahrbare Routen zur Auswahl – per GPX-Track
oder als PDF-Download.
Bereits zum
zweiten Mal präsentiert sich der frühere
„Niederrheinische Radwandertag“ im neuen Gewand.
Laut Niederrhein Tourismus wurden technische
Startprobleme aus dem Vorjahr inzwischen
behoben. Im Kreis Wesel sorgen insgesamt 17
Routen, die größtenteils dem bewährten
Knotenpunktnetz folgen, für eine
abwechslungsreiche Auswahl.
Zwischen 10
und 17 Uhr dürfen sich Teilnehmende auf
zahlreiche Aktionen entlang der Strecken freuen:
Info- und Mitmachstände, unterhaltsame Programme
und lokale Besonderheiten sorgen für ein ganz
besonderes Erlebnis. So verwandelt sich die
Schermbecker Mittelstraße in ein lebendiges
Sommerstraßenfest mit verkaufsoffenem Sonntag,
während der Dinslakener Altmarkt ganz im Zeichen
Frankreichs steht – mit landestypischen Händlern
und kulinarischen Spezialitäten.
In
Sonsbeck öffnet die historische Gommansche Mühle
ihre Türen, und Hamminkeln lockt mit einem
Brot-Gewinnspiel samt Frühstücksangebot. In
Voerde (Götterwickerhamm) lädt ein idyllischer
Trödelmarkt am Dorfgemeinschaftshaus direkt am
Rhein zum Stöbern ein. Zwischen Voerde Spellen
und Ork können Tierfreunde auf dem Kolkshof
Büdchen heimische Tiere beobachten und
streicheln, begleitet von Kaffee, Kuchen und
einem Grillstand mit hofeigenem Fleisch.
Die evangelische Kirche bietet an der
Stockumer Schule in Voerde mit einem mobilen
Café und ihrer „Rollenden Kirche“ Raum für eine
entspannte Pause. In Wesel am LVR Museum sind
unter anderem die Kreispolizei mit einem
Pedelec-Simulator und die Kreisverkehrswacht mit
interaktiven Aktionen vertreten. Landrat Ingo
Brohl zeigt sich begeistert, dass der
diesjährige Raderlebnistag unter dem Zeichen des
Jubiläums „50 Jahre Kreis Wesel“ steht.
„Ich freue mich besonders, dass wir an jeder
Route im Kreis kleine Willkommenspakete an die
ersten zehn Teilnehmenden verteilen können.“
Für Familien und kürzere Etappen gibt es
spezielle „Kids-Touren“ im Kreis Wesel. Fünf
kindgerechte Routen mit Strecken zwischen 10 und
36 Kilometern, darunter auch die etwa 28
Kilometer lange Tour rund um Hünxe und
Schermbeck, bieten entspannten Fahrspaß für Groß
und Klein.
Wer lieber in Gesellschaft
fährt, kann sich der 60 Kilometer langen
Gruppentour Nr. 32 anschließen, die um 10 Uhr an
der Stadtinformation in Wesel (Großer Markt)
startet. Die geführte Tour wird vom ADFC
begleitet, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Die zentrale Informationsplattform
zur Veranstaltung, einschließlich
Routenübersicht, GPX-Downloads und vielen
nützlichen Hinweisen, ist auf
www.kreis-wesel.de/radfahren zu finden.
Wer am beliebten Gewinnspiel teilnehmen möchte,
kann sich entweder vorab über die Website von
Niederrhein Tourismus oder direkt am 6. Juli an
den Info-Punkten per QR-Code registrieren. Zu
gewinnen gibt es unter anderem ein hochwertiges
Tourenrad sowie einen Wertgutschein über 250
Euro vom Best Western Plus Hotel Brüggen. Für
alle, die ohne eigenes Rad anreisen, stehen die
apfelgrünen NiederrheinRäder – auch als E-Bike –
an über 30 Stationen im gesamten Gebiet zur
Verfügung und können flexibel ausgeliehen und
zurückgegeben werden.
Weiter
Informationen dazu gibt es unter:
www.niederrhein-tourismus.de/sehen-erleben/fahrradverleih-niederrheinrad.
Kontakt und Information: Kreis Wesel –
EntwicklungsAgentur Wirtschaft, E-Mail: eaw@kreis-wesel.de

v.l. Landrat Ingo Brohl, Yvonne Eimers (EAW),
Lukas Hähnel (Leiter EAW)

NRW: Höchster Stand an Inobhutnahmen zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen seit 2016
* Mehr als 17.300 Inobhutnahmen zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen im Jahr 2024.
*
Mehr als 40 % Inobhutnahmen aufgrund
unbegleiteter Einreise aus dem Ausland.
*
Bei Inobhutnahmen aus weiteren Gründen mehr
Mädchen als Jungen betroffen, insbesondere im
Alter von 14 bis unter 16 Jahren.

C Sewcream - Adobestock
Im Jahr 2024
haben die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen
17.348 Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vorgenommen. Wie Information und
Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt mitteilt, war das der höchste Stand
seit 2016 nach der Fluchtwelle aus Syrien.
Damals hatte es 22.193 Inobhutnahmen gegeben. In
den Folgejahren war die Zahl bis auf rund 12.200
Inobhutnahmen im Jahr 2021 gesunken.
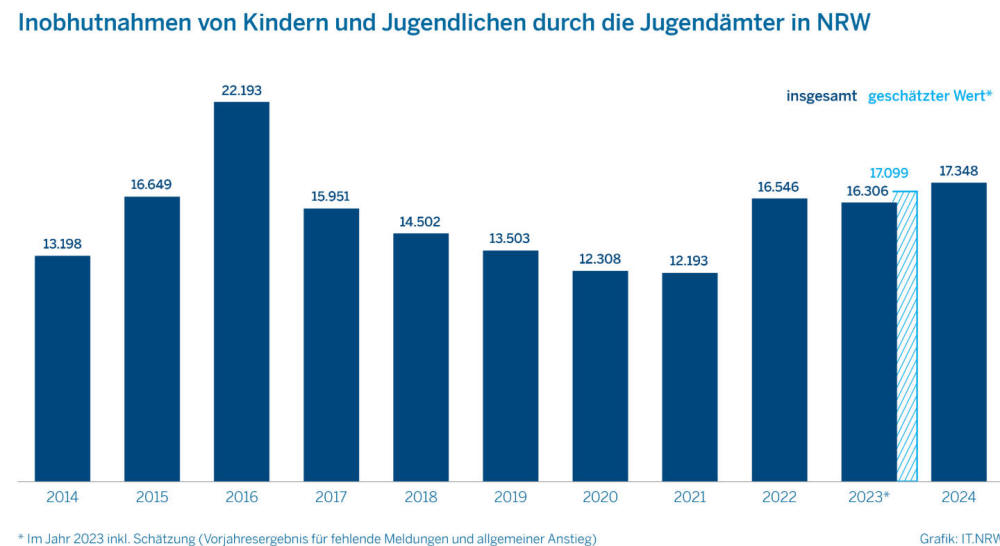
Seit dem Jahr 2022, in dem der Ukrainekrieg
begann, wurden jährlich mehr als 16.000
Inobhutnahmen durchgeführt. Die Jugendämter
nehmen Inobhutnahmen vor, wenn ein unmittelbares
Handeln zum Schutz von Minderjährigen in Eil-
und Notfällen als geboten erscheint. Mehr als 40
Prozent Inobhutnahmen aufgrund unbegleiteter
Einreise aus dem Ausland 7.543 Inobhutnahmen und
damit rund 43 % aller Fälle erfolgten 2024
aufgrund unbegleiteter Einreisen aus dem
Ausland.
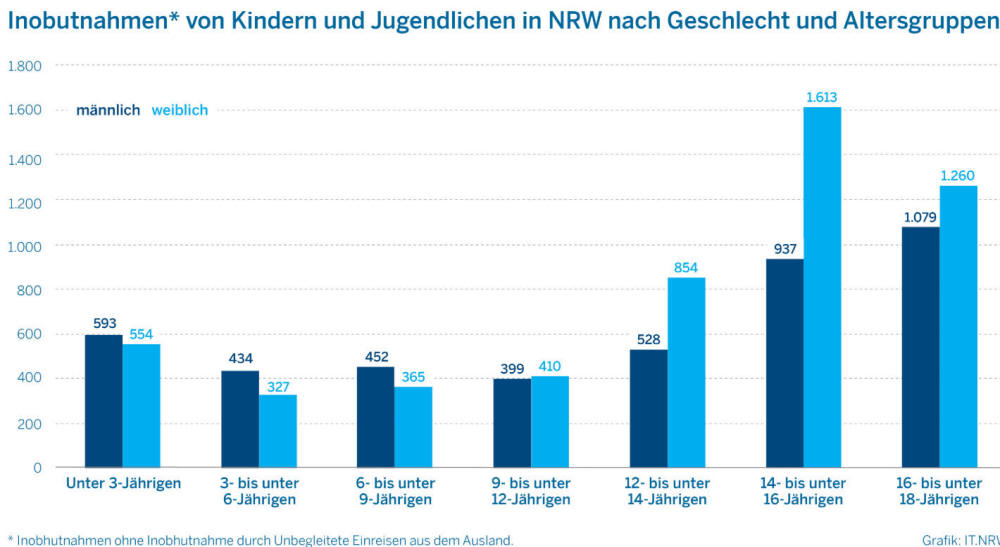
Kinder und Jugendliche, die unbegleitet aus
dem Ausland einreisen, werden zuerst vorläufig
in staatliche Obhut genommen. Danach wird
entschieden, ob eine reguläre Inobhutnahme
erfolgen muss und in welchem Bundesland diese
erfolgt. In der genannten Zahl sind sowohl
vorläufige als auch reguläre Inobhutnahmen
enthalten. Davon betroffen sind mit 6.703 Fällen
überwiegend männliche Jugendliche.
Bei
Inobhutnahmen aus anderen Gründen mehr Mädchen
als Jungen betroffen In den übrigen 57 % der
Fälle nahmen die Jugendämter 2024 Minderjährige
aus anderen Gründen regulär in staatliche Obhut,
etwa wegen einer Überforderung der Eltern oder
wegen Anzeichen für körperliche Misshandlung
oder Vernachlässigung. Von diesen 9.805 Kindern
und Jugendlichen waren 45 % männlich und 55 %
weiblich.
In den unteren Altersgruppen
waren es häufiger Jungen, die aus den Familien
herausgenommen werden mussten. Ab der
Altersklasse 9 bis unter 12 Jahren dreht sich
das Verhältnis. In der Altersklasse 14 bis unter
16 Jahren, in der es 2024 die meisten
Inobhutnahmen gab, wurden beinahe doppelt so
viele Mädchen wie Jungen in staatliche Obhut
genommen.
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im April
2025: -8,0 % zum Vormonat
8,0 % zum Vormonat (real, saison- und
kalenderbereinigt)
+5,7 % zum Vorjahresmonat
(real, kalenderbereinigt)
+6,1 % zum
Vorjahresmonat (nominal)
Umsatz im
Bauhauptgewerbe, April 2025
-1,4 % zum
Vorjahresmonat (real)
+0,9 % zum
Vorjahresmonat (nominal)
Der reale
(preisbereinigte) Auftragseingang im
Bauhauptgewerbe ist im April 2025 gegenüber März
2025 kalender- und saisonbereinigt um 8,0 %
gesunken. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, nahm dabei der
Auftragseingang im Hochbau um 9,3 % zu, während
der Auftragseingang im Tiefbau gegenüber dem von
Großaufträgen geprägten Vormonat um 20,6 % sank.
So hatte der Tiefbau im März 2025 (+34,3
% gegenüber Februar 2025) den höchsten
saisonbereinigten Anstieg seit Beginn der
Zeitreihe im Jahr 1991 verzeichnet. Im weniger
volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender-
und saisonbereinigte Auftragseingang von Februar
2025 bis April 2025 um 2,1 % höher als in den
drei Monaten zuvor (Hochbau: +3,6 %; Tiefbau:
+0,8 %).
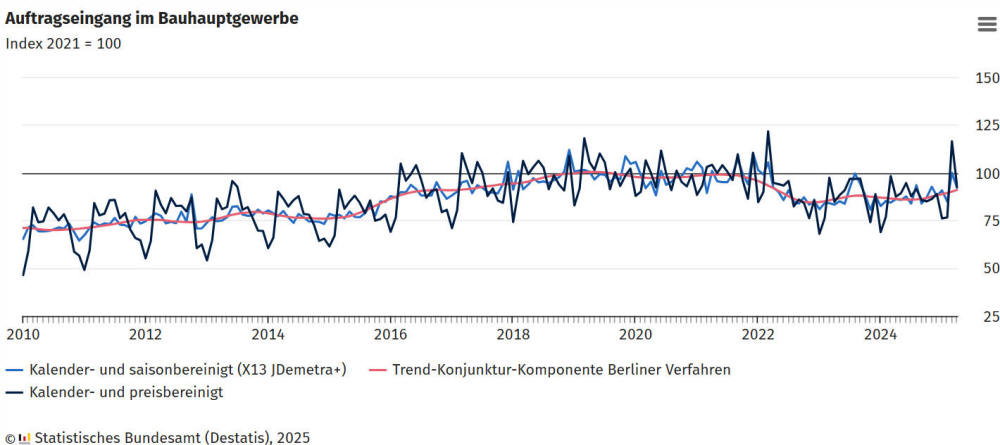
Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2024
stieg der reale, kalenderbereinigte
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im April 2025
um 5,7 %. Dabei nahm der Auftragseingang im
Hochbau um 16,2 % zu und im Tiefbau um 2,4 % ab.
Der nominale (nicht preisbereinigte)
Auftragseingang lag 6,1 % über dem
Vorjahresniveau.
Umsatz real 1,4 %
niedriger als im Vorjahresmonat
Der reale
Umsatz im Bauhauptgewerbe war im April 2025 um
1,4 % niedriger als im Vorjahresmonat. Der
nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um
0,9 % auf 9,4 Milliarden Euro. In den ersten
vier Monaten 2025 stiegen die Umsätze im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,4 %,
nominal um 4,7 %. Die Zahl der im
Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im April
2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 % zu.
Straßenverkehrsunfälle im April
2025: 2 % mehr Verletzte als im Vorjahresmonat
- Zahl der Getöteten fast unverändert, Zahl der
Unfälle mit Personenschaden gestiegen
Im April 2025 sind in Deutschland rund 31
300 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen
verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen
mitteilt, waren das 2 % oder rund 800 Verletzte
mehr als im Vorjahresmonat. 231 Menschen
verloren im April 2025 ihr Leben bei
Verkehrsunfällen, das war 1 Person mehr als im
April 2024.
Die Zahl der Unfälle mit
Personenschaden stieg um rund 800 auf 25 000 (+3
%). Insgesamt registrierte die Polizei im April
2025 rund 213 400 Straßenverkehrsunfälle und
damit etwa 3 900 weniger als im Vorjahresmonat
(-2 %).
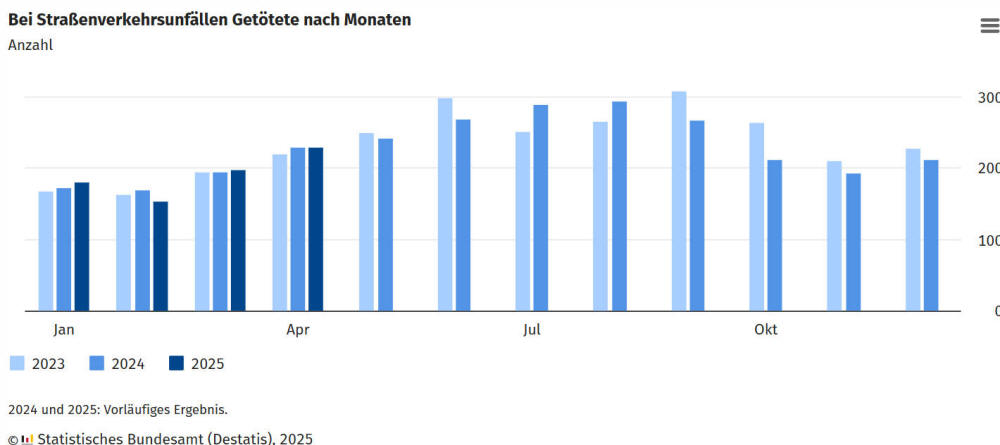
In den ersten vier Monaten des Jahres 2025
erfasste die Polizei insgesamt rund 788 000
Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder
10 700 weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei
rund 80 300 Unfällen wurden Menschen verletzt
oder getötet. Gegenüber dem gleichen Zeitraum
des Jahres 2024 entspricht dies einer Zunahme um
1 % oder 600.
766 Menschen wurden von
Januar bis April 2025 im Straßenverkehr getötet
und 101 300 verletzt. Das waren 5 Getötete
weniger und in etwa so viele Verletzte wie im
Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Unfälle, bei
denen es bei Sachschaden blieb, sank um 2 % oder
11 300 auf rund 707 700.
Freitag, 27. Juni 2025
Trinkwasser kostenlos zapfen – Dinslaken
verweist auf öffentliche Zapfstationen
Die Temperaturen steigen und die Anzahl an
Tipps, wie wir gut durch die heißen Tage kommen
ebenfalls. Immer wieder wird darauf verwiesen,
ausreichend zu trinken. Flüssigkeiten – so wird
empfohlen - sollten dabei wenig Zucker enthalten
und nicht zu kalt sein. Leitungswasser bietet
sich dafür geradezu an.
Die Stadt
Dinslaken verweist daher auf öffentliche
Zapfstationen, auch Refill- oder
Trinkwasser-Stationen genannt. Wer in Dinslaken
unterwegs ist und eine Wasserflasche kostenfrei
auffüllen möchte, kann das zu den allgemeinen
Öffnungszeiten in der Stadtinformation am
Rittertor und im Museum Voswinckelshof erfragen.
Aufgefüllt werden die Flaschen in den
Küchenzeilen, die öffentlich zugänglich sind. In
anderen städtischen Gebäuden sind keine
offiziellen Zapfstationen eingerichtet. Dort
sind nur die WC-Einrichtungen öffentlich
zugänglich.
„Die Qualität unseres
Trinkwassers ist sehr gut und eignet sich
bestens als Durstlöscher. Ich lade alle
Dinslakener*innen ein, an diesen heißen Tagen
von meiner Einladung Gebrauch zu machen“, so
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. Unternehmen,
Verbände und Behörden ruft die Stadt Dinslaken
auf, sich an dieser Gesundheitsvorsorge zu
beteiligen.
Im Netz gibt es unter den
Stichworten „Refill Station“ und „Wasserinseln
im Kreis Wesel“ digitale Karten, in die man sich
eintragen kann, um die eigene Bereitschaft zum
kostenlosen Wasserspenden sichtbar zu machen. In
Ergänzung dazu gibt es Kampagnenmaterial in Form
von Aufklebern, die gut sichtbar am Eingang
angebracht, Durstige einladen, ihren
Trinkwasservorrat aufzufüllen.
In
Dinslaken haben auch die Stadtwerke im Rahmen
der Kampagne „Wasserinseln“ des Fachdienstes
Gesundheitswesen im Kreis Wesel an den zwei
öffentlich zugänglichen Trinkwasserbrunnen an
der Wassermühle Hiesfeld und an der
Stadtwerke-Verwaltung (Gerhard-Malina-Straße 1)
kostenlose Auffüllstationen.
Hier gibt
es eine Übersicht der Trinkwasser-Stationen: https://www.kreis-wesel.de/trinkwasser-stationen-im-kreis-wesel
Trinkwasser-Stationen in Dinslaken:
-
Apotheke Dinslaken Glückauf-Apotheke- Hiesfeld
Sterkraderstr. 262 "Dein
Treff" Friedrich-Ebert-Str. 67 Wasserversorger
Dinslaken Stadtwerke Dinslaken GmbH
Gerhard-Malina-Str. 1 Herz Café/ Diakonie
Pflegezentrum Dinslaken Kirchstraße 11
Trinkwasserbrunnen neben der Wassermühle
Hiesfeld, Am Freibad 5
50 Jahre Kreis Wesel: Landrat Brohl
eröffnet Ausstellung zu 50 Jahren
Kreisverwaltung
Am Dienstag, 24. Juni 2025, eröffnete Landrat
Ingo Brohl vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kreisverwaltung Wesel die Ausstellung „50
Jahre Kreis Wesel“ im Kreishaus. Neben Tafeln
mit Bildern und Informationen aus 50 Jahren
Kreisgeschichte zeigt die Ausstellung auch
Kunstwerke aus den Förderschulen im Kreis Wesel.
Diese wurden von den Schülerinnen und im
Rahmen ihres Unterrichts als
„Geburtstagsgeschenke“ für den Kreis Wesel
erarbeitet und im Mai an Landrat Ingo Brohl
übergeben. Landrat Ingo Brohl: „Neben alten Foto
und allerlei Kuriositäten, die die
Kreisverwaltung bei dieser Ausstellung
präsentiert, freue ich mich besonders über die
wunderschönen Kunstwerke aus den Förderschulen.
Die Kinder haben mit viel Kreativität, Herzblut
und Mühe ganz besondere Geschenke zum 50.
Geburtstag unseres Niederrhein Kreises
geschaffen.“
Der Kreis Wesel ist
Schulträger von insgesamt sieben Förderschulen,
der Bönninghardt-Schule (Alpen), der Waldschule
(Hünxe), der Schule am Niederrhein
(Kamp-Lintfort), der Hilda-Heinemann-Schule
(Moers), der Janusz-Korczak-Schule (Voerde), der
Erich-Kästner-Schule (Wesel und Moers) und der
Schule am Ring (Wesel).
Neben den
kreiseigenen Schulen hatten sich außerdem noch
die Sonneck Schule (Neukirchen-Vluyn), die
Hans-Lenhard-Schule (Neukirchen-Vluyn und Moers)
und die Wilhelmine-Bräm-Schule (Hamminkeln) an
der Aktion beteiligt. Die Ausstellung zu “50
Jahre Kreis Wesel” kann in der Zeit vom
24.06.2025 bis 26.07.2025 zu den üblichen
Öffnungszeiten der Kreisverwaltung im Atrium des
Kreishauses besichtigt werden.
Wegfall der Parkmöglichkeiten am Kreishaus, der
Kreisleitstelle und der Kreispolizeibehörde bis
28.06.2025, 18 Uhr
Ab Donnerstag, 26. Juni 2025, 18 Uhr, wurden
sämtliche Parkplätze auf dem Gelände des
Kreishauses (Reeser Landstraße 31, Wesel), der
Kreisleitstelle (Jülicher Straße 8, Wesel) und
der Kreispolizeibehörde (Reeser Landstraße 21,
Wesel) gesperrt.
Hintergrund ist die
Blaulichtmeile anlässlich des 50. Geburtstags
des Kreises Wesel und der Kreispolizeibehörde am
Samstag, 28. Juni 2025. Als Ausweichmöglichkeit
stehen für die Kundinnen und Kunden die
Parkplätze im Parkdeck an der Karl-Jatho-Straße
zur Verfügung. Die Parkplätze sind ab Montag,
30. Juni 2025, wieder vollständig nutzbar.
25 Jahre Kita Kleeblatt in
Kleve: „Wo kleine Piraten die Welt entdecken und
die Bühne erobern“
Am Samstag, 28. Juni 2025, feiert die Kita
Kleeblatt ihr 25-jähriges Bestehen mit einem
bunten Programm. Die städtische
Kindertagesstätte Kleeblatt in Buchholz 14,
47533 Kleve, lädt herzlich ein, am Samstag, den
28. Juni 2025, gemeinsam das 25-jährige Bestehen
der Einrichtung zu feiern. Von 11:00 bis 17:00
Uhr erwartet die Gäste ein buntes Programm für
die ganze Familie.

Kita Kleeblatt Reichswalde. Bild Förderverein.
Eröffnet wird der Festtag um 11:00 Uhr mit
einer spannenden Showeinlage. Anschließend
können sich kleine und große Besucher auf eine
abenteuerliche Reise begeben – ganz im Zeichen
der Piraten! Zahlreiche Mitmachaktionen bieten
Gelegenheit, sich spielerisch und kreativ
auszuprobieren. Ob lustig, spannend oder
herausfordernd, ist für jede und jeden etwas
dabei.
Für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt. Ein vielfältiges Kuchenbuffet und
herzhafte Leckereien vom Grill laden zum
Genießen und Verweilen ein.
Ein besonderes
Highlight: „Honk und Hanna“ sorgen mit zwei
unterhaltsamen Theaterstücken für kleine
Auszeiten und viel Spaß bei Groß und Klein.
Die kleinen und großen „Kleeblätter“ freuen sich
auf zahlreiche Gäste und einen unvergesslichen
Tag!
Bilder der Klever Köpfe bei
WTM erhältlich
Kereits im
vergangenen Jahr hat die Wirtschaft, Tourismus &
Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) in
Zusammenarbeit mit Restaurator Clemens Giesen
den Kleverinnen und Klevern ein besonderes
Weihnachtsgeschenk gemacht und die Poster der
„Klever Köpfe“ kostenlos zur Abholung in der
Tourist Information angeboten.
Das
Interesse war groß und binnen weniger Tage waren
die Plakate mit Köpfen, die an verschiedenen
Gebäuden im Klever Stadtgebiet zu finden sind,
bereits vergriffen. Nun sind die gerahmten
Einzelportraits bei der Tourist Informationen
erhältlich. „Wir freuen uns, den Eigentümerinnen
und Eigentümer der Gebäude, an denen einer der
Klever Köpfe hängt, eine Freude zu machen und
bieten die gerahmten Fotos kostenlos an“, so
Verena Rohde, Geschäftsführerin der WTM.
Fotograf Bruno Meesters und Restaurator Clemens
Giesen fotografierten 2017 rund 100 Klever Köpfe
an Gebäuden, wie z.B. an der Tiergartenstraße,
Römerstraße oder im Garten des Museums B.C.
Koekkoek Haus. Davon wählten sie 80 Köpfe aus
und zeigten deren Fotos im Rahmen einer
Ausstellung in den Räumlichkeiten des
Antiquitätengeschäfts von Clemens Giesen und im
Klever Rathaus.
„Es ist mir ein
Anliegen, dass die Exponate an die
Eigentümerinnen und Eigentümer übergehen,
deshalb habe ich sie gerne eingerahmt der WTM
zur Verfügung gestellt“, sagt Giesen.
Interessierte Eigentümer der Gebäude, an denen
einer der Klever Köpfe hängt, dürfen sich „ihr
Exponat“ nun kostenlos bei der Tourist
Information am Minoritenplatz 2 zu den
Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 10 bis
16 Uhr sowie Freitag und Samstag von 10 Uhr bis
14 Uhr) abholen.
Besonderes Angebot bei der
WTM - Bilder von Klever Köpfen in der Tourist
Information erhältlich

Restaurator Clemens Giesen und
WTM-Geschäftsführerin Verena Rohde mit den
Exponaten © Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH
Kleve: Theater im Fluss lädt ein zur
Weltreise – Afrikanische Perspektiven erleben
Die Gäste tauchen ein in die Vielfalt
afrikanischer Kulturen, lauschen bewegenden
Geschichten und mitreißenden Rhythmen und
genießen kulinarische Spezialitäten aus dem
Sudan, Äthiopien und Westafrika. Das Format
„Weltreise – Kreative Begegnungen für junge
Geflüchtete und Familien“ bringt regelmäßig
Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte
zusammen.
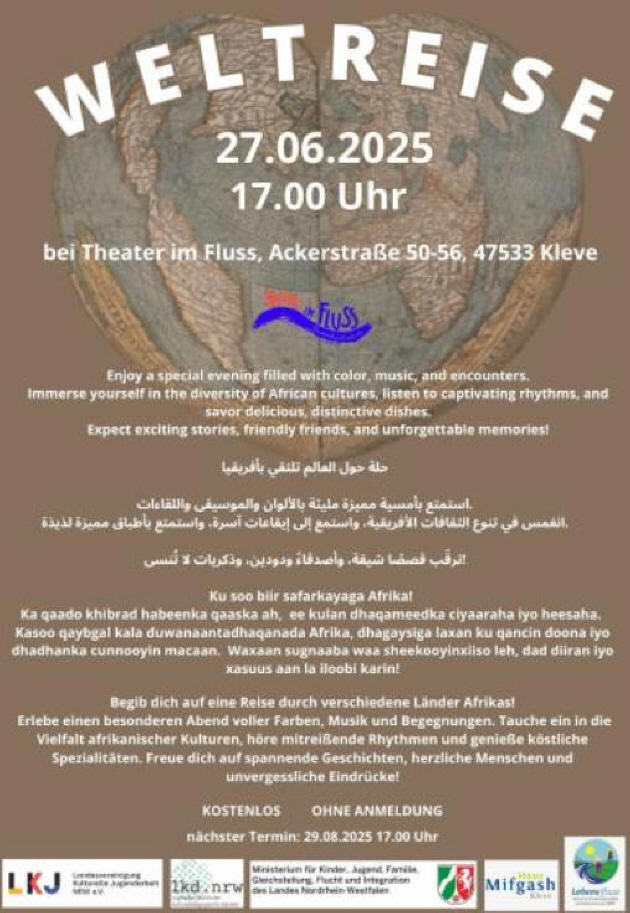
Mit Musik, Erzählkunst, künstlerischen
Gestaltungstechniken und gemeinsamen
kulinarischen Momenten schafft das Projekt Raum
für Begegnung, Austausch und kreatives
Miteinander. Einmal im Monat steht eine andere
Kultur oder Tradition im Mittelpunkt: Ramadan in
Syrien mit Geschichten und Malerei im Stil Abu
Subhi Al-Tinawis, östliche Osterbräuche,
persische Fabeln aus „Kalila und Dimna“,
türkisches Schattentheater, Sufi-Kultur rund um
Mawlawiyya und Rumi oder afrikanische
Erzähltraditionen.
Für das gemeinsame
Buffet sind mitgebrachte Speisen oder
freiwillige Spenden willkommen, ganz nach den
eigenen Möglichkeiten und Ideen. Das Projekt ist
eine Kooperation von Mifgash e.V., dem
Familienzentrum „Lebensfluss“, der
Weltmusikschule und weiteren Partnern des
Quartiersnetzwerks.
Gefördert wird es
vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration des
Landes NRW, der LKJ NRW und der LKD. Weitere
Informationen gibt es unter
thea.fluss@t-online.de oder telefonisch unter
02821 979 379.
IHK-Außenwirtschaftstag: NRW Unternehmen
erhielten Impulse für neue Märkte
Die Niederrheinische IHK konzentrierte sich beim
Außenwirtschaftstag NRW auf die
deutsch-niederländischen
Wirtschaftsbeziehungen. Am 25. Juni fand er in
Mönchengladbach statt. Dort konnten sich
Unternehmer rund um das Auslandsgeschäft
informieren und beraten lassen. Alle zwei Jahre
wird er von der IHK NRW veranstaltet,
Gastgeber war dieses Mal die IHK Mittlerer
Niederrhein. Daria Kreutzer, Teamleiterin im
Bereich Außenhandel bei der Niederrheinischen
IHK, betonte: „Der Niederrhein ist international
eng vernetzt. Umso wichtiger ist es für unsere
Betriebe, sich über Chancen und Risiken der
verschiedenen Märkte ausreichend informieren zu
können. Die Veranstaltung bietet dafür tolle
Optionen. Es gibt praxisnahe Themen-Panels,
Fachausstellungen und die IHKs sowie AHKs
beraten vor Ort.
Die Unternehmen können
sich vernetzen und ihre Erfahrungen austauschen.
Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen
geopolitischen Spannungen wollen sie sich
bestmöglich vorbereiten. Wir unterstützen dabei.
Unsere niederländischen Nachbarn beispielsweise
bieten viele spannende Perspektiven für
Kooperationen.“
Moers:
Bürgermeister würdigt ehrenamtliches Engagement
junger Verkehrslotsen
Mit einer Dankesveranstaltung im Ratssaal des
Rathauses hat Bürgermeister Christoph
Fleischhauer am Montag, 23. Juni, die wertvolle
Arbeit der Schülerlotsinnen und Schülerlotsen
des Gymnasiums in den Filder Benden gewürdigt.
Die jungen Ehrenamtlichen haben seit fast zwei
Jahren dafür gesorgt, dass ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler sicher zur Schule kommen.

Wegen der Großbaustelle in der Filder Straße,
gab es in den letzten Monaten etwas geringere
Einsatzmöglichkeiten. „Ihr habt euch auf den Weg
gemacht, etwas zu tun, was man hoch anrechnen
muss. Ihr habt Schulwegsicherung im wahrsten
Sinne betrieben“, betonte Bürgermeister
Fleischhauer.
„Dieses Engagement ist
aller Ehren wert!“ Er schätze, dass das Ehrenamt
nicht nur den Schülerinnen und Schülern auf dem
Weg hilft, sondern auch zur
Persönlichkeitsbildung der jungen Leute
beiträgt. Betreut werden die jeweiligen
Jahrgänge der Lotsinnen und Lotsen seit rund
sechs Jahren von der engagierten Lehrerin Sevgi
Gündes.
Erfolg auch auf Landesebene
Die Schülerlotsinnen und –lotsen haben für ihre
verantwortungsvolle Tätigkeit eine spezielle
Ausbildung durch die Kreispolizeibehörde Wesel
und die Kreis-Verkehrswacht Wesel erhalten. Auch
Anja Lührig von der Dienststelle für
Verkehrsunfallprävention der Polizei Wesel, die
die Ausbildung der Lotsen mitbegleitet hat,
lobte das Engagement der jungen Menschen:
„Schön, dass sich so viele von euch immer wieder
bereit erklären, mitzumachen!“
Einige
der Lotsen haben in diesem Jahr am
Kreiswettbewerb teilgenommen. Felina Held hat
sogar den Schülerlotsenwettbewerb 2024 auf
Landesebene gewonnen. Zweitplatzierte war
Friederike Oppenberg. Auch in diesem Jahr nehmen
die Schülerinnen und Schüler Gymnasiums in den
Filder Benden am Landeswettbewerb teil.
Zum Abschluss des Vormittags überreichten der
Bürgermeister, Anja Lührig und Olaf Finke
(Leiter des Fachbereichs Schule und Sport) allen
Beteiligten eine persönliche Urkunde sowie ein
kleines Präsent der Kreis-Verkehrswacht als
Zeichen der Wertschätzung der Arbeit.
Städtische Konzertreihe Moers mit
Künstlerinnen und Künstlern von Weltruf
Georg Kresimon, Diana Finkele, Tobias Krampen
und Birgit Grupp (v.l.) freuen sich auf den
Start der neuen Konzertreihe. Abos sind ab
sofort erhältlich.

Foto: Pressestelle
Zur Konzertsaison
2025/2026 laden die Moerser Musikschule und
Musikreferent Tobias Krampen herzlich ein. „Ich
freue mich, dass wir ein abwechslungsreiches
Programm mit einer spannenden Mischung von
etablierten, aber auch jungen Künstlerinnen und
Künstlern vorstellen können“, erklärte Diana
Finkele (Leiterin Eigenbetrieb Bildung) bei der
Vorstellung der neuen Ausgabe.
Mit
Blick auf die Künstlerinnen und Künstler der
vergangenen Saison erläuterte Musikschulleiter
Georg Kresimon: „Das sind Leute, die weltweit
unterwegs sind.“ Damit könne Moers mit dem
kulturellen Angebot der umliegenden Großstädte
konkurrieren. „Das macht die Stadt attraktiv“,
wie Kresimon feststellte.
Musik stärkt
Resilienz
Möglich wird das
abwechslungsreiche Programm unter anderem durch
die guten Verbindungen von Tobias Krampen zu
Musikhochschulen und zum Deutschen Musikrat. Für
ihn ist die Musik auch ein Mittel zur Stärkung
der Menschen: „Wenn man die ganzen Krisen in der
Welt sieht, bin ich froh, dass die Stadt Moers
die Reihe ungebrochen unterstützt und damit ein
Raum geschaffen wird, Resilienz und geistige
Gesundheit durch Konzerte zu stärken.“
Besonders freut sich der Musikreferent auf die
jungen Künstlerinnen und Künstler, wie zum
Beispiel das Ensemble ‚timeless traces‘. Es
präsentiert am 12. Oktober unter dem Titel ‚La
Suave Melodia‘ barocke Klänge. Immer schnell
ausverkauft ist das heitere Neujahrskonzert mit
Meisterschülerinnen und –schülern der Hochschule
für Musik und Tanz Köln. Es findet dieses Mal am
11. Januar 2026 statt.
Ein ebenfalls
junges Ensemble ist das TonKunstAtelier Köln,
das am 17. Mai 2026 Chormusik auf höchstem
Niveau bietet. „Gerade die jungen Menschen
bringen ein anderes Klima in die Musikszene“,
ist sich Krampen sicher.
Niederrheinisches Kammerorchester ist fester
Teil der Reihe
Die neue Konzertsaison
beginnt am 21. September wie immer mit dem
Herbstkonzert des Niederrheinischen
Kammerorchesters Moers (NKM). „Wir freuen uns
sehr, wieder Teil der Reihe sein zu dürfen – das
ist für uns ein Privileg“, erläutert die
Vorsitzende Birgit Grupp. Fester Teil des
Programms sind auch das Weihnachtskonzert (13.
und 14. Dezember) und das Frühjahrskonzert am
21. März.
Dieses Mal steht es unter dem
Motto ‚Klassik pur!‘. Zu hören ist unter anderem
das Violinkonzert von Joseph Bologne, das
höchste Ansprüche an die Solistinnen und
Solisten stellt. Im weiteren Verlauf der Saison
dürfen sich Konzertbesucherinnen und -besucher
auf weitere Solistenabende, Kammermusikensembles
und besondere Themenkonzerten freuen.
Ein Highlight ist dann sicher der Auftritt der
bekannten amerikanischen Pianistin Katie Mahan.
Sie spielt Werke von Mozart, Beethoven und
Gershwin. Beim letzten Konzert in Moers im Jahr
2018 durfte sie erst nach sieben Zugaben die
Bühne verlassen. Bis 18 Jahre ist der Eintritt
zu den Konzerten frei.
Die Musikschule
bittet hierzu aber um Reservierung. Erwachsene
zahlen im Vorverkauf je Veranstaltung 17 Euro:
Moerser Musikschule, Filder Straße 126, Telefon:
0 28 41 / 13 33 und Stadt- und
Touristinformation von Moers Marketing,
Kirchstraße 27 a/b, Telefon: 0 28 41 / 88 22 60
(zuzüglich 8 Prozent Vorverkaufsgebühren). Das
Abonnement für alle zehn Konzerte kostet 127,50
Euro. Es ist ab sofort erhältlich.
Weitere Infos zu den Städtischen Konzerten
Moers: ‚Hochamt‘ erinnerte in
persönlicher Weise an Hanns Dieter Hüsch
Zum 100. Geburtstag von Hanns Dieter Hüsch hatte
Bürgermeister Christoph Fleischhauer
Kabarettisten Wendelin Haverkamp und den Musiker
Franz Brandt zu einer Veranstaltung ins Rathaus
eingeladen.

Foto pst
Zu einem Mittag voller
Erinnerung über den Niederrheinpoeten und
Moerser Ehrenbürger Hanns Dieter Hüsch hatte
Bürgermeister Christoph Fleischhauer am Sonntag,
15. Juni, eingeladen. Unter dem Titel ‚Hochamt
ohne Weihrauch‘ erinnerte der Kabarettist und
langjährige Hüsch-Freund Wendelin Haverkamp mit
musikalischer Unterstützung von Franz Brandt an
der Orgel an den Künstler.
Hüsch wäre in
diesem Jahr 100 geworden. Ursprünglich sollte
die persönliche Veranstaltung des
Stadtoberhaupts im Büro des Bürgermeisters
stattfinden. Aber es hatten sich so viele
Personen angemeldet, dass die Gäste in den
Sitzungssaal des alten Rathausteils umziehen
mussten.
„Meine Erwartungen sind
absolut übertroffen worden. Wendelin Haverkamp
hat ein Programm zusammengestellt, was
retrospektiv, aber auch sehr persönlich war“,
freute sich Fleischhauer.
Haverkamp
präsentierte eigene Texte und natürlich welche
von Hüsch, garniert mit Schilderungen
gemeinsamer persönlicher Erlebnisse der beiden
Kabarettisten. Das Programm trug dazu bei, den
Facettenreichtum des Künstlers zu erleben. Die
Gäste waren sich einig: „Hanns Dieter Hüsch
lebt!“
Schraube sorgte für
kurzfristige Sperrung von Bahnlinie
Bei Gleisarbeiten im Bereich Vierbaumer Weg
wurde am Dienstagmittag ein Metallobjekt
gefunden. Da der Gegenstand nicht einwandfrei
identifiziert werden konnte, hatte der
Fachdienst Ordnung der Stadt Moers den
Kampfmittelräumdienst informiert. Zur Sicherheit
wurde bis zum Eintreffen der Experten der
Bahnverkehr zwischen Moers und Rheinberg
gestoppt.
Der Kampfmittelräumdienst
konnte jedoch schnell Entwarnung geben: Bei dem
Objekt handelte es sich nicht um eine
Handgranate oder Munition aus dem Zweiten
Weltkrieg, sondern um eine große
Gleisbauschraube, die sehr stark verrostet war.
Moers: Geschmack und Heilkraft
von Wildkräutern bei Führung entdecken
Sie sind lecker und gesund: Rund um Wildkräuter
dreht sich eine Stadtführung am Donnerstag, 3.
Juli, um 18 Uhr. Treffpunkt ist vor dem
Sportplatz GSV/MTV am Solimare, Filder Straße
148. Anne-Rose Fusenig entdeckt mit den
Teilnehmenden am Moersbach essbare Wildkräuter.
Die Gruppe verkostet die heilsamen und
leckeren Pflanzen bei einer späteren Einkehr.
Auch ein ‚Gesundheitsbad‘ am fließenden Gewässer
unter besonderen Bäumen gibt es bei dem
Rundgang. Verbindliche Anmeldungen zu der
Führung sind in der Stadt- und
Touristinformation von Moers Marketing möglich:
Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 60.
Die Teilnahme kostet pro Person 12 Euro
(inklusive Einkehr).

Rund 129 300 Ehescheidungen im Jahr
2024
• Deutlicher Rückgang der
Scheidungen seit 2003
• Bei mehr als der
Hälfte der Scheidungen im Jahr 2024 waren
minderjährige Kinder betroffen
• Im
Durchschnitt erfolgte die Scheidung nach knapp
15 Ehejahren
Im Jahr 2024 wurden in
Deutschland rund 129 300 Ehen geschieden. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, lag die Zahl damit ungefähr auf dem
Niveau des Vorjahres (+0,3 % oder 329
Scheidungen), als der niedrigste Stand seit der
deutschen Vereinigung erreicht wurde.
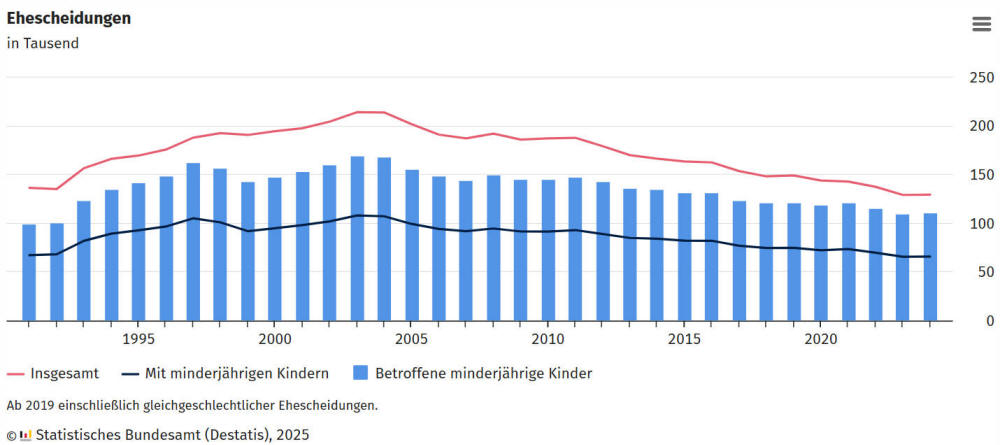
Im langjährigen Trend ging die Zahl der
Scheidungen mit Ausnahme weniger Jahre seit dem
Jahr 2003 zurück (2024: -39,6 %). Die Zahl der
Eheschließungen ist langfristig ebenfalls
rückläufig. 2024 wurden 349 200 Ehen
geschlossen, das waren 3,3 % oder 11 800 weniger
als 2023. Zwischen Mann und Frau wurden 2024 in
Deutschland 340 400 Ehen geschlossen (2023: 351
800) und 8 800 Ehen (2023: 9 200) zwischen
Personen gleichen Geschlechts.
111 000
minderjährige Scheidungskinder im Jahr 2024
Etwas mehr als die Hälfte (50,8 %
beziehungsweise rund 65 700) der im Jahr 2024
geschiedenen Ehepaare hatte minderjährige
Kinder. Von diesen hatten 48,0 % ein Kind,
40,0 % zwei und 12,0 % drei und mehr Kinder.
Damit setzt sich der langjährige Trend eines
Rückgangs des Anteils der Ehescheidungen mit
einem Kind und der Zunahme des Anteils mit zwei
oder mehr Kindern fort.
Insgesamt waren
im Jahr 2024 etwa 111 000 Minderjährige von der
Scheidung ihrer Eltern betroffen. Scheidung
meist nach einjährigen Trennungszeit und mit
Zustimmung beider Partner Die meisten der
geschiedenen Ehen (80,5 %) wurden nach einer
vorherigen Trennungszeit von einem Jahr
geschieden.
Scheidungen nach
dreijähriger Trennung machten einen Anteil von
18,5 % aus. In diesen Fällen wird unwiderlegbar
vermutet, dass die Ehe gescheitert ist. In 1,0 %
der Fälle waren die Regelungen zur Scheidung vor
einjähriger Trennung oder Scheidungen nach
ausländischem Recht maßgebend.
Im
Durchschnitt waren die im Jahr 2024 geschiedenen
Ehepaare 14 Jahre und 8 Monate verheiratet. Bei
etwa 21 200 oder 16,4 % der Paare erfolge die
Scheidung im Jahr der Silberhochzeit oder
später. In den 1990er Jahren lag dieser Anteil
noch zwischen 10 und 11 %. Danach ist er bis
Mitte der 2010er Jahre gestiegen und liegt
seitdem in etwa auf dem heutigen Niveau.
Bei 90,0 % der Ehescheidungen wurde 2024 der
Scheidungsantrag mit Zustimmung des Ehegatten
oder der Ehegattin gestellt. Bei 6,0 % wurde der
Antrag von beiden zusammen eingereicht. Bei den
anderen 4,0 % stimmte der Ehegatte oder die
Ehegattin dem gestellten Antrag nicht zu.
Weniger Aufhebungen von eingetragenen
Lebenspartnerschaften, aber mehr Scheidungen
Im Jahr 2024 ließen sich rund 1 500
gleichgeschlechtliche Paare scheiden. Dies waren
etwa 200 oder 18,1 % gleichgeschlechtliche Paare
mehr als im Jahr 2023. Ehescheidungen
gleichgeschlechtlicher Paare umfassten 1,2 %
aller Ehescheidungen des Jahres 2024.
Gleichgeschlechtliche Paare, die in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können
diese nicht durch Scheidung, sondern durch
Aufhebung beenden.
2024 wurden mit rund
500 Aufhebungen von Lebenspartnerschaften etwa
100 oder 19,6 % weniger erfasst als im Vorjahr.
Damit ist die Zahl das fünfte Jahr in Folge
gesunken. Seit der Einführung der "Ehe für alle"
im Oktober 2017 können in Deutschland keine
Lebenspartnerschaften mehr begründet werden und
es findet zunehmend eine Verschiebung von den
Aufhebungen zu den Scheidungen statt.
NRW: 3,2 Millionen Menschen waren 2024
armutsgefährdet
*
17,8 % der Menschen in NRW waren 2024 von Armut
bedroht
* Fast die Hälfte der Erwerbslosen
ist betroffen
* Junge Menschen sind
überdurchschnittlich oft betroffen
Rund
3,2 Millionen Personen in Nordrhein-Westfalen
sind im Jahr 2024 von relativer Einkommensarmut
betroffen gewesen. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, entspricht das einer
Armutsgefährdungsquote von 17,8 %. Im Jahr 2023
lag dieser Wert bei 18,2 %.
Als
armutsgefährdet gelten Menschen, die weniger als
60 % des mittleren bedarfsgewichteten
Haushaltseinkommens (sogenanntes
Nettoäquivalenzeinkommen) zur Verfügung haben.
Im Jahr 2024 galt somit ein Einpersonenhaushalt
in Nordrhein-Westfalen mit weniger als
1.290 Euro netto pro Monat als von Armut
bedroht.
Armutsrisiko in NRW war regional
unterschiedlich verteilt Die höchste
Armutsgefährdungsquote in Nordrhein-Westfalen
wurde mit 22,1 % für die Raumordnungsregion
Emscher-Lippe berechnet. Die niedrigste
Armutsgefährdungsquote gab es mit 12,9 % in der
Raumordnungsregion Siegen.
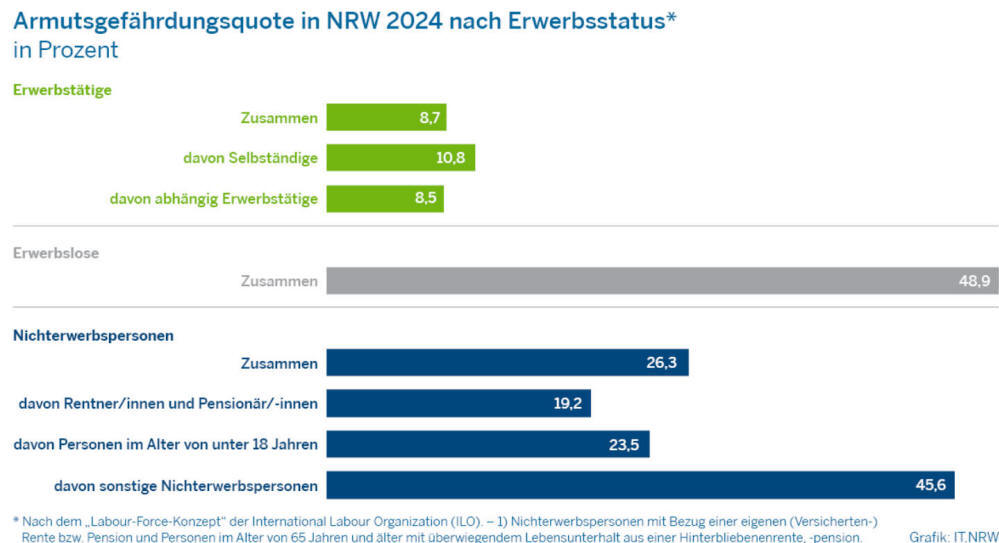
Knapp die Hälfte der Erwerbslosen von Armut
bedroht
Fast die Hälfte der Erwerbslosen
(48,9 %) war 2024 von relativer Einkommensarmut
betroffen. Das betraf rund 170.000 Personen. Die
Armutsgefährdungsquote der Erwerbstätigen war
mit 8,7 % demgegenüber deutlich geringer;
absolut betrachtet war die Zahl der
armutsgefährdeten Menschen unter den
Erwerbstätigen mit rund 780.000 Personen jedoch
fast fünfmal so hoch.
Unter den
Nichterwerbspersonen, also Personen, die nicht
für die Aufnahme einer Arbeit zur Verfügung
stehen, wiesen Rentnerinnen und Rentner sowie
Pensionärinnen und Pensionäre mit 19,2 % die
niedrigste Armutsgefährdungsquote auf. Bei
sonstigen Nichterwerbspersonen im Alter von
mindestens 18 Jahren war die
Armutsgefährdungsquote mit 45,6 % mehr als
doppelt so hoch. Zu den sonstigen
Nichterwerbspersonen zählen hier alle Personen
ab 18 Jahren, die ihren überwiegenden
Lebensunterhalt nicht aus einer Rente oder
Pension beziehen.
Das sind
beispielsweise Hausfrauen und Hausmänner, ältere
Menschen ohne Rente bzw. Pension oder
Studierende ohne Nebenjob. Qualifikation
beeinflusste Häufigkeit von Einkommensarmut Ein
weiterer Faktor für die Häufigkeit von relativer
Einkommensarmut ist die Qualifikation: Hat die
Person mit dem höchsten Einkommen im Haushalt
maximal einen Abschluss der Sekundarstufe I
(z. B. Haupt- oder Realschulabschluss), so lag
das Armutsrisiko bei 39,4 %, gegenüber 7,8 % bei
einem hohen Bildungsabschluss (z. B. Studium).
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen
Sowohl Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
als auch junge Erwachsene im Alter von 18 bis
24 Jahren waren 2024 zu einem
überdurchschnittlich hohen Anteil von relativer
Einkommensarmut betroffen. So lebte knapp jede
vierte minderjährige Person in einem
einkommensarmen Haushalt (23,3 %).
Bei
den jungen Erwachsenen traf dies auf 25,1 % zu.
Beide Gruppen zusammen machten mit rund
1,0 Millionen Menschen ein Drittel der
armutsgefährdeten Personen aus. Menschen im
Alter von 50 bis 64 Jahren waren mit 13,3 % am
seltensten von relativer Einkommensarmut
betroffen. Diese und weitere Ergebnisse zum
Thema Armut finden Sie auch im Internet auf
unserer Themenseite Armut unter
https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/themenschwerpunkte/armut
Gut jede fünfte Person kann sich
keine Woche Urlaub leisten
In den
Sommerferien eine Woche verreisen – das ist für
viele Menschen in Deutschland kaum möglich. Im
Jahr 2024 lebte gut jede fünfte Person (21 %) in
einem Haushalt, der sich nach eigenen Angaben
keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnte.
Das waren 17,4 Millionen Menschen. W
Wie das
Statistische Bundesamt anhand der Erhebung zu
Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)
mitteilt, war der Anteil damit geringfügig
niedriger als im Jahr zuvor. Im Jahr 2023 sahen
sich noch 23 % der Bevölkerung finanziell außer
Stande, für eine Woche Urlaub zu verreisen.
Personen in Alleinerziehenden-Haushalten
besonders betroffen Alleinerziehenden fehlt
besonders häufig das Geld für einen Urlaub: 38 %
der Alleinerziehenden und ihrer Kinder konnten
sich im Jahr 2024 nach eigenen Angaben keine
einwöchige Urlaubsreise leisten. Auch unter
Alleinlebenden war der Anteil mit 29 %
überdurchschnittlich hoch. Am seltensten waren
dagegen zwei Erwachsene betroffen, die ohne
Kinder in einem Haushalt lebten (15 %).
Bei zwei Erwachsenen mit einem oder mehreren
Kindern im Haushalt lag der Anteil bei 19 %.
Hier hängt es stark von der Zahl der Kinder ab,
ob man sich eine Urlaubsreise leisten kann oder
nicht. Hatten 16 % der Personen in Haushalten
mit zwei Erwachsenen und einem oder zwei Kindern
kein Geld für eine solche Reise, so traf dies
auf 29 % der Personen in Haushalten mit zwei
Erwachsenen und mindestens drei Kindern zu.
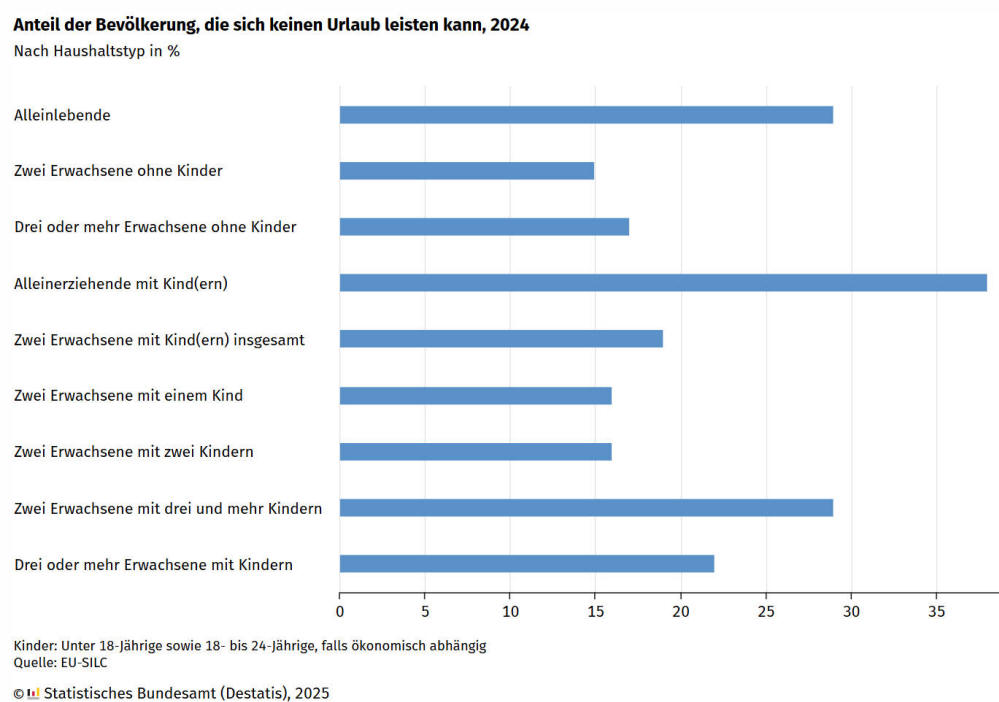
EU-weit große Unterschiede
EU-weit lebte
im Jahr 2024 gut ein Viertel der Bevölkerung in
Haushalten (27 %), die sich keine einwöchige
Urlaubsreise leisten können. Deutschland lag
somit nach Angaben der europäischen
Statistikbehörde Eurostat unter dem Durchschnitt
aller Staaten der Europäischen Union (EU).
Am seltensten war die Bevölkerung in
Luxemburg (9 %), Schweden (12 %) und den
Niederlanden (13 %) betroffen. Vergleichsweise
selten hatten dagegen Menschen in Rumänien genug
Geld für den Urlaub: 59 % konnten sich dort nach
eigenen Angaben keine solche Reise leisten. Hoch
war der Anteil der betroffenen Bevölkerung auch
in Griechenland mit 46 % und in Bulgarien mit
41 %.
Nettozuwanderung 2024 auf
430 000 Personen gesunken
- Weniger Zuwanderung aus den
Haupt-Asylherkunftsländern Konstante -
-
Nettozuwanderung aus der Ukraine: weniger
Zuzüge, aber auch weniger Fortzüge als 2023
- Erstmals seit 2008 negativer Wanderungssaldo
gegenüber der
Im Jahr 2024 sind rund
430 000 Personen mehr nach Deutschland zugezogen
als aus Deutschland fortgezogen (vorläufiges
Ergebnis: 420 000). Im Vorjahr hatte die
Nettozuwanderung noch bei rund 663 000 Personen
gelegen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach endgültigen Ergebnissen der
Wanderungsstatistik mitteilt, waren 2024 rund
1 694 000 Zuzüge und 1 264 000 Fortzüge über die
Grenzen Deutschlands zu verzeichnen.
Im
Vorjahr wurden noch rund 1 933 000 Zuzüge und
1 270 000 Fortzüge registriert. Damit sind im
Jahr 2024 rund 12 % weniger Personen zugezogen
als 2023. Die Zahl der Fortzüge blieb gegenüber
dem Vorjahr nahezu unverändert.
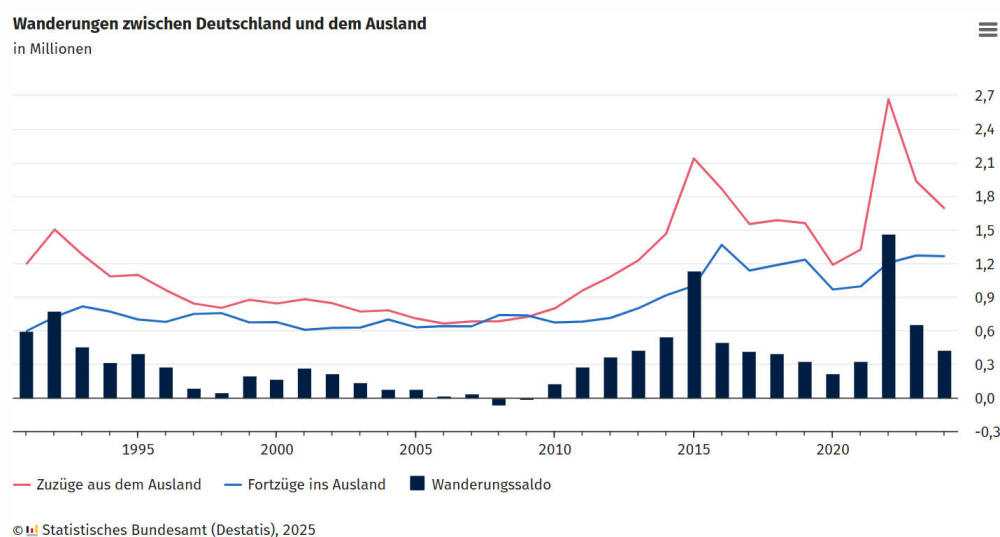
Weniger Zuwanderung aus den
Haupt-Asylherkunftsländern
Eine Ursache für
die im Jahr 2024 gegenüber 2023 geringere
Zuwanderung ist eine geringere Nettozuwanderung
aus den Hauptherkunftsländern von Asylsuchenden.
Im Vergleich zum Vorjahr registrierte die
Wanderungsstatistik deutliche Rückgänge der
Nettozuwanderung aus Syrien (-25 %, von 101 000
auf 75 000), der Türkei (-53 %, von 89 000 auf
41 000), und aus Afghanistan (-32 %, von 48 000
auf 33 000).
Laut der Asylstatistik
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gab
es 2024 erheblich weniger Asylanträge von
Staatsangehörigen dieser Länder. Konstante
Nettozuwanderung aus der Ukraine bei weniger Zu-
und Fortzügen Die Nettozuwanderung aus der
Ukraine lag 2024 wie im Vorjahr unverändert bei
121 000 Personen.
Hinter der konstanten
Nettozuwanderung verbergen sich allerdings
deutliche Rückgänge sowohl bei Zuzügen (2024:
222 000 Zuzüge, 2023: 276 000 Zuzüge) aus der
Ukraine als auch bei Fortzügen (2024: 100 000
Fortzüge, 2023: 155 000 Fortzüge) in die Ukraine
und damit ein generell geringeres
Migrationsgeschehen.
Der Rückgang
scheint auch 2025 weiter anzuhalten: In den
ersten vier Monaten 2025 lag die
Nettozuwanderung aus der Ukraine insgesamt bei
knapp 20 000 Personen, zuletzt im April 2025 bei
rund 3 000 Personen. In den ersten vier Monaten
2024 war die Nettozuwanderung aus der Ukraine
mit 38 000 Personen noch fast doppelt so hoch.
Negativer Wanderungssaldo gegenüber der
EU
Eine weitere Ursache für die sinkende
Nettozuwanderung ist eine weiter rückläufige
Zuwanderung aus den Staaten der Europäischen
Union (EU). Im Jahr 2024 betrug der
Wanderungssaldo Deutschlands mit der EU -34 000
Personen. Damit verzeichnet die
Wanderungsstatistik nach hohen
Wanderungsüberschüssen vor allem in den 2010er
Jahren erstmals seit dem Jahr 2008 wieder
weniger Zuzüge aus der EU als Fortzüge in andere
EU-Staaten.
Die größten Rückgänge des
Wanderungssaldos im Vergleich zum Vorjahr waren
mit Polen (von +15 000 auf -11 000 Personen),
Rumänien (von +16 000 auf -5 000 Personen) und
Bulgarien (von +1 000 auf -11 000 Personen) zu
beobachten. Dabei waren die Verluste vor allem
auf weniger Zuzüge als im Vorjahr
zurückzuführen. Aus Polen wurden 22 000 Zuzüge
weniger erfasst (-21 %), aus Bulgarien 11 000
(-18 %) und aus Rumänien 16 000 (-8 %).
Die Zahl der registrierten Fortzüge nach Polen
und Rumänien stieg in geringem Ausmaß um 4 000
Fortzüge (+4 %) beziehungsweise 5 000 Fortzüge
(+3 %). Die Zahl der Fortzüge nach Bulgarien
blieb weitgehend unverändert. Innerhalb
Deutschlands Brandenburg, Bayern und
Schleswig-Holstein mit den höchsten
Wanderungsüberschüssen.
Innerhalb
Deutschlands wurden 2024 insgesamt
1 004 000 Wanderungen über die Bundeslandgrenzen
registriert. Dies waren 31 000 beziehungsweise
3 % weniger als im Vorjahr. Brandenburg
verzeichnete mit einem positiven Saldo von
12 000 Personen den größten
Wanderungsüberschuss, gefolgt von Bayern
(+10 000 Personen) und Schleswig-Holstein
(+9 000 Personen). Berlin (-15 000 Personen)
sowie Thüringen (-6 000 Personen), Hessen und
Nordrhein-Westfalen (jeweils -5 000 Personen)
hatten die größten Wanderungsverluste.
Donnerstag, 26. Juni 2025
Schützenswert - Weseler Elternlots*innen
erhalten Dankeschön
Tag für Tag, bei Wind und Wetter, stehen
Elternlots*innen in der Nähe von Grundschulen
und sorgen für die Sicherheit der Kinder.
Insgesamt sind in Wesel 21 Elternlotsen
ehrenamtlich im Einsatz; davon zehn an der
Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg sowie elf
an der Gemeinschaftsgrundschule Feldmark.
Für diesen vorbildlichen Einsatz erhalten
die Lots*innen jedes Jahr ein kleines Dankeschön
von Stadtverwaltung, Kreispolizeibehörde und
Kreis-Verkehrswacht, so auch in diesem Jahr. Für
das wertvolle Engagement haben die
Ehrenamtlichen ein Dankesschreiben der
Bürgermeisterin mit einem „Stadtgutschein Wesel“
im Wert von 50 Euro erhalten.
Die
Einkaufsgutscheine können bei verschiedenen
Fachgeschäften und Dienstleistern (mehr
Informationen unter www.stadtgutschein-wesel.de)
eingelöst werden. Bürgermeisterin Westkamp
würdigte den besonderen Einsatz zur Sicherheit
von Kindern, den die Elternlotsen erbringen.
Allen Beteiligten liegt dieses Angebot sehr am
Herzen, damit vor allem jüngere Schulkinder
sicher zur Schule gelangen.
Neben dem
Einsatz der Elternlots*innen werden jährlich
überarbeitete Schulwegsicherungspläne an die
I-Dötzchen verteilt. Darin enthalten ist eine
Informationsschrift, die Eltern Hilfestellung
gibt, wie sie ihr Kind auf dem Schulweg
begleiten können. Ein Kartenausschnitt zeigt,
wie der sicherste Schulweg verläuft.
Eingezeichnet sind Ampelanlagen, Querungshilfen
und Lotsendienste.
Wichtig ist, so die
Fachleute, den Schulweg frühzeitig mit den
Kindern einzuüben. Zunächst sollten Kinder
begleitet werden, zunehmend sollte ihnen
zugetraut werden, ihren Schulweg alleine oder
mit anderen Kindern zu gehen. Das stärkt
Selbständigkeit und Selbstvertrauen. An die
motorisierten Verkehrsteilnehmer*innen ergeht
der Appell, in der Nähe von Grundschulen
besonders umsichtig und langsam zu fahren.
Dinslaken: Jugendzentrum P-Dorf ist
jetzt Faires Jugendhaus
Das
städtische Jugendzentrum Pestalozzidorf, besser
bekannt als P-Dorf, engagiert sich seit vielen
Jahren für das Thema Nachhaltigkeit. Fair
gehandelte Lebensmittel gehören zum Alltag und
Nachhaltigkeitsprojekte sind fester Bestandteil
der pädagogischen Arbeit.

von links nach rechts: Waltraud Barthel, Ben
Brunswick (beide P-Dorf), Dr. Tagrid Yousef,
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, Angelika
Supper, Vera Dwors
Jetzt wurde die
Einrichtung für ihren Einsatz belohnt und hat
durch das Netzwerk Faire Metropole Ruhr die
Auszeichnung „Faires Jugendhaus“ erhalten.
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel
unterstreicht: „Das P-Dorf ist nicht nur ein Ort
der Begegnung und des Austauschs für unsere
Jugendlichen, sondern auch ein leuchtendes
Beispiel dafür, wie wichtig Fairness und
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft sind. Ein
Faires Jugendhaus zeichnet sich dadurch aus,
dass Mitarbeitende und junge Dinslakenerinnen
und Dinslakener selbst aktiv werden und sich für
den Fairen Handel stark machen. Somit übernehmen
sie sichtbare Verantwortung für Gerechtigkeit
und nachhaltige Entwicklung“, so Bürgermeisterin
Eislöffel.
Sozialdezernentin Tagrid
Yousef freute sich über die besondere Ehrung der
Einrichtung, welche am 23.06.2025 durch Vera
Dwors, Sprecherin bei der Fairen Metropole Ruhr,
an das Haus übergeben wurde: „Den jungen
Menschen ist es heute immer wichtiger, sich mit
Themen wie dem Fairem Handel und weltweiter
Gerechtigkeit auseinanderzusetzen, weil es um
ihre Zukunft geht, um eine bessere Welt und der
Übernahme von nachhaltiger Verantwortung“.
Anschließend informierte die P-Dorf
Mitarbeiterin Angelika Supper darüber, wie die
Inhalte des Konzeptes im Einrichtungsalltag
umgesetzt werden. So werden etwa an der
„Fairkostbar“, dem Kiosk des P-Dorfs, immer mehr
fair gehandelte Snacks angeboten. Bei Projekten
und Kursangeboten lernen die Besucher*innen
beispielsweise den Weg von Schokolade kennen
oder setzen sich kritisch mit der Modeproduktion
auseinander.
Inhaltlich arbeitet das
P-Dorf seit Jahren eng mit der Stabsstelle
Nachhaltige Entwicklung zusammen. Deren Team
berät bei allen Fragen rund um Bildung für
Nachhaltige Entwicklung wie zum Beispiel auch
bei der Auszeichnung Fairtrade School oder Faire
Kita. Dabei kann das Team auf die gute
Netzwerkarbeit aus mehr als zwei Jahrzehnten
zurückgreifen und unterstützt im konkreten
Einzelfall.
Die Kampagne „Faires
Jugendhaus“ wurde 2017 durch die Evangelische
Jugend im Rheinland ins Leben gerufen und wird
nun vom Netzwerk Faire Metropole Ruhr
weitergeführt. Ein Faires Jugendhaus zeichnet
sich dadurch aus, dass sich Mitarbeitende,
Kinder und Jugendliche aktiv für den Fairen
Handel einsetzen und Verantwortung für
Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung
übernehmen.
Die Auszeichnung soll das
Engagement nach außen tragen und weitere
Jugendeinrichtungen ermutigen, sich für das
Themenfeld einzusetzen. In Dinslaken ist diese
Auszeichnung auch Teil der seit 2009 dauerhaften
Anerkennung der Stadt als eine der ersten
Fairtrade Towns Deutschlands.
MOVE! X Penguin’s Days: Sommerlicher Familientag
rund ums Schloss
Kreative Kinder bei PopUp-Workshops auf den
Wiesen, tanzende Gruppen auf der Bühne und eine
willkommene Abkühlung am Wasserschlauch der
Jugendfeuerwehr.
 : :
Foto Pressestelle
Der Familientag
‚MOVE! X Penguin’s Days‘ brachte am Sonntag, 22.
Juni, viel Bewegung und Kreativität auf den
Moerser Schlossplatz. Trotz hoher Temperaturen
kamen viele Familien, Kinder und Jugendliche, um
das vielfältige Programm des
Gemeinschaftsprojekts von Kinder- und
Jugendtheaterfestivals Penguin’s Days des Jungen
Schlosstheaters, Kinder- und Jugendbüro und
Kulturbüros der Stadt Moers zu erleben.
Neben Theater, Tanz und Mitmachaktionen
sorgten kühle Getränke, Eis und die Wasseraktion
der Jugendfeuerwehr für sommerliche Erfrischung.
Das Gelände rund ums Schloss wurde so für einen
Tag zur bunten Erlebnisfläche für junge Menschen
und Familien. Erstmals gab es zuvor eine ganze
Workshop-Woche (14. bis 21. Juni) mit rund 120
Teilnehmenden zwischen 6 und 25 Jahren. Sie
fanden in den zahlreichen Offenen Einrichtungen
für Kinder und Jugendliche, in der Bibliothek,
der vhs und im Musenhof statt.
Bürgersolarberatung Moers: Unabhängige Hilfe von
Nachbarn für Nachbarn
Wenn auf dem Dach Sonnenlicht einfällt und
im Keller der Stromzähler rückwärtsläuft oder
Energie gespeichert wird, ist das nicht nur gut
fürs Klima – sondern auch für den Geldbeutel.
Immer mehr Menschen in Moers möchten ihren
eigenen Strom erzeugen. Doch der Weg zur eigenen
Photovoltaikanlage ist oft von Unsicherheit,
technischen Fachbegriffen und unübersichtlichen
Angeboten geprägt.
Genau hier hilft die
neue Bürgersolarberatung in Moers: Ein
ehrenamtliches Angebot, das verständlich und
individuell auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen
und Bürger eingeht. Das Motto lautet:
Ehrenamtlich, nachbarschaftlich, unabhängig,
kostenlos und kompetent.
Möglich gemacht
wurde die Initiative durch eine Kooperation der
Stadt Moers mit dem gemeinnützigen Verein
MetropolSolar e.V. und dem Regionalverband Ruhr
(RVR). Kompetenz aus der Nachbarschaft – ganz
ohne Verkaufsdruck Was bringt mir eine
Photovoltaikanlage auf dem Dach? Diese Frage
stellen sich in Moers Besitzerinnen und Besitzer
von Ein- und Zweifamilienhäusern.
Viele
können mit den technischen Einzelheiten und
kryptischen Abkürzungen nichts anfangen. Manche
fürchten sich auch vor der Abzocke und andere
haben keine Lust, sich mit mehreren Angeboten
auseinanderzusetzen. Die Beraterinnen und
Berater kommen aus der Region, haben selbst
Photovoltaikanlagen installiert und teilen ihre
Erfahrungen und ihr Wissen auf Augenhöhe.
Einige von ihnen sind sogar
Elektrofachkräfte. Sie wurden nach den
Qualitätsstandards von MetropolSolar geschult
und verpflichten sich zur völligen
Unabhängigkeit – weder Installationsfirmen noch
Anbieter haben Einfluss auf ihre Empfehlungen.
Im Gegensatz zur oft gewerblich geprägten
Beratung durch Firmen oder Internetanbieter
nehmen sich die Bürgersolarberater Zeit für
individuelle Gespräche.
Sie besuchen
interessierte Haushalte vor Ort, prüfen
Dachflächen, Energiebedarf und persönliche
Wünsche. Anschließend entwickeln sie ein
konkretes, passendes Konzept für eine mögliche
Anlage – verständlich, realistisch und ohne
Verpflichtungen.
Erfolgreiches Modell im
Kreis Wesel
Die Idee stammt aus dem
Rhein-Neckar-Raum und hat inzwischen auch den
Kreis Wesel erreicht. In den vergangenen drei
Jahren wurden bereits Beraterinnen und Berater
in Rheinberg, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort,
Alpen und Sonsbeck geschult. Seit Kurzem ist
auch Moers mit sechs frisch ausgebildeten
Ehrenamtlichen dabei.
Finanziert wurde
ihre Qualifizierung durch die beteiligten
Kommunen und den RVR. „Wir sind überzeugt:
Sonnenstrom vom eigenen Dach lohnt sich in den
meisten Fällen – auch bei kleinen Anlagen“, sagt
Ulrich Reisner, einer der Moerser
Bürgersolarberater. „Und weil wir unabhängig
beraten, können die Menschen in Ruhe
entscheiden, ob und wie sie ihr Projekt umsetzen
möchten.“
Interessierte Bürgerinnen und
Bürger können sich direkt an das Klimamanagement
der Stadt Moers unter klima@moers.de oder
Telefon 0 28 41 / 201-543 wenden. Das Team der
Bürgersolarberatung ist auch direkt per Mail an bsb-moers@gmx.de erreichbar.
Für die Kontaktaufnahme bitten die Berater um
eine E-Mail-Adresse sowie eine Telefonnummer für
den Rückruf. Da sie ehrenamtlich arbeiten, kann
es in Einzelfällen zu kurzen Wartezeiten kommen.
Moers: vhs-Sommerprogramm -
Italienisch- und Englischkurs vor den Ferien
Wer noch schnell vor seinem
geplanten Italienurlaub die grundlegende
Konversation der Landessprache erlernen möchte,
kann sich für einen Kurs des vhs-Sommerprogramms
anmelden: Am Montag, 7. Juli, startet ‚Ciao
Bella Italia – Crash Kurs vor den Sommerferien‘.
Das Seminar findet insgesamt 15-mal
montags bis freitags von 18.30 bis 20 Uhr in den
Räumen der vhs Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße
10, statt. Auf dem Unterrichtsplan stehen
einfache Ausdrücke und Redewendungen für die
Reise und den Alltag. Außerdem gibt es Einblicke
in die Kultur, Küche und Lebensart Italiens.
Kompakter Intensivkurs Englisch An Teilnehmende
mit geringen Vorkenntnissen richtet sich
‚Englisch für Urlaub und Reise (A1)‘.
Der Kurs vermittelt ab Montag, 28. Juli,
insgesamt fünfmal (Montag bis Freitag, jeweils
von 9.15 bis 15.30 Uhr) einen einfachen
englischen Wortschatz und Hörverständnis für
typische Urlaubssituationen. Grammatik spielt
nur eine untergeordnete Rolle. Veranstaltungsort
ist auch hier die vhs Moers an der
Wilhelm-Schroeder-Straße 10.
Dieses
Seminar entspricht den Richtlinien des
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes (AWbG) und
kann als Bildungsurlaub anerkannt werden.
Weitere Infos dazu gibt es bei Jörg Büschgens
unter 0 28 41/201 – 969. Anmeldungen sind für
beide Kurse erforderlich und telefonisch unter 0
28 41/201 – 565 sowie online unter
www.vhs-moers.de möglich.
Dinslaken, Ehrensache: Jetzt bis zum 14.
September Vorschläge einreichen
Auch 2025 wird wieder der beliebte
Ehrenamts-Preis "Dinslaken, Ehrensache!"
vergeben. Ab sofort nimmt die Dinslakener
Stadtverwaltung Vorschläge zur Benennung von
Preisträger*innen entgegen. „Ehrenamtlich tätige
Menschen sind der Kitt unserer
Stadtgesellschaft.
Deshalb werden wir
dieses gesellschaftlich bedeutsame Engagement
auch in diesem Jahr wieder würdigen. Viele
soziale, sportliche und kulturelle Aktivitäten
und Projekte werden in unserer Stadt von
Menschen getragen, die ihre Freizeit für den
Dienst der Allgemeinheit aufbringen“, so
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.
Der
mit jeweils 500 Euro dotierte
Maria-Euthymia-Preis wird in den Genres Kultur,
Sport, Soziales und Kinder/Jugend verliehen.
Darüber hinaus ist für herausragendes
ehrenamtliches Engagement der mit 750 Euro
dotierte Maria-Euthymia-Sonderpreis ausgelobt.
Die Preise sollen an Dinslakener Einrichtungen,
Selbsthilfegruppen, Initiativen, Vereine und
Gruppierungen sowie in Ausnahmefällen an
Einzelpersonen verliehen werden.
Einzelpersonen müssen ihr Ehrenamt zu Gunsten
der Dinslakener Stadtgesellschaft ausüben.
Vorschläge mit Begründung können bis Sonntag,
den 14. September 2025 per E-Mail an
ehrenamtspreis@dinslaken.de gesendet werden. Dazu
gibt es auf der städtischen Homepage ein
Antragsformular, das unkompliziert ausgefüllt
werden kann.
Auch die Einsendung auf
dem Postweg ist unter folgender Anschrift
möglich: Stadt Dinslaken Ehrensache 2025 Platz
d’Agen 1 46535 Dinslaken Folgende weitere
Kriterien gelten für die Zulassung:
- Die
vorgeschlagene Organisation muss ihren Sitz in
Dinslaken haben.
- Die ehrenamtliche
Tätigkeit muss nachvollziehbar dargestellt sein.
- Für Einzelpersonen gilt, dass ihre
ehrenamtliche Tätigkeit in Dinslaken ausgeübt
werden muss.
- Ein Eigenvorschlag ist
unzulässig.
Eine Jury entscheidet über
die endgültige Vergabe. Die Preise werden auch
in diesem Jahr wieder traditionell im Rahmen
einer feierlichen Veranstaltung an die
ausgezeichneten Personen/Institutionen vergeben.
Das Datum wird noch bekannt gegeben.
Wesel: Neues Porträt der Künstlerin
Ingeborg ten Haeff ergänzt die Ausstellung
„WeibsBilder“
Die aktuelle
Ausstellung „WeibsBilder“ im Rathaus Wesel
fasziniert vielen Menschen. Am Dienstag, 24.
Juni 2025, wurde ein weiteres eindrucksvolles
Porträt offiziell an die Stadt Wesel übergeben.
Das neu geschaffene Bild von Ingeborg ten
Haeff vervollständigt die bedeutende
Ausstellung „WeibsBilder“.

Die Ausstellung fußt auf der gleichnamigen
Publikation des Stadtarchives Wesel, die 2023
erschienen ist. Die „WeibsBilder“ stellen
Frauenbiografien in den Mittelpunkt. Die
Kunstwerke sollen die Lebensgeschichten von
Frauen, die Wesel geprägt haben, sichtbar
machen.
Gemalt wurde das Porträt, wie
alle Werke der Serie, von der Künstlerin Bianka
Bauhaus (selbst auch aus Wesel). Mit ihrer
charakteristischen Handschrift hat sie
eindrucksvolle Bildnisse starker Frauen
geschaffen. Mit dem neuen Werk erfährt die
Ausstellung eine bedeutende Ergänzung.
Das Porträt ist nicht nur innerhalb der
Ausstellung von Bedeutung, es dient zugleich als
Vorlage für eine Kachel, die die „Frauenwege” in
der Sandstraße in Wesel (zusammen mit zwei
weiteren neu gestalteten Kacheln für die
Rennfahrerin Eva Maria Falk sowie die Malerin
Erna Suhrborg) ergänzen wird.
Mit diesen
Kacheln werden die spannenden Lebensgeschichten
von drei bekannten Weseler Persönlichkeiten
nachhaltig im öffentlichen Raum verankert. Es
ist ein weiterer Schritt, um an Frauen, die
Wesel geprägt haben, zu erinnern. Stadtarchiv
Wesel, N83: Sammlung Ekkehart Malz. (lt. Archiv)
Als besondere Wertschätzung hat der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und
Nachhaltigkeit des Rates der Stadt Wesel 2020
beschlossen, einen Weg nach Ingeborg ten Haeff
zu benennen. Wer mehr über das Leben von
Ingeborg ten Haeff sowie anderen interessanten
Frauen aus Wesel wissen möchte, kann sich gerne
die kostenlose Broschüre „Die WEGgefährtinnen“
im Rathaus, vor Zimmer 116, erste Etage,
mitnehmen.
Am 3. Juli 2025 um 15:30 Uhr
eröffnet Bürgermeisterin Ulrike Westkamp die
Erweiterung der Frauenwege feierlich. Alle
Interessierten sind bereits heute herzlich
eingeladen, an diesem besonderen Ereignis
teilzunehmen. Nach dem offiziellen Teil haben
sie die Möglichkeit, die Frauen, die auf der
Sandstraße präsentiert werden, näher
kennenzulernen. Eine geführte Tour lädt dazu
ein, mehr über ihr Leben zu erfahren. Die
Führung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter gleichstellung@wesel.de ist
jedoch erforderlich.
Erste
Stiftungsprofessur am Campus Kamp-Lintfort der
Hochschule Rhein-Waal
Mit einem bedeutenden Beitrag zur Stärkung des
Wissenschafts- und Innovationsstandorts
Niederrhein Kreis Wesel wurde am Montag an der
Hochschule Rhein-Waal die Heinz
Trox-Stiftungsprofessur für Angewandte
Künstliche Intelligenz (KI) offiziell auf den
Weg gebracht. Die Heinz Trox-Stiftung wird in
den nächsten fünf Jahren jeweils 200.000 Euro
für die Stiftungsprofessur zur Verfügung stellen
und diese damit vollständig finanzieren. Die
Professur wird an der Fakultät Kommunikation und
Umwelt am Campus Kamp-Lintfort verankert und
dort nach den fünf Jahren von der Hochschule
fortgeführt.
Sie ist der erste
öffentliche Schritt einer strategischen
Initiative mit der Landrat Ingo Brohl,
Hochschulpräsident Prof. Dr. Oliver
Locker-Grütjen und der Leiter der
EntwicklungsAgentur Wirtschaft Lukas Hähnel
gemeinsam eine verstärkte Verzahnung der
Hochschule mit der Wirtschaft im Kreis Wesel
anstoßen.
Im Rahmen des
Hochschulentwicklungsplans, und mit Blick auf
die geplante Gründung eines Europäischen
Zentrums für Nachhaltigkeitstransformation und
Teilhabe (EUZENT), soll die Rolle der Hochschule
als Impulsgeberin für nachhaltige Entwicklung,
Digitalisierung und Innovationsförderung weiter
ausgebaut werden und damit die Weiterentwicklung
der Wirtschaft und deren Transformation
unterstützen.
Starkes Zeichen für
regionale Verantwortung
„Die erste
Stiftungsprofessur im Kreis Wesel, die durch die
Heinz Trox-Stiftung ermöglicht wird, ist ein
exzellenter weiterer Schritt für unsere
Positionierung als dynamischer Standort im
Zentrum von Rheinland, Ruhrgebiet, den
Niederlanden und dem westlichen Münsterland.
Neben den massiven Investitionen des Kreises
Wesel in die Berufsschulen ist die Fortführung
der guten Entwicklung unserer Hochschule
Rhein-Waal wesentlich für die
Fachkräftesicherung und für zusätzliche
Entwicklungs- und Transformationsimpulse für
unsere heimische Wirtschaft. Daher freue ich
mich sehr über das außerordentlich starke auch
finanzielle Bekenntnis aus der heimischen
Wirtschaft zu unserer Hochschule Rhein-Waal und
unserer strategischen Initiative“, betonte
Landrat Ingo Brohl bei der feierlichen
Vertragsunterzeichnung in der Villa Kellermann.
Hochschulpräsident Prof. Dr. Oliver
Locker-Grütjen hob hervor: „Künstliche
Intelligenz wird eine Schlüsseltechnologie für
eine zukunftsfähige Gesellschaft sein. Dass
diese Professur mit Unterstützung aus der Region
realisiert werden kann, ist ein starkes Signal –
und Ausdruck unserer engen Partnerschaft mit
regionalen Akteuren.“
KI trifft Umwelt
und Kommunikation
Mit der neuen Heinz
Trox-Stiftungsprofessur für Angewandte
Künstliche Intelligenz setzt die Hochschule
Rhein-Waal gemeinsam mit regionalen Partnern ein
starkes Zeichen: Für exzellente Forschung,
praxisnahe Lehre und eine innovationsgetriebene
Transformation am Standort Niederrhein.
Engagement der Heinz Trox-Stiftung
Paul
Schwarz, Vorstand der Heinz Trox-Stiftung,
betonte die Zielsetzung der Förderung: „Mit der
Stiftungsprofessur für Angewandte Künstliche
Intelligenz stärken wir gezielt Innovation und
Nachhaltigkeit im Niederrhein Kreis Wesel, im
Geiste unseres Stifters und im Schulterschluss
mit Wissenschaft und Wirtschaft. Wir stehen klar
hinter der Idee von EUZENT und wollen aktiv zur
Entwicklung eines europäischen Zentrums für
Nachhaltigkeitstransformation in unserer Region
beitragen.“
Die Heinz Trox-Stiftung,
benannt nach dem Unternehmer Heinz Trox,
verfolgt das Ziel, Wissenschaft, Forschung und
Bildung in zukunftsweisenden Feldern zu stärken.
Mit ihrem Engagement für die Professur für
Angewandte Künstliche Intelligenz an der
Hochschule Rhein-Waal setzt die Stiftung ein
nachhaltiges Zeichen für die Förderung
technologischer Exzellenz und gesellschaftlicher
Verantwortung im Niederrhein Kreis Wesel.
Feierlicher Rahmen mit starken Partnern
Nach Grußworten von Hochschulpräsident Prof. Dr.
Oliver Locker-Grütjen, Landrat Ingo Brohl, Dekan
Prof. Dr. Klaus Hegemann, Lukas Hähnel (Leiter
der EntwicklungsAgentur Wirtschaft, Kreis Wesel)
Christine Roßkothen (Heinz Trox-Stiftung) und
Paul Schwarz (Heinz Trox-Stiftung) wurde der
Kooperationsvertrag offiziell unterzeichnet. Mit
der Heinz Trox-Stiftungsprofessur für Angewandte
Künstliche Intelligenz an der Hochschule
Rhein-Waal wird die erste Stiftungsprofessur im
Kreis Wesel eingerichtet.

(von links) Leiter EntwicklungsAgentur
Wirtschaft, Lukas Hähnel, Hochschulpräsident
Prof. Dr. Oliver Locker-Grütjen, Landrat Kreis
Wesel Ingo Brohl, Paul Schwarz (Heinz
Trox-Stiftung), Christine Roßkothen (Heinz
Trox-Stiftung) und Dekan Prof. Dr. Klaus
Hegemann - Foto HSRW – Anja Peters
Kleve: Führung durch die Schwanenburg -
Zusatztermin wegen großer Nachfrage
Führung durch die Schwanenburg am 05. Juli 2025
Kleve. Die Schwanenburg, das über Kleve
thronende Wahrzeichen der Stadt, ist nicht nur
ein imposantes Gebäude, sondern blickt auch auf
eine lange und bewegte Geschichte zurück. Wer
diese näher kennenlernen möchte, ist herzlich
eingeladen, an der Schwanenburgführung der
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve
GmbH (WTM) am Samstag, den 05. Juli
teilzunehmen.

Zwei Stadtführerinnen am Stauferklo im
Spiegelturm der Schwanenburg
Bei dem
rund 90-minütigen Rundgang mit Stadtführerin
Wiltrud Schnütgen erfahren die Teilnehmer
Wissenswertes über die Baugeschichte,
historische Ereignisse und die wechselnde
Nutzung der Burg. Dabei wird der Schwanenturm
bis in den Speicher bestiegen, in dem man das
Schlagen der Glocken live miterleben kann.
„Besonders spannend sind auch die
Gewölberäume im Spiegelturm mit dem legendären
Stauferklo, die man nur im Rahmen von Führungen
besichtigen kann“, sagt Mina van Lutterveld,
Mitarbeiterin in der Tourist Information der
WTM.
Die Führung, die interessante
Einblicke in die Geschichte und Architektur der
Schwanenburg bietet, beginnt um 14.30 Uhr am
Portal der Schwanenburg und kostet 8 € pro
Person. Für Familien gibt es einen Sonderpreis
von 17 € inklusive Eintritt in den Turm. Die
Buchung ist online auf www.kleve-tourismus.de
oder bei der WTM Stadt Kleve (Tel.: 02821
84-806) möglich.
Kleve:
Neon-Party im Radhaus am Freitag, 27. Juni 2025
Feiern, tanzen und vieles mehr: Die Neon-Partys
im Radhaus sind Highlights für Jugendliche.

Die nächste Auflage der stets beliebten
Neon-Party im Jugend- und Kulturzentrum Radhaus
steht an! Gefeiert wird am Freitag, 27. Juni
2025, von 18:00 bis 21:00 Uhr in der gewohnten
Location am Sommerdeich 37 in Kleve.
Dann öffnet das Radhaus seine Türen für alle
Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 15
Jahren. Zur Alterskontrolle wird am Einlass ein
gültiger Personalausweis oder Schülerausweis mit
Bild benötigt. Ausnahmen von der
Altersbeschränkung können leider nicht gemacht
werden.
Am Abend kann bei guter Musik
gefeiert und getanzt werden. Wer Lust hat, kann
sich außerdem an der „Free-Make-Up-Station“
schminken lassen. Die verwendeten GLOW-Farben
leuchten im Schwarzlicht und erzeugen auffällige
Neon-Effekte. Die Veranstaltung wird gemeinsam
von den Klever Jugendhäusern und der Stadt Kleve
organisiert. Neben einigen Aktionen gibt es
alkoholfreie Getränke und Snacks für kleines
Geld.
Der Eintritt zur Neon-Party ist wie
immer kostenlos. Eine Eintrittskarte wird nicht
benötigt. Einfach vorbeikommen, mitfeiern und
Spaß haben!
Eigenklang und
Coversongs mit EXSALTÉ im Klever Forstgarten
Am Sonntag, 29. Juni 2025, lädt die Stadt Kleve
um 15:00 Uhr zum nächsten Forstgartenkonzert in
den idyllischen Blumenhof des historischen
Forstgartens ein. Zu Gast ist die
Indie‑Rock‑Band EXSALTÉ, die mit ihrem
energiegeladenen Mix aus eigenen Songs und
bekannten Independent‑ und Alternative‑Stücken
für mitreißende Live‑Atmosphäre sorgen wird. Der
Eintritt ist frei.

EXSALTÉ besteht aus vier Musikern mit Wurzeln im
Kreis Kleve: Helmut Dumont (Leadgitarre,
Ukulele, Bluesharp, Gesang),
Patrick C. J. Hascoët (Gitarre, Bass, Bluesharp,
Gesang), Klaus Heckner (Gitarre, Bass,
Akkordeon) und Alfred Derks (Schlagzeug). Ihre
Musik bewegt sich zwischen Indie‑ und
Alternative‑Rock, zeigt Nähe zum
Singer‑Songwriter‑Genre und verbindet
energetische Rhythmuslinien mit elektrischen
sowie akustischen Gitarrenriffs.
Melodischer Gesang trifft auf Bluesharp‑ und
Ukulelen‑Klang, unterstützt durch
harmonisch‑melodischen Bass. Inspiriert von
amerikanischen Rocklegenden, reicht ihr
Repertoire von eigenen Kompositionen bis hin zu
einfühlsamen Interpretationen bekannter Songs.
Die Forstgartenkonzerte sind ein fester
Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt
Kleve. Sie bieten Musikliebhabern aller
Generationen die Gelegenheit, hochwertige
Live‑Musik an entspannten Sonntagnachmittagen
eingebettet in die grüne, historische Kulisse
des Forstgartens zu genießen. Die Reihe
begeistert durch musikalische Vielfalt und
Atmosphäre und ist ein kultureller Höhepunkt im
Veranstaltungskalender der Stadt.
Weitere
Informationen sowie das vollständige Programm
der Konzertreihe finden Sie auf der Website der
Stadt Kleve unter
www.kleve.de/forstgartenkonzerte
Denkmalförderung in Kleve: Für 2025 sind
noch Fördermittel verfügbar!
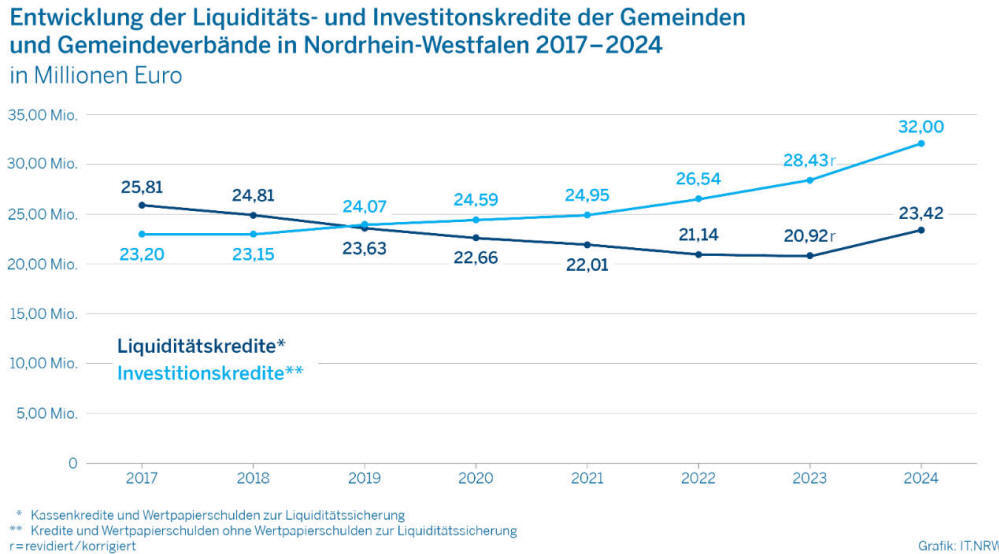
Unter anderem die Instandsetzung des Fugennetzes
dieses Denkmals an der Tiergartenstraße wurde
2024 aus Mitteln der städtischen
Denkmalförderung unterstützt.
Wer ein
denkmalgeschütztes Gebäude besitzt, ist nach dem
nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetz dazu
verpflichtet, dieses in Stand zu halten und vor
Gefährdungen zu schützen. Da
Instandsetzungsmaßnahmen an Denkmälern
allerdings durchaus ins Geld gehen können,
werden Eigentümerinnen und Eigentümer dabei
durch die Stadt Kleve und das Land
Nordrhein-Westfalen unterstützt.
Bereits
seit über zehn Jahren existiert ein Fördertopf
für kleinere Instandsetzungsarbeiten an
denkmalgeschützten Gebäuden in Kleve. Mithilfe
der „Stadtpauschale“ des Landes NRW stellt die
Stadt Kleve jährlich insgesamt 20.000 € an
Fördergeldern bereit.
Seit dem Start
dieses Fördertopfes konnte die Untere
Denkmalbehörde kleinere denkmalpflegerische
Arbeiten an rund 200 Baudenkmälern sowie an
Objekten innerhalb der drei Denkmalbereiche in
Kleve – Tiergartenstraße/Kavarinerstraße,
Griethausen und Biesenkamp – unterstützen.
Pro Maßnahme können Zuschüsse in Höhe von 50
% der zuwendungsfähigen Aufwendungen, maximal
jedoch 2.500 € gezahlt werden. Entsprechende
Maßnahmen sind allerdings im Vorfeld mit der
Unteren Denkmalbehörde der Stadt Kleve
abzustimmen.
Im Jahr 2024 wurden sieben
verschiedene Maßnahmen gefördert. Die Höhe der
Förderung lag im Durchschnitt bei 12 % der
förderfähigen Kosten. Für das Jahr 2025 sind
noch Fördermittel verfügbar. Ein Antrag kann
formlos erfolgen, doch für das laufende Jahr ist
Eile geboten. Die Beantragung der Förderung, die
Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde und
die Fertigstellung der geförderten Arbeiten
müssen in demselben Kalenderjahr erfolgen.
Alle Details zur Förderung sind den
Richtlinien der Stadt Kleve für die Vergabe von
Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpflege vom
15.10.2022 zu entnehmen. Interessierte finden
die Richtlinien auf www.kleve.de/denkmal. Für
Fragen steht die Untere Denkmalbehörde per Mail
an denkmal@kleve.de zur Verfügung.
Wesel: Runder Tisch Salzbergbau -
Veranstaltung am 7. Juli
Mit Beschluss aus dem Jahr 2025 hat der Weseler
Kreistag die Kreisverwaltung mit der Ausrichtung
eines Runden Tisches Salzbergbau beauftragt. Die
im Stil eines Dialogforums geplante
Veranstaltung widmet sich vor allem den
unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten
auf das inzwischen beschiedene bergrechtliche
Planfeststellungsverfahren zum
Rahmenbetriebsplan für das Salzbergwerk
Rheinberg-Borth.
Mit der Veranstaltung
stellt die Kreisverwaltung Wesel eine Plattform
für einen offenen, konstruktiven Dialog zwischen
den Beteiligten bereit. Die Besucherinnen und
Besucher erwarten verschiedene Fachbeiträge,
unter anderem von der zuständigen Bergbehörde
(Bezirksregierung Arnsberg), des
Bergwerkunternehmens K+S sowie einen Beitrag der
„Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte.“
Neben der Einordnung aus unterschiedlichen
fachlichen Perspektiven ist Raum für einen
moderierten Austausch vorgesehen.
Der Runde
Tisch findet statt am Montag, 7. Juli 2025, von
9.30 Uhr bis 17 Uhr im Kreishaus Wesel, Großer
Sitzungssaal (Raum 008) Reeser Landstraße 31,
46483 Wesel. Bürgerinnen und Bürger, die an der
Veranstaltung teilnehmen wollen, können sich ab
Montag, 23.06.2025, unter folgendem Link https://beteiligung.nrw.de/k/1015023 anmelden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Wesel - B58: Verkehrseinschränkungen auf
der Rheinbrücke
Ab Mittwoch (25.6.) kommt es zu
Verkehrseinschränkungen auf der Rheinbrücke
Wesel. In den kommenden Tagen sperrt die
Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein
die innenliegende Spur in Fahrtrichtung Geldern
zwischen dem Pylon und dem rechtsrheinischen
Widerlager.
Grund hierfür sind
Restarbeiten im Bereich der Seildämpfer, die im
November 2024 an den Fußpunkten der Schrägseile
montiert wurden. Größtenteils handelt es sich
dabei um Ausbesserungen des Korrosionsschutzes.
Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, müssen
sie je nach Wetterlage pausieren.
Hintergrund der Maßnahme: Im Frühjahr 2023
führten starke Windböen zu ungewöhnlich heftigen
Seilschwingungen an der Rheinbrücke. In der
Folge beauftragte der Landesbetrieb Straßenbau
NRW mehrere Spezialgutachten, die den Einbau von
Seildämpfern als notwendige Maßnahme
bestätigten. Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen,
wurden die Seile zunächst händisch mit
elastischen Seilverbindungen stabilisiert.
Die Schwingungen hatten keine Schäden an der
Konstruktion zur Folge. Die nun anstehenden
Restarbeiten konnten witterungsbedingt nicht im
Rahmen der ursprünglichen Montage im Herbst 2024
abgeschlossen werden. Für ihre Durchführung sind
sommerliche Bedingungen erforderlich.
Nach oben springen
Hausgärten: wichtig für Siedlung und
Quartier
Verband Wohneigentum:
Positionspapier „Vom Wert der Hausgärten“
In der aktuellen Debatte um das Eigenheim stehen
oft Aspekte wie Flächenverbrauch,
Energieeffizienz und Zersiedelung im
Mittelpunkt. Weniger Beachtung findet die
zentrale Rolle privater Gärten – dabei sind sie
lebendige, multifunktionale Räume mit großem
Potenzial.

© Verband Wohneigentum
Der gemeinnützige
Verband Wohneigentum betont in seinem
Positionspapier „Vom Wert der Hausgärten“ die
Bedeutung dieser grünen Oasen für eine
nachhaltige, resiliente und lebenswerte Stadt-
und Siedlungsentwicklung. „Gärten sind kein
bloßer Luxus, sondern ein wohnpolitischer
Schatz“, betont Peter Wegner, Präsident des
Verbands Wohneigentum. „Wer sie nur als
Flächenverbrauch sieht, übersieht ihre enorme
Bedeutung für Klima, Biodiversität und soziale
Stabilität.“
Mit rund 17 Millionen
privaten Gärten in Deutschland – einer Fläche
vergleichbar mit allen Naturschutzgebieten des
Landes – sind sie ein wertvolles Rückgrat
funktionierender Quartiere. Grüne Infrastruktur
mit Mehrwert Hausgärten übernehmen vielfältige
Funktionen: Sie verbessern das Mikroklima durch
Verdunstung und Schatten, speichern CO2,
entlasten das Kanalnetz bei Starkregen und
fördern den sparsamen Umgang mit
Wasserressourcen.
Damit ersetzen sie
kostenintensive Infrastrukturen und leisten
einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung.
Naturnahe Gestaltung fördert Klimaanpassung und
Artenvielfalt Naturnah gestaltet, bieten Gärten
Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleinsäuger.
Der Verband unterstützt
Gartenbesitzer*innen durch Beratung und
Wettbewerbe, um Gärten als ökologische Lern- und
Lebensräume zu stärken – ganz im Sinne seines
Leitbilds „Naturnah Gärtnern“. Gärten als
soziale und gesundheitliche Kraftzentren Neben
ökologischen Vorteilen fördern Gärten auch das
individuelle Wohlbefinden.
Der
Aufenthalt im Grünen reduziert Stress, animiert
zu Bewegung und gesunder Ernährung und schafft
Räume für nachbarschaftlichen Austausch –
besonders wichtig in Zeiten wachsender
Anonymität. Politischer Appell: Gärten schützen
und fördern Verband-Wohneigentum-Präsident
Wegner: „Die Debatte um das Eigenheim muss
differenzierter geführt werden. Statt pauschaler
Kritik am Einfamilienhaus braucht es politische
Strategien, wie bestehende Siedlungen
zukunftsfähig weiterentwickelt werden können.
Private Gärten spielen dabei eine Schlüsselrolle
– als kostbare Ressource im dicht besiedelten
Raum.“
Es gilt, diese Potenziale zu
erkennen und politisch wie planerisch zu
integrieren – etwa durch Förderung naturnaher
Gestaltung, Entsiegelung oder stärkere
Berücksichtigung in der Stadtplanung. Der
Verband Wohneigentum richtet seit 70 Jahren
Bundeswettbewerbe in Siedlungen aus und berät
seit seinen Anfängen zum naturnahen Gärtnern:
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich
Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer vor allem
in ihren eigenen Gärten für Klimaschutz und
Artenvielfalt einsetzen", resümiert Peter
Wegner.
ADAC-Analyse: Camping am Niederrhein besonders
günstig
„Campingurlaub ist in
Nordrhein-Westfalen auch in diesem Jahr
günstiger als in den meisten anderen
Bundesländern.“ Das meldet der ADAC und verweist
dabei auf eine aktuelle Preisanalyse seines
Campingportals PiNCAMP.
Demnach muss
eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind
für eine Übernachtung auf einem Campingplatz in
NRW im Sommer 2025 (Hochsaison) im Schnitt 38
Euro zahlen. Ganz besonders günstig ist es am
Niederrhein: Hier liegt der ermittelte
Durchschnittspreis bei nur 32 Euro. Bundesweit
kostet eine Übernachtung im Durchschnitt 40
Euro.
Damit ist Deutschland im
europäischen Vergleich der Haupturlaubsländer
für eine dreiköpfige Familie auch 2025 das
günstigste Campingland. Und: Hierzulande boomt
der Campingurlaub weiterhin: Knapp 43 Millionen
Übernachtungen wurden 2024 auf deutschen
Campingplätzen gemeldet, was einen neuen Rekord
bedeutet.
Auch am Niederrhein sind die
Zahlen deutlich gestiegen. Laut Statistik von
IT.NRW wurden 2024 rund 169.930 Ankünfte
gezählt, ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber dem
Vorjahr auf Campingplätzen am Niederrhein. Mit
rund 441.370 Übernachtungen ist gar ein Plus von
12,8 Prozent zu verzeichnen.
Die Zahlen
gelten für die Region von Niederrhein Tourismus
(NT) sowie den Rhein-Kreis Neuss und die Städte
Mönchengladbach, Duisburg und Krefeld. „Camping
und Caravaning nimmt am Niederrhein einen hohen
Stellenwert ein – wie die genannten Zahlen
zeigen –, und unterstützt die strategische
Ausrichtung des Tourismus durch naturnahe
Erlebnisse und ehrliches
Preis-Leistungs-Verhältnis, um einen erholsamen
Urlaub genießen zu können“, sagt
NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner.

Campingplätze am Niederrhein erfreuen sich
großer Beliebtheit. Foto: Kerstgenshof

NRW-Industrie: Der Absatzwert der
Textilproduktion ist um fast 4 % gesunken
* Die erzeugte Gewebemenge reicht aus, um ganz
Bielefeld zu bedecken
* Betriebe im
Regierungsbezirk Münster waren die wertmäßig
größten Textilproduzenten in NRW
* Mehr als
ein Viertel des bundesweiten Absatzwerts entfiel
auf NRW
Im Jahr 2024 sind in 192 der
9.746 produzierenden Betriebe des
nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes
Textilien im Wert von 2,7 Milliarden Euro
hergestellt worden. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, waren das nominal 107,1 Millionen Euro
bzw. 3,9 % weniger als ein Jahr zuvor.
Gegenüber dem Jahr 2019 sank der Absatzwert um
258,6 Millionen Euro bzw. 8,9 %. Technische
Textilien, wie z. B. Metallgarne und Gewebe aus
Metallfäden, hatten in den letzten sechs Jahren
den jeweils größten Absatzwert der verschiedenen
Textilarten. Im vergangenen Jahr wurden u. a.
241,2 Quadratkilometer (−2,5 % gegenüber 2023)
Gewebe aus natürlichen oder synthetischen Fasern
mit einem Absatzwert von 508,8 Millionen Euro
(−5,1 %) produziert.
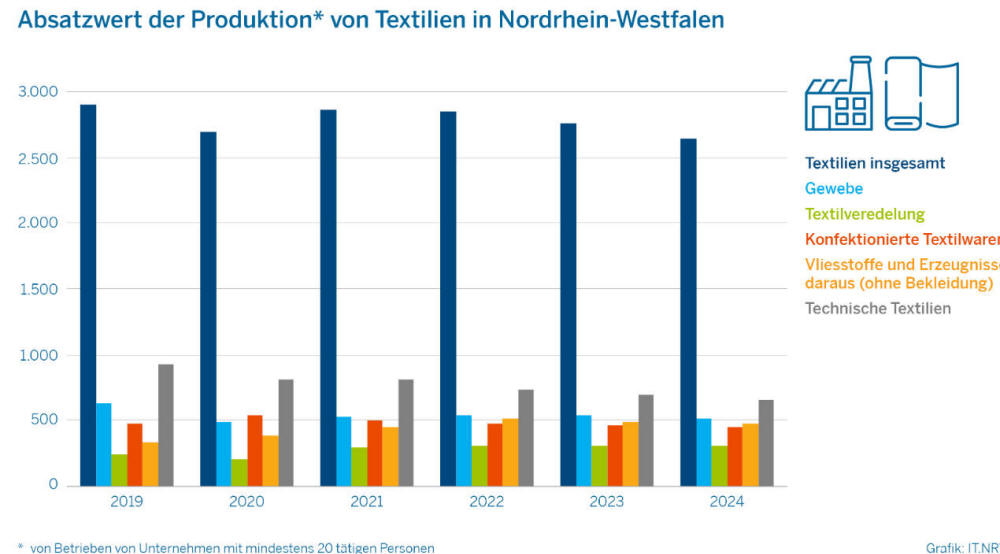
Weitere 28,2 Quadratkilometer (−6,0 %)
Gewebe wurden hergestellt und im jeweils
gleichen Betrieb zu anderen Produkten
weiterverarbeitet. Nebeneinander ausgebreitet
hätten diese 269,4 Quadratkilometer Gewebe
ausgereicht, um mehr als die Fläche der Stadt
Bielefeld komplett abzudecken. Des Weiteren
wurden technische Textilien mit einem Absatzwert
von 652,8 Millionen Euro (−5,2 %) und
Vliesstoffe und Erzeugnisse daraus (ohne
Bekleidung) im Wert von 469,7 Millionen Euro
(−3,9 %) erzeugt.
Bei konfektionierten
Textilien wie z. B. Säcken und Beutel, Planen,
Markisen, Zelten und Segeln lag der Absatzwert
bei 441,0 Millionen Euro (−4,8 %) und im Rahmen
der Textilveredlung konnte ein Absatzwert von
304,5 Millionen Euro erzielt werden, was einem
leichten Rückgang von 0,3 % entspricht.
Betriebe im Regierungsbezirk Münster mit
höchstem NRW-Anteil 41,6 % bzw. 1,1 Milliarden
Euro des nordrhein-westfälischen Absatzwerts
wurde 2024 in Betrieben im Regierungsbezirk
Münster erzielt, gefolgt von Betrieben in
Düsseldorf mit 23,8 %, Köln 16,7 %, Detmold
11,9 % und Arnsberg mit 5,9 %. NRW-Anteil am
gesamtdeutschen Absatzwert leicht gesunken
Bundesweit wurden im Jahr 2024 Textilien im Wert
von 9,7 Milliarden Euro erzeugt.
Das
waren 2,4 % weniger als 2023 und 2019. Lag der
Anteil nordrhein-westfälischer Betriebe am
gesamtdeutschen Absatzwert 2023 noch bei 27,8 %,
so sank er im letzten Jahr auf 27,4 % (2019=
29,3 %). Absatzwert im 1.Quartal 2025 leicht
gestiegen Im ersten Quartal 2025 stellten nach
vorläufigen Ergebnissen 182
nordrhein-westfälische Betriebe Textilien im
Wert von 674,8 Millionen Euro her, was einer
Steigerung von 0,7 % gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.
NRW: 21,5 % mehr neue
Ausbildungsverträge von ausländischen
Auszubildenden als im Vorjahr
*
Zahl der neuen Ausbildungsverträge von deutschen
Auszubildenden gesunken
* 2024 fast doppelt
so viele Neuabschlüsse von ausländischen Azubis
wie vor zehn Jahren
* Ausländeranteil
variiert regional und zwischen den
Ausbildungsbereichen
Im Jahr 2024 haben
13.569 Auszubildende mit ausländischer
Staatsangehörigkeit in Nordrhein-Westfalen einen
Ausbildungsvertrag im dualen System neu
abgeschlossen. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, stieg die Zahl der ausländischen
Ausbildungsanfängerinnen und Ausbildungsanfänger
damit im Vergleich zum Vorjahr um 21,5 %.
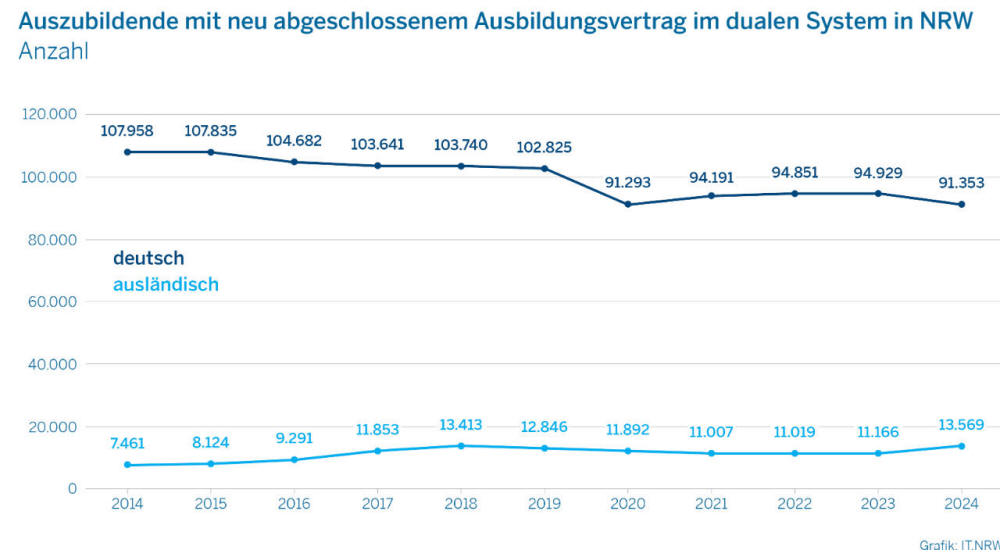
Im Gegensatz dazu ist die Zahl der deutschen
Azubis mit neu abgeschlossenem
Ausbildungsvertrag in 2024 um 3,8 % auf 91.353
gesunken. Insgesamt gab es 104.922 neue Azubis,
das waren 1,1 % weniger als im Jahr zuvor. Fast
doppelt so viele Neuabschlüsse von ausländischen
Azubis wie vor zehn Jahren Im
Zehnjahresvergleich hat sich die Zahl der
ausländischen Auszubildenden mit neu
abgeschlossenem Ausbildungsvertrag nahezu
verdoppelt: 2014 hatten 7.461 ausländische
Azubis ihre duale Ausbildung in NRW begonnen.
Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der
neuen Ausbildungsverträge von Auszubildenden mit
deutscher Staatsangehörigkeit um 15,4 %
gesunken. Anteil der ausländischen Neu-Azubis
bei fast 13 % – Bonn und Herne mit dem höchsten
Anteil Anteilig wurden 12,9 % der neuen
Ausbildungsverträge im dualen System in NRW im
Jahr 2024 von ausländischen Auszubildenden
abgeschlossen.
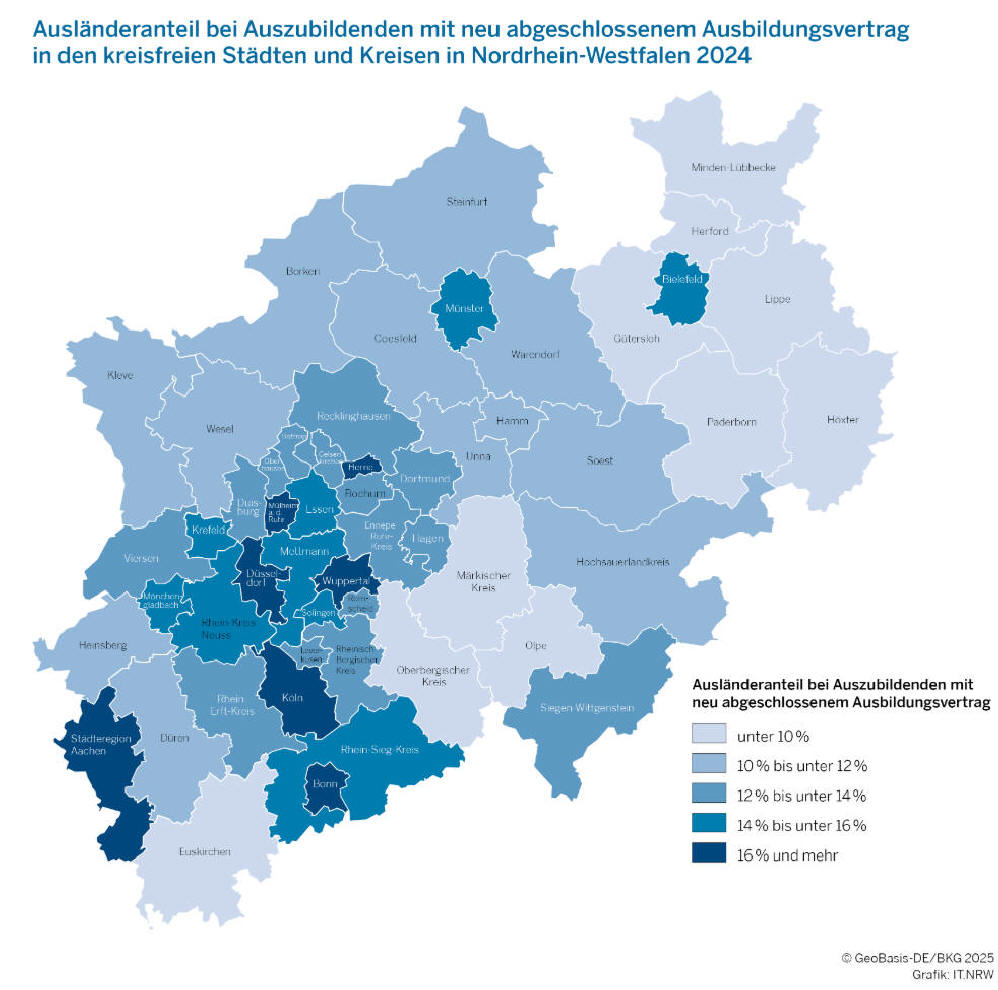
Zum Vergleich: In der Bevölkerung im Alter
von 15 bis unter 25 Jahren in NRW lag der
Ausländeranteil Ende 2024 bei 18,2 %. Bei den
kreisfreien Städten und Kreisen in NRW hatten
2024 die Städte Bonn mit 19,4 %, Herne mit
19,0 % und Düsseldorf mit 18,3 % die höchsten
Anteile ausländischer Auszubildender mit neu
abgeschlossenem Ausbildungsvertrag. Die anteilig
wenigsten Neuabschlüsse von ausländischen Azubis
gab es im Kreis Höxter mit 7,0 % sowie in den
Kreisen Euskirchen und Lippe mit jeweils 7,7 %.
Betrachtet werden die Orte, in denen die
Azubis ihre Ausbildungsstätte haben.
Ausländeranteil variiert in den
Ausbildungsbereichen zwischen 2,4 % und 25,8 %
Der Anteil der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge, die von ausländischen
Azubis abgeschlossen wurden, war 2024 im
öffentlichen Dienst mit 2,4 % und in der
Landwirtschaft mit 3,5 % am geringsten.
Den höchsten Anteil ausländischer Auszubildender
gab es im Ausbildungsbereich Freie Berufe, zu
dem z. B. medizinische Fachangestellte sowie
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte zählen:
25,8 % der neuen Ausbildungsverträge wurden in
diesem Bereich von Azubis mit ausländischer
Staatsangehörigkeit abgeschlossen. Auch bei den
Auszubildenden im Handwerk in NRW war der
Ausländeranteil mit 15,3 % überdurchschnittlich.
Zahl der Azubis im dualen System
insgesamt rückläufig Wie das Statistische
Landesamt weiter mitteilt, befanden sich zum
31.12.2024 insgesamt 271.944 Personen in NRW in
einem dualen Ausbildungsverhältnis. Das waren
0,8 % weniger als im Vorjahr; damals hatte es
noch 274.086 Azubis gegeben.
Mittwoch, 25. Juni 2025
EU und Kanada
unterzeichnen Sicherheits- und
Verteidigungspartnerschaft
Die
Führungsspitzen der Europäischen Union und
Kanadas, Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen und Ratspräsident António Costa sowie
Premierminister Mark Carney, haben eine
Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft auf
den Weg gebracht.
Beim 20.
EU-Kanada-Gipfeltreffen vereinbarten sie zudem
die rasche Aufnahme von Gesprächen über ein
neues bilaterales Abkommen mit dem Ziel, Kanada
den Zugang zur gemeinsamen europäischen
Rüstungsbeschaffungsinitiative SAFE zu gewähren.
Das würde es ermöglichen, Investitionen in
innovative Verteidigungsprojekte zu lenken.
Erfolg von CETA
Die EU und Kanada
erörterten den Erfolg des umfassenden
Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA)
zwischen beiden Partnern. Seit seinem
vorläufigen Inkrafttreten im Jahr 2017 hat CETA
den Handel zwischen der EU und Kanada um 71
Prozent gesteigert. Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) der EU wuchs um 3,2 Milliarden Euro und
das Kanadas um 1,3 Milliarden Euro jährlich.
Zusammenarbeit bei kritischen
Rohstoffen
Beide Seiten kamen überein, ihre
Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen zu
intensivieren, um sichere Lieferketten zu
stärken. Es soll einen industriepolitischen
Dialog geben, um die Zusammenarbeit der
Unternehmen in Schlüsselbereichen wie der
sauberen Technologie zu vertiefen.
Im
Bereich der Digitaltechnik erkennen beide Seiten
das große Potenzial für die digitale
Zusammenarbeit an. Sie vereinbarten, auf ein
Abkommen über den digitalen Handel
hinzuarbeiten, Normen und Infrastrukturen
anzugleichen und in den Bereichen
Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und
Quantenphysik zusammenzuarbeiten.
Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen:
Kaum mehr unter 1.000 Euro im Monat -
Fachkräftemangel führt in
vielen Tarifbranchen zu überdurchschnittlichen
Erhöhungen
Nach einer erneut
kräftigen Erhöhung der tarifvertraglichen
Ausbildungsvergütungen im Ausbildungsjahr
2024/25 um 6,4 Prozent (ungewichteter
Durchschnitt der hier berücksichtigten
Tarifbereiche; siehe unten) gibt es nur noch
sehr wenige Branchen, in denen Auszubildende im
ersten Jahr laut Tarifvertrag weniger als 1.000
Euro im Monat erhalten. Dies zeigt eine aktuelle
Studie über 20 ausgewählte Tarifbranchen, die
das Tarifarchiv des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung heute vorlegt.
„Mit
den Tarifverträgen sichern die Gewerkschaften
den Auszubildenden ein Einkommen, das in der
Regel mindestens dem Bafög-Höchstsatz für
Studierende von derzeit 992 Euro entspricht,“
sagt der Autor der Studie und Leiter des
WSI-Tarifarchivs, Prof. Dr. Thorsten Schulten.
„Damit wird dem Anspruch vieler Auszubildender
nach einer von den Eltern unabhängigen
Existenzsicherung Rechnung getragen.“
Problematisch ist die Situation hingegen in
Bereichen, in denen keine Tarifverträge
existieren.
„Hier erhalten die
Auszubildenden oft lediglich die viel zu
niedrige Mindestausbildungsvergütung von 682
Euro im Monat“, so Schulten. Der Deutsche
Gewerkschaftsbund fordert deshalb, dass die
Mindestausbildungsvergütung mindestens auf 80
Prozent der durchschnittlichen
tarifvertraglichen Vergütungen angehoben werden
soll, was derzeit 834 Euro im Monat entsprechend
würde.
„Unter den Engpassberufen, in
denen Fachkräfte fehlen, sind längst auch
etliche Ausbildungsberufe“, sagt Prof. Dr.
Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche
Direktorin des WSI. „Eine Stärkung der
Tarifbindung ist ein wichtiger Beitrag, um die
Fachkräftebasis von morgen zu sichern.“
Große Niveauunterschiede bei den
Ausbildungsvergütungen nach Branche, Region und
Ausbildungsjahr
Die Ausbildungsvergütungen
werden normalerweise im Rahmen der regulären
Tarifverhandlungen zusammen mit den Entgelten
der Beschäftigten verhandelt. Je nach Branche,
Region und Ausbildungsjahr zeigen sich bei den
tarifvertraglichen Ausbildungsvergütungen große
Niveauunterschiede.
Insgesamt reicht die
Spannbreite in den hier untersuchten
Tarifbranchen von 710 Euro im Monat im ersten
Ausbildungsjahr im Friseurhandwerk in
Nordrhein-Westfalen bis zu 1.650 Euro im Monat
im vierten Ausbildungsjahr für gewerbliche
Auszubildende im westdeutschen Bauhauptgewerbe.
Die Unterschiede bei den tarifvertraglichen
Ausbildungsvergütungen zeigen sich bereits im
ersten Ausbildungsjahr (siehe auch Abbildung 1).
In der Mehrzahl der hier untersuchten
Tarifbranchen liegen die Vergütungen
mittlerweile (deutlich) über 1.000 Euro pro
Monat.
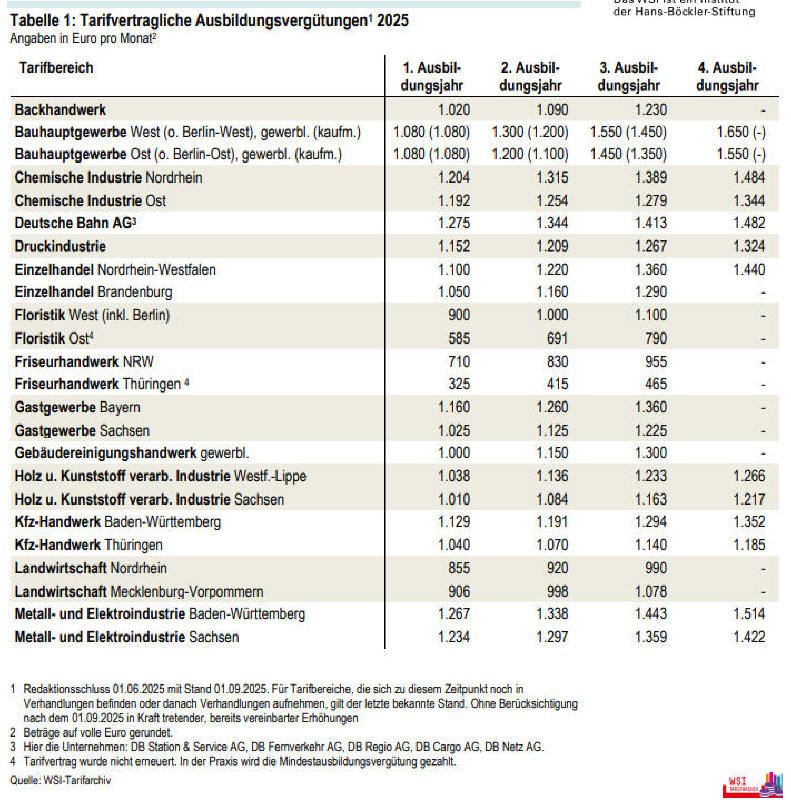
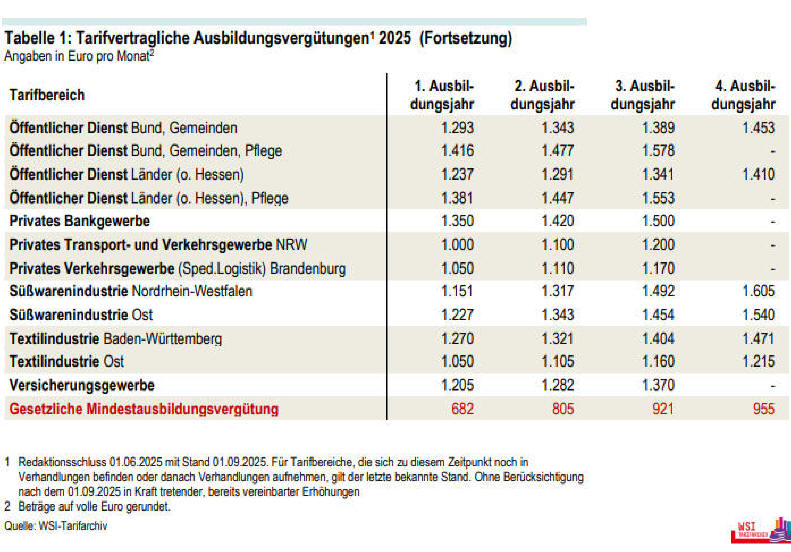
Lediglich in drei Tarifbranchen werden im
ersten Ausbildungsjahr noch Vergütungen
unterhalb von 1.000 Euro gezahlt. Diese sind die
Landwirtschaft, Bezirk Nordrhein (855 Euro) und
Mecklenburg-Vorpommern (906 Euro), die Floristik
in Westdeutschland (900 Euro) und das
Friseurhandwerk in Nordrhein-Westfalen (710
Euro).
Die höchsten monatlichen
Ausbildungsvergütungen mit Beträgen oberhalb von
1.200 Euro werden im ersten Ausbildungsjahr in
folgenden Branchen gezahlt:
- Pflegeberufe im
Tarifbereich des Öffentlichen Dienstes bei Bund
und Kommunen mit 1.416 Euro und bei den Ländern
mit 1.381 Euro
- Privates Bankgewerbe mit
bundeseinheitlich 1.350 Euro
- Öffentlicher
Dienst bei Bund und Kommunen mit
bundeseinheitlich 1.293 Euro und bei den Ländern
mit 1.237 Euro
- Deutsche Bahn AG mit
bundeseinheitlich 1.275 Euro
-
Textilindustrie in Baden-Württemberg mit 1.270
Euro
- Metall- und Elektroindustrie in
Baden-Württemberg mit 1.267 Euro und in Sachsen
mit 1.234 Euro
- Süßwarenindustrie in
Ostdeutschland mit 1.227 Euro
-
Versicherungsgewerbe mit bundeseinheitlich 1.205
Euro
- Chemische Industrie im Tarifbezirk
Nordrhein mit 1.204 Euro
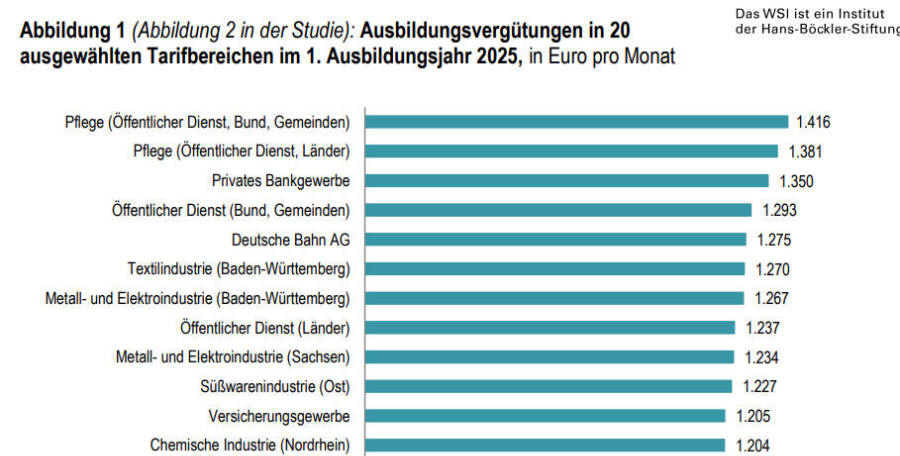

In etwa der Hälfte der hier untersuchten
Tarifbranchen liegt die Ausbildungsvergütung
zwischen 1.000 und 1.200 Euro pro Monat. Hierzu
gehören das Backhandwerk, das Bauhauptgewerbe,
die Druckindustrie, der Einzelhandel, das
Gastgewerbe, die Gebäudereinigung, die Holz und
Kunststoff verarbeitende Industrie, das
Kfz-Handwerk und das Private Verkehrsgewerbe.
Hinzu kommen für das ostdeutsche Tarifgebiet die
Chemische Industrie sowie für
Nordrhein-Westfalen die Süßwarenindustrie.
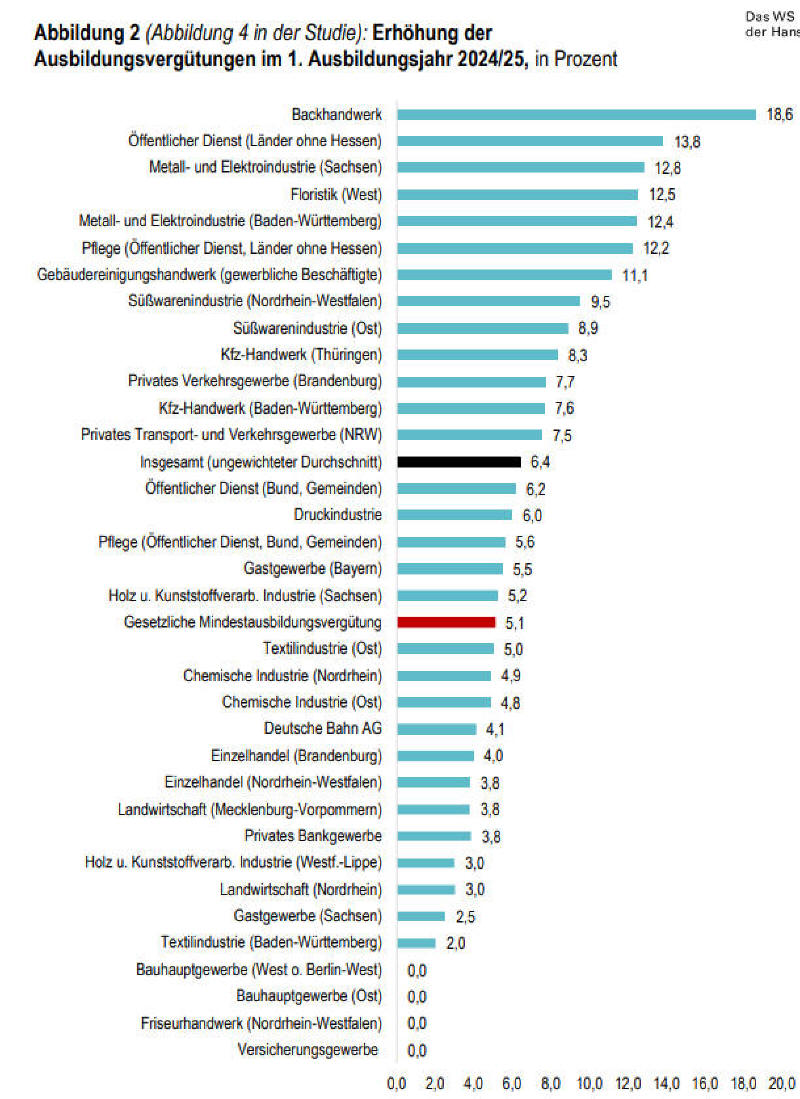
In lediglich sieben der vom WSI untersuchten
Tarifbranchen existieren bundesweit einheitliche
Ausbildungsvergütungen, darunter das
Backhandwerk, das Private Bankgewerbe, die
Druckindustrie, die Deutsche Bahn AG, das
Gebäudereinigungshandwerk, der Öffentliche
Dienst und das Versicherungsgewerbe.
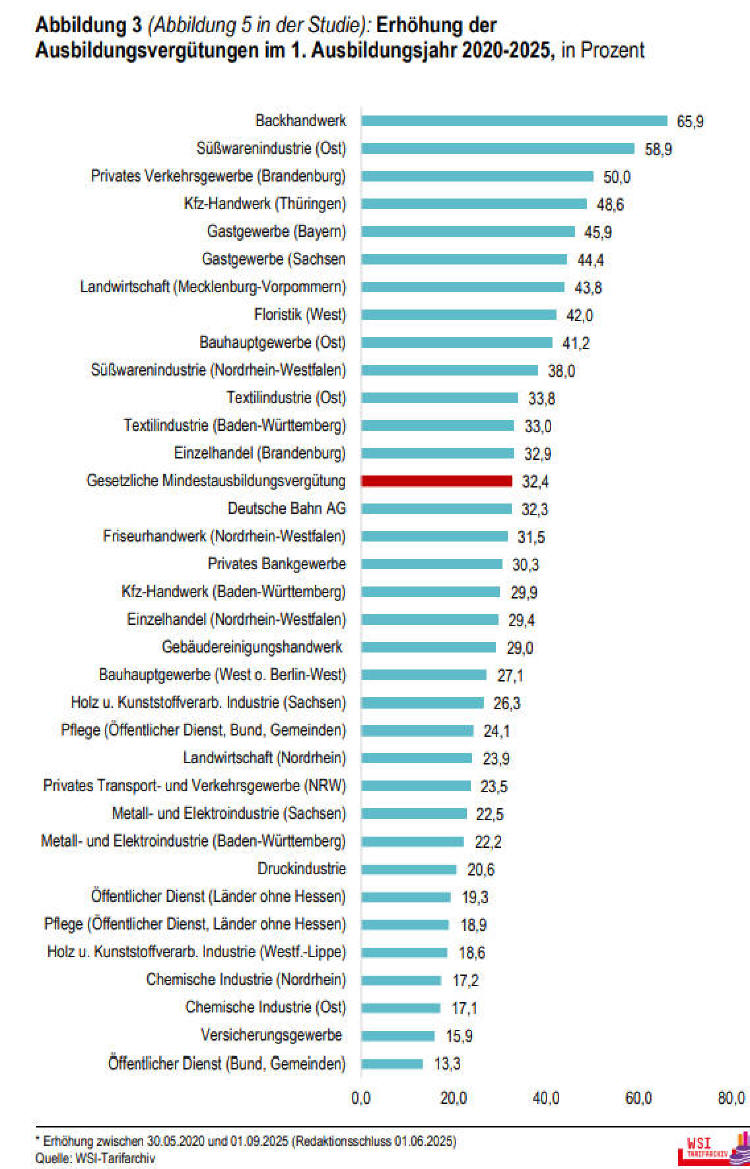
In zwölf Tarifbranchen bestehen teilweise
nach wie vor Unterschiede im Niveau der
Ausbildungsvergütungen zwischen den west- und
den ostdeutschen Tarifgebieten. Den größten
Unterschied gibt es mit einer Differenz von 220
Euro in der Textilindustrie sowie in der
Floristik mit 218 Euro.
In den übrigen
Branchen variieren die Ost-West-Unterschiede
zwischen 12 Euro in der Chemischen Industrie und
135 Euro im Gastgewerbe. Im privaten
Verkehrsgewerbe, in der Landwirtschaft und in
der Süßwarenindustrie liegen die ostdeutschen
Ausbildungsvergütungen mit 50,51 und 76 Euro
oberhalb des Niveaus in Westdeutschland.
Die erheblichen Unterschiede zwischen den
Branchen setzen sich auch im zweiten und dritten
Ausbildungsjahr fort. So variieren die
Ausbildungsvergütungen im zweiten
Ausbildungsjahr zwischen 830 Euro, die im
Friseurhandwerk in Nordrhein-Westfalen gezahlt
werden, und 1.477 Euro für die Auszubildenden in
der Pflege bei Bund und Kommunen (Tabelle 1).
Im dritten Ausbildungsjahr liegen die
Unterschiede zwischen 955 Euro im
Friseurhandwerk in Nordrhein-Westfalen und 1.578
Euro für die Auszubildenden in der Pflege bei
Bund und Kommunen. Mit Ausnahme des
Friseurhandwerks und der Landwirtschaft
(Nordrhein) liegen im dritten Ausbildungsjahr
mittlerweile alle Ausbildungsvergütungen
oberhalb von 1.000 Euro.
In elf der hier
ausgewerteten Branchen existiert darüber hinaus
auch eine Vergütung für ein viertes
Ausbildungsjahr. Die höchste
Ausbildungsvergütung wird dann mit 1.650 Euro im
Monat im westdeutschen Bauhauptgewerbe für
gewerbliche Auszubildende gezahlt. Der
niedrigste Wert für das vierte Ausbildungsjahr
findet sich mit 1.185 Euro im Kfz-Gewerbe von
Thüringen.
Ausbildungsvergütungen steigen
in vielen Tarifbranchen überdurchschnittlich
Im Laufe des Ausbildungsjahres 2024/25 (zwischen
dem 1. September 2024 und dem 1. September 2025)
sind die tarifvertraglichen
Ausbildungsvergütungen in den hier
berücksichtigten Tarifbranchen im ungewichteten
Durchschnitt, d.h. ohne Berücksichtigung der
unterschiedlichen Ausbildungszahlen in den
einzelnen Tarifbranchen, im ersten
Ausbildungsjahr um 6,4 Prozent gestiegen.
Gegenüber dem vorherigen Ausbildungsjahr
2023/2024, als der Anstieg in Zeiten erhöhter
Inflation bei außergewöhnlich hohen 9,0 Prozent
lag, sind die Zuwächse in diesem Jahr wieder
geringer ausgefallen. Die Ausbildungsvergütungen
steigen aber weiterhin schneller als die
regulären Tarifvergütungen der Beschäftigten,
die im Jahr 2024 um 5,5 Prozent zugenommen
haben.
Insgesamt gibt es bei den
Zuwächsen der Ausbildungsvergütungen im
Ausbildungsjahr 2024/25 zwischen den
Tarifbereichen eine große Spannbreite (Abbildung
2 in der pdf-Version). In insgesamt sieben
Tarifbereichen wiesen die Vergütungen
zweistellige Zuwachsraten auf. Spitzenreiter ist
mit einem Zuwachs von 18,6 Prozent das
Backhandwerk, das unter einem besonders hohen
Fachkräftemangel leidet und deshalb seine im
Vergleich zu vielen anderen Branchen immer noch
eher niedrigen Ausbildungsvergütungen anpassen
muss.
Überdurchschnittlich stark stiegen
die Ausbildungsvergütungen auch bei den
Pflegekräften sowie den sonstigen Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes bei den Ländern, in
der westdeutschen Floristik, in der
Gebäudereinigung sowie in der Metall- und
Elektroindustrie.
In sieben Tarifbranchen
– darunter der Druckindustrie, dem Kfz-Handwerk,
dem Öffentlichen Dienst (Bund und Gemeinden),
dem Privaten Verkehrsgewerbe, der
Süßwarenindustrie sowie dem bayerischen
Gastgewerbe und der Holz und Kunststoff
verarbeitenden Industrie in Sachsen – lagen die
Zuwächse zwischen 5,0 und 10,0 Prozent.
In
weiteren acht Tarifbranchen – darunter der
Chemischen Industrie, der Deutschen Bahn AG, dem
Einzelhandel, der Landwirtschaft, dem Privaten
Bankgewerbe, der Textilindustrie sowie dem
sächsischen Gastgewerbe und der Holz und
Kunststoff verarbeitenden Industrie in
Westfalen-Lippe – stiegen die Vergütungen
zwischen 2,0 und 5,0 Prozent und damit geringer
als die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung.
Lediglich drei Branchen haben bislang im
Ausbildungsjahr 2024/25 noch keine Erhöhung der
Ausbildungsvergütungen vorgenommen. Im
Bauhauptgewerbe sind erst im vergangenen
Ausbildungsjahr 2023/24 die
Ausbildungsvergütungen mit 22,7 Prozent in
Ostdeutschland und 15,5 Prozent in
Westdeutschland überdurchschnittlich stark
angehoben worden, so dass im aktuellen
Ausbildungsjahr keine weiteren Erhöhungen
vorgesehen sind. Im Versicherungsgewerbe laufen
derzeit noch die Tarifverhandlungen und im
nordrhein-westfälischen Friseurhandwerk starten
diese im Sommer 2025.
Hohe Zuwächse bei
den Ausbildungsvergütungen im Trend
Die
mittelfristige Dynamik der tarifvertraglichen
Ausbildungsvergütungen zeigt sich in der
Entwicklung der letzten fünf Jahre seit Beginn
des Ausbildungsjahres 2020/21 (siehe auch
Abbildung 3) Während die Tarifentgelte für die
Beschäftigten in den letzten fünf Jahren im
Durchschnitt um etwa 17 Prozent angestiegen
sind, lag der Zuwachs der Ausbildungsvergütungen
in den meisten der hier betrachteten
Tarifbranchen deutlich darüber.
Die
höchsten Steigerungsraten gab es dabei im
Backhandwerk, wo die Ausbildungsvergütungen im
ersten Ausbildungsjahr seit 2020 um 65,9 Prozent
zunahmen. An zweiter Stelle steht die
ostdeutsche Süßwarenindustrie, wo die
Ausbildungsvergütungen sich um 58,9 Prozent
erhöhten.
In weiteren sieben
Tarifbereichen stiegen die
Ausbildungsvergütungen zwischen 40 und 50
Prozent – darunter in den ostdeutschen
Tarifgebieten des Gastgewerbes (Sachsen), des
Kfz-Handwerks (Thüringen), der Landwirtschaft
(Mecklenburg-Vorpommern sowie des Privaten
Verkehrsgewerbes (Brandenburg) und in den
westdeutschen Tarifgebieten der Floristik und
des Gastgewerbes (Bayern).
In etwa der
Hälfte der hier untersuchten Tarifbereiche lagen
die Erhöhungen der Ausbildungsvergütungen in den
letzten fünf Jahren zwischen 20 und 35 Prozent.
Lediglich in fünf Branchen betrug der Zuwachs
weniger als 20 Prozent, wobei der Öffentliche
Dienst (Bund und Gemeinden) mit etwas über 13
Prozent das Schlusslicht bildete. „Insgesamt kam
es insbesondere in solchen Branchen zu besonders
starken Erhöhungen, in denen traditionell eher
niedrigere Ausbildungsvergütungen gezahlt werden
und die vor dem Hintergrund eines zunehmenden
Fachkräftemangels einen besonders hohen
Anpassungsbedarf haben“, resümiert der
Studienautor Schulten.
Wesel: „Demokratie lebt von Vielfalt –
engagiere Dich im Integrationsrat“
Unter dem Titel „Demokratie lebt von Vielfalt –
engagiere Dich im Integrationsrat!“ hat die
Integrationsbeauftragte der Stadt Wesel, Lotte
Goldschmidtböing zu einer
Informationsveranstaltung eingeladen.
Ziel war es, interessierte Bürgerinnen und
Bürger über die Aufgaben des Integrationsrates
zu informieren und für eine Kandidatur bei der
bevorstehenden Wahl am 14. September 2025 zu
gewinnen. Rund 20 Interessierte folgten der
Einladung und erhielten einen Einblick in die
politische Bedeutung des Integrationsrates.

Ein zentrales Highlight der Veranstaltung war
der Vortrag von Tayfun Keltek, Vorsitzender des
Landesintegrationsrates NRW. Er sprach sich
eindringlich für einen Perspektivwechsel in der
Integrationspolitik aus: weg von einer
Defizitorientierung hin zu einer klaren
Potenzialorientierung. Besonders hob er hervor,
wie wertvoll Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Kompetenzen als
gesellschaftliche Ressource sind.
„Es
geht darum, die Stärken und Kompetenzen von
Menschen mit internationaler Familiengeschichte
zu sehen und zu fördern, nicht ihre
vermeintlichen Defizite“, so Tayfun Keltek.
Gerade deshalb sei es wichtig, ihre
Lebensrealitäten aktiv in die kommunalpolitische
Gestaltung einzubinden.
Der
Integrationsrat bietet hierfür eine zentrale
Plattform. Er macht Themen sichtbar, die
Menschen mit internationaler Familiengeschichte
betreffen und stärkt ihre politische Teilhabe
auf kommunaler Ebene. Noch bis zum 7. Juli 2025
können Wahlvorschläge eingereicht werden.
Kandidieren können Menschen mit und ohne
internationaler Familiengeschichte, die in Wesel
wohnen und sich für Vielfalt, Toleranz und
gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren
möchten. Weitere Informationen erhalten
Interessierte bei der Geschäftsstelle des
Integrationsrates, der Integrationsbeauftragten
Lotte Goldschmidtböing, oder beim Wahlamt der
Stadt Wesel.
Dinslaken:
Ausfälle der Straßenbeleuchtung im Bereich
Kurt-Schumacher-Straße
Mitteilung
der Stadtwerke Dinslaken: "In Hiesfeld ist es
mehrfach, zuletzt am Wochenende, zu Ausfällen
der Straßenbeleuchtung gekommen. Die Störung
betrifft den Bereich der Kurt-Schumacher-Str. ab
Deller Heide, die Scholtenstr., Rubbertskath,
Schöttmannshof sowie das Gewerbegebiet Süd.
Da ein schleichender Kabelfehler vermutet
wird, kann es mehrere Tage oder auch Wochen
dauern, um den Fehler zu finden und zu beheben.
Die Stadtwerke Dinslaken sind vor Ort, um die
Störungsursache zu lokalisieren und bitten die
betroffenen Anlieger*innen um Geduld."
Wesel: Feldbahnfreunde erhalten
Fördermittel für Lokomotiven-Restaurierung vom
Kreis
Am Mittwoch, 18. Juni 2025,
übergaben Landrat Ingo Brohl und Lukas Hähnel
(Leiter EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis
Wesel) den Feldbahnfreunden Schermbeck-Gahlen
e.V. stellvertretend für die Stiftung Standort-
und Zukunftssicherung Kreis Wesel eine
Förderzusage in Höhe von 8.364 Euro für das
Projekt „Restaurierung der letzten erhaltenen
Lokomotive der IDUNAHALL-Ziegelei Schermbeck“.
Mit dem Geld können die
Vereinsmitglieder nun die letzte, noch vor Ort
erhaltene Feldbahnlok der ehemaligen
„Dachziegelwerke Idunahall Schermbeck“
aufarbeiten und wieder in Betrieb nehmen. Nach
erfolgreicher Fertigstellung sollen mit der
Feldbahn auch Besucherfahrten durchgeführt
werden. Bei diesen soll Technikverständnis,
insbesondere für Schulklassen, vermittelt
werden.
Darüber hinaus visualisiert
die Fahrt mit der Feldbahn auch den Tontransport
aus den ehemaligen Tonabbaugebieten in
Schermbeck. Michael Gorris nahm den
Förderbescheid für die Feldbahnfreunde
Schermbeck-Gahlen e.V. entgegen. Landrat Ingo
Brohl: „Die Feldbahnfreunde leisten einen
großartigen Beitrag zur Bewahrung unseres
regionalen Erbes. Mit viel Herzblut und
Fachwissen wird hier Industriekultur lebendig
gehalten – und künftig auch für junge Menschen
erfahrbar gemacht. Dadurch entsteht auch einer
der besonderen Erlebnisorte, die für unseren
niederrheinischen Tourismus wichtig sind.
Deshalb unterstützen wir die Feldbahnfreunde als
Kreis Wesel sehr gern und aus voller
Überzeugung.“
Die Stiftung Standort- und
Zukunftssicherung Kreis Wesel wurde im Dezember
2006 ins Leben gerufen, um zukunftsweisende
Projekte in der Region gezielt zu fördern. Sie
ist ein gemeinsames Engagement von
Kreisverwaltung und heimischer Wirtschaft und
bündelt im Sinne einer öffentlich-privaten
Partnerschaft Ideen, die den Kreis Wesel als
attraktiven Lebens-, Arbeits- und
Bildungsstandort nachhaltig stärken.

Landrat Ingo Brohl, Lukas Hähnel (Leiter
Entwicklungsagentur Wirtschaft Kreis Wesel) und
Sonja Choyka (Stiftung Standort- und
Zukunftssicherung Kreis Wesel) bei den
Feldbahnfreunden Schermbeck Gahlen. Copyright
Foto: Helmut Scheffler
Neue
Kanäle im Kreuzungsbereich Kanalsanierung in
Kapellen geht in die nächste Runde
Die ENNI Stadt & Service Niederrhein (Enni)
treibt die Sanierung der Kanalinfrastruktur im
Zentrum von Moers-Kapellen planmäßig voran. Im
Rahmen der zweiten großen Bauetappe rücken die
Arbeiten nun in den Kreuzungsbereich von
Bahnhof-, Moerser-, Bendmann- und Neukirchener
Straße vor.
Ab Dienstag, 1. Juli, ist
die Kreuzung für voraussichtlich fünf Wochen nur
noch eingeschränkt befahrbar. Der Verkehr kann
in dieser Zeit lediglich zwischen der Bahnhof-
und der Neukirchener Straße fließen – alle
anderen Fahrbeziehungen werden unterbrochen. Die
gute Nachricht: Nach Abschluss dieses
Bauabschnitts wird die Kreuzung vollständig
freigegeben – auch der seit Jahresbeginn
gesperrte Abschnitt der Moerser Straße.
„Dort stellen wir die Fahrbahndecke zunächst
provisorisch her, bevor wir sie nach Abschluss
der weiteren Arbeiten auf der Bahnhofstraße
dauerhaft erneuern“, erklärt Brian Jäger,
Bauleiter der Enni.
Während der
Baumaßnahme im Kreuzungsbereich bleibt die
Erreichbarkeit der anliegenden Grundstücke
grundsätzlich gewährleistet. Im unmittelbaren
Baufeld kann es jedoch zu temporären
Einschränkungen kommen. Enni bittet alle
Anwohnerinnen und Anwohner sowie
Verkehrsteilnehmende um Verständnis und
empfiehlt, den Bereich über die ausgeschilderten
Umleitungen zu umfahren.
„Wir wissen,
wie zentral diese Kreuzung für den Stadtteil
ist. Um die Auswirkungen auf den Verkehr
möglichst gering zu halten, haben wir die
Arbeiten so weit wie möglich in die Sommerferien
gelegt, wenn das Verkehrsaufkommen
erfahrungsgemäß geringer ist.“ Fragen zur
Maßnahme beantwortet Enni unter der Rufnummer
02841 104-600 oder online unter www.enni.de.
Enni liest Zähler bei 6.100 Kunden im Juli
in Repelen ab
Das Ableseteam der ENNI Energie & Umwelt
Niederrhein (Enni) ist im Zuge des sogenannten
rollierenden Ableseverfahrens im Juli im Moerser
Stadtteil Repelen unterwegs. „Dieses Mal
erfassen wir dort bei etwa 6.100 Haushaltskunden
rund 8.500 Strom-, Gas- und Wasserzählerstände.
Dabei unterstützt uns die
Dienstleistungsgesellschaft ASL Services“,
informiert Lisa Bruns als zuständige
Mitarbeiterin der Enni.
Sind vereinzelte
Zähler nicht für die Ableser der ASL zugänglich,
hinterlassen sie eine Informationskarte im
Briefkasten. „Die Bewohner finden darauf die
Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, an die sie
die Zählerstände selbst mitteilen können“, so
Bruns.
Wichtiger Hinweis: Die Ablesung
erfolgt jährlich. Als wiederkehrendes Ereignis
informiert die Enni die Kunden nicht gesondert
darüber. Dennoch hofft Lisa Bruns auf deren
Unterstützung: „Wichtig für uns ist, dass die
Zähler frei zugänglich sind. Nur so ist ein
schneller und reibungsloser Ablauf
gewährleistet.“
Übrigens: Damit keine
schwarzen Schafe in die Häuser gelangen, haben
alle durch Enni beauftragten Ableser einen
Dienstausweis. Bruns: „Den sollten sich Kunden
zeigen lassen, damit keine ungebetenen Gäste ins
Haus gelangen.“ Im Zweifel sollten sich Kunden
bei der Enni unter der kostenlosen
Service-Rufnummer 0800 222 1040 informieren.
Moers: Penguin’s Days 2025 - Ändern leben.
Malala Yousafzai und Sophie Scholl
Hessisches Landestheater Marburg
Wären
sie Freundinnen geworden? Wissen wir nicht.
Hätten sie sich gut verstanden? Wir wissen es
nicht. Aber was wir wissen: Sie waren mutig. Sie
leisteten Widerstand. Sie sind Vorbilder.

„Ein Kind, ein Lehrer / eine Lehrerin, ein Buch
und ein Stift können die Welt ändern.“ Das sagte
Malala Yousafzai aus Pakistan. Eines Tages
übernahm dort eine Macht die Macht, die nicht
wollte, das Mädchen weiter in die Schule gehen.
Doch Malala war anderer Meinung, wollte anders
leben, weiter lernen.
Um sie zu stoppen
wählte die Macht grausame Mittel und Malala
wurde schwer verletzt. Sie überlebte, blieb sich
treu: Bildung ist die einzige Lösung. Sophie
Scholl war Mitglied der „Weißen Rose“, mutige
Student*innen, die in Nazi-Deutschland dafür
kämpften, dass die Menschen die Wahrheit über
ein Regime erfahren, das alle Menschen
verfolgte, die nicht passten.
Das
tötete, Krieg anzettelte und alle Leben gleich
machen wollte und machte. Aber Sophie und ihre
Freund*innen verteilten Papiere, auf denen diese
Wahrheit stand. Sie überlebten nicht. Doch durch
ihren Mut wurden sie Vorbild für viele.
Alter: ab 8 Jahren Kartenvorverkauf unter 0
28 41 / 88 34-113 oder info@schlosstheater-moers.de
Tickets: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro
Weitere Infos unter Junges STM, Schlosstheater
Moers Veranstaltungsdatum 26.06.2025 -
09:00 Uhr - 09:45 Uhr. Veranstaltungsort
Schlosstheater - Studio. Adresse Kastell 6,
47441 Moers.
Moers: Penguin’s
Days 2025 - Unterm Kindergarten
Zwei junge Wesen treffen
aufeinander, da ist das Leben des einen schon
vorbei: Der kleine Vogel auf seinem ersten Flug
prallt gegen das Fenster des Kindergartens, ein
Kind findet und begräbt ihn. Es fragt sich: Was
passiert mit dem Tier? Was ist da los, in der
Erde? „Ist alles unter dem Kindergarten tot?“

Kinder- und Jugendtheater Dortmund
Zwei
Schauspieler erzählen wie im Spiel und voller
Witz, Zärtlichkeit und wilder Poesie: von der
Giraffe und dem Wal, dem Vogelkind, dem
Baggerfahrer und seinem unermüdlichen Bagger,
von Fossilien und einem in den Tiefen der Erde
versunkenen Baum.
Große Fragen übers
Leben, Werden und Vergehen werden mit
Leichtigkeit und Anarchie Teil eines Kosmos, in
dem die Lebewesen gleichwertig und
schlussendlich alle miteinander verbunden sind.
Alter: ab 4 Jahren Kartenvorverkauf
unter 0 28 41 / 88 34-113 oder info@schlosstheater-moers.de
Tickets: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro
Weitere Infos unter Junges STM, Schlosstheater
Moers Veranstaltungsdatum 26.06.2025 -
09:00 Uhr - 09:50 Uhr. Veranstaltungsort
Grafschafter Museum im Moerser Schloss, Kastell
9, 47441 Moers.
Moers: 2.
Bastelwerkstatt „Ein Kessel Buntes“ für Kinder
ab 4 Jahren Schmetterlinge, Blumen und
andere bunte Kleinigkeiten können an diesem
Nachmittag gebastelt werden. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich, für das Material
wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro erhoben.
Nähere Infos und Anmeldung unter Telefon: 0 28
41 / 201-751, unter jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek Moers.
Veranstaltungsdatum 26.06.2025 - 15:00
Uhr - 16:00 Uhr. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Moers: Kukuru Summer - After Work
Edition 2025
Open Air- mit
Gastronomieständen. Veranstaltungsdatum
27.06.2025 - 17:00 Uhr - 22:30 Uhr.
Veranstaltungsort Kastellplatz, 47441 Moers
.
Verkehrsregelnde Maßnahmen zur Klever
Kirmes 2025
Anlässlich der Klever
Kirmes auf den Festplätzen am Spoykanal und an
der Ludwig-Jahn-Straße von Samstag, 12.07.2025,
bis Sonntag, 20.07.2025, sind auch in diesem
Jahr wieder verkehrsregelnde Maßnahmen
erforderlich.
Klever Kirmes 2023

Zunächst werden die notwendigen
Vermessungsarbeiten für die Klever Kirmes
durchgeführt. Hierfür werden die Parkbereiche
wie folgt gesperrt:
Parkbereich
Ludwig-Jahn-Straße sowie Parkbereich Spoykanal
(hinterer Bereich) am Dienstag, 01.07.2025, von
18.00 Uhr bis ca. 22.30 Uhr
Parkbereich
Spoykanal (vorderer Bereich) am Mittwoch,
02.07.2025, von 18.00 Uhr bis ca. 22.30 Uhr.
Ab Samstag, 05.07.2025, 18.00 Uhr, bis
Dienstag, 22.07.2025, werden die Parkbereiche
Ludwig-Jahn-Straße und Spoykanal wegen der
Klever Kirmes einschließlich der Auf- und
Abbauarbeiten gesperrt.
Ebenfalls
gesperrt werden die Parkbereiche für Wohnmobile
an der van-den-Bergh-Straße für den Zeitraum von
Samstag, 05.07.2025, 10.00 Uhr, bis Dienstag,
22.07.2025.
Ab Mittwoch, 23.07.2025,
können die Parkbereiche für Wohnmobile
eingeschränkt wieder genutzt werden. Einige
Marktbeschicker der Materborner Kirmes, die vom
26.07. bis zum 29.07.2025 stattfindet, müssen
ihre Wohnwagen dort noch stehen lassen.
Behindertenparkplätze werden während der
Kirmestage auf der Ludwig-Jahn-Straße, direkt
gegenüber dem Kirmesgelände, eingerichtet. Die
Behindertenparkplätze dürfen nur von Behinderten
mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und
Blinden, die jeweils in Besitz einer gültigen
Ausnahmegenehmigung der Straßenverkehrsbehörde
sind, genutzt werden. Die Ausnahmegenehmigung
(blaue Karte) ist deutlich sichtbar im Fahrzeug
auszulegen.
Taxenplätze werden auf der
Bensdorpstraße direkt am Kirmesgelände
eingerichtet.
Von Samstag, 05.07.2025, bis
Dienstag, 22.07.2025, werden auf der
Ludwig-Jahn-Straße zusätzliche Haltverbote
eingerichtet, um Rettungswege sowie
Transportwege zum Auf- und Abbau der Klever
Kirmes freizuhalten.
Am Sonntag,
20.07.2025, wird nach Einbruch der Dunkelheit
das diesjährige Feuerwerk auf dem Gelände der
Hochschule Rhein-Waal am Spoykanal stattfinden.
Wegen der Auf- und Abbauarbeiten für das
Feuerwerk wird ein Teilbereich des
Hochschulgeländes für den Fahrrad- und
Fußgängerverkehr gesperrt.
Kurz vor dem
Abbrennen des Feuerwerks bis nach Beendigung des
Feuerwerks wird der Leinpfad entlang des
Spoykanals sowie der Bereich des
Hochschulgeländes zwischen Draisinenbahnhof und
Mensa für Fahrzeuge aller Art sowie zu Fuß
gehende gesperrt.
Verkehrsbehindernd
abgestellte Kraftfahrzeuge, insbesondere im
Bereich von Haltverboten und auf
Behindertenparkplätzen, werden kostenpflichtig
abgeschleppt. Im Übrigen werden
Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr
als Ordnungswidrigkeit geahndet. Entsprechende
Kontrollen werden ständig durchgeführt.
„Das NiederrheinRad-Netz im Kreis
Heinsberg stärken“
In seiner neuen,
digitalisierten Form ist das Verleihsystem nun
noch attraktiver für Kommunen und andere
Partner.
„Angesichts der auch bisher bereits
guten Nachfrage nach den NiederrheinRädern bei
uns in Wassenberg, sind wir froh, dass wir jetzt
– mit dem neuen digitalen Buchungssystem sowie
der Angebotserweiterung bei den E-Bikes – den
Wünschen unserer Gäste noch mehr entgegenkommen
können.“ Das sagte Wassenbergs Bürgermeister
Marcel Maurer jetzt bei einem Vor-Ort-Termin am
Naturpark-Tor. Anlass war ein erstes Fazit nach
der Einführung des digitalisierten
NiederrheinRad-Systems am 1. April.
„Allein in den ersten vier Wochen hatten wir
bereits mehr als 300 Nutzungen sowie rund 200
weitere Buchungen am gesamten Niederrhein“,
erklärt Kathrin Peters, von Niederrhein
Tourismus (NT), die das Projekt federführend
begleitet.
Vermietungsverträge und AGBs
in Papierform gehören beim NiederrheinRad der
Vergangenheit an: Die rund 300 Räder im
typischen Grün, zu finden an insgesamt 30
Standorten, wurden mit modernen Schlössern
ausgestattet und können damit nicht nur per App
digital gebucht, sondern auch gleich genutzt
werden. Geradelt werden kann „klassisch“ sowie
mit elektrischer Unterstützung.
Im Kreis
Heinsberg ist die Tourist-Information der Stadt
Wassenberg am Naturpark-Tor bislang die einzige
NiederrheinRad-Station – das könnte sich aber
schon bald ändern. „Es ist beeindruckend, dass
Wassenberg auch hierbei wieder einmal Vorreiter
ist, wenn es um eine zukunftsorientierte
Weiterentwicklung der regionalen
Tourismusinfrastruktur geht“, so Ulrich
Schirowski, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft und damit auch
für Tourismusentwicklung im Kreis Heinsberg
zuständig. „Das ist beispielgebend.“
Er
hoffe, dass jetzt auch weitere Städte und
Gemeinden oder Unternehmenspartner folgen werden
„und das Netz von NiederrheinRad, auch bei uns
im Kreis Heinsberg, stärken“.
Und so
funktioniert das digitalisierte System: Vor
einer Tour wird einfach die App der Plattform
MOQO (über Play Store oder App Store) aufs
Smartphone geladen. Um eine konkrete Buchung zu
starten, suchen die Nutzer über die App nach
verfügbaren NiederrheinRädern zur gewünschten
Zeit am gewünschten Abholort. Steht man dann
direkt neben dem Rad, lässt sich das Schloss per
App öffnen.
Mögliche Zahlungsmethoden
sind Kreditkarte, SEPA-Lastschrift, Klarna,
Apple Pay und Google Pay. Das selbstständige
Buchen erleichtert auch die Arbeit der Teams an
den Stationen (zum Beispiel Hotels und
Tourist-Informationen). Denn der administrative
Aufwand ist für sie deutlich geringer geworden.
Entsprechend positiv fällt das Feedback auch von
dieser Seite aus.
„Es freut uns sehr,
dass die digitalisierte Variante unseres
beliebten Verleihsystems auf so große Zustimmung
stößt“, erklärt NT-Geschäftsführerin Martina
Baumgärtner. „Die Station am Naturpark-Tor in
Wassenberg ist dabei ein besonders wichtiger
Standort – ein zentraler Anlaufpunkt für
Touristen und ein idealer Ausgangspunkt für
Radtouren in die Natur. Wir freuen uns, das
NiederrheinRad weiter im Kreis Heinsberg
auszurollen und die Zahl der Stationen und
verfügbaren Räder unter den verbesserten
Rahmenbedingungen weiter auszubauen.“
www.niederrheinrad.de

Ruckzuck ist das digitalisierte NiederrheinRad
bereit zum Losfahren: Das testeten jetzt
Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer und
Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis
Heinsberg. Beim Termin dabei: (v.l.):
NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner,
Sabrina Martin, Mitarbeiterin im Naturpark-Tor
Wassenberg, und Kathrin Peters (NT). Foto: NT

Erzeugerpreise Mai 2025: -1,2 % gegenüber
Mai 2024 -
(Inlandsabsatz) -0,2 % zum
Vormonat
Die Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte waren im Mai 2025 um 1,2 %
niedriger als im Mai 2024. Im April 2025 hatte
die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei -0,9 % gelegen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im Mai 2025
gegenüber dem Vormonat um 0,2 %.
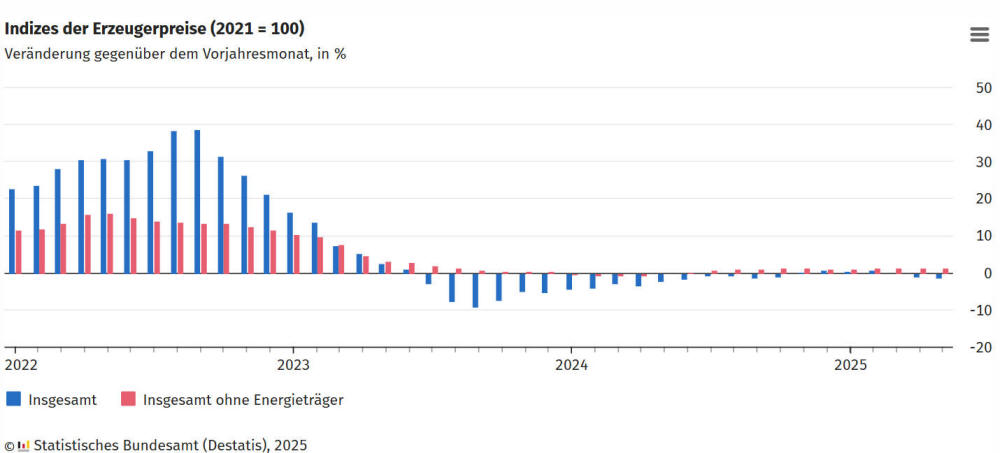
Hauptursächlich für den Rückgang der
Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
waren im Mai 2025 die niedrigeren Energiepreise.
Ebenfalls günstiger als vor einem Jahr waren
Vorleistungsgüter. Verbrauchs- und
Gebrauchsgüter sowie Investitionsgüter waren
dagegen teurer als im Vorjahresmonat. Ohne
Berücksichtigung von Energie stiegen die
Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat
im Mai 2025 um 1,3 %, gegenüber April 2025
blieben sie unverändert.
Rückgang der
Energiepreise gegenüber Vorjahresmonat und
Vormonat
Energie war im Mai 2025 um 6,7 %
billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber April
2025 fielen die Energiepreise um 0,9 %. Den
höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate
gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten
die Preisrückgänge bei elektrischem Strom.
Über alle Abnehmergruppen betrachtet fielen
die Strompreise gegenüber Mai 2024 um 8,1 %
(+0,2 % gegenüber April 2025). Erdgas in der
Verteilung kostete 7,1 % weniger als im Mai 2024
(-1,6 % gegenüber April 2025), Fernwärme kostete
0,5 % weniger als im Vorjahresmonat (-0,1 %
gegenüber April 2025).
Die Preise für
Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber Mai 2024
um 9,6 % (-2,0 % gegenüber April 2025). Leichtes
Heizöl kostete 10,2 % weniger als ein Jahr zuvor
(-0,9 % gegenüber April 2025) und die Preise für
Kraftstoffe waren 6,5 % günstiger (-0,9 %
gegenüber April 2025).
Preisanstiege bei
Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und
Gebrauchsgütern
Die Preise für
Investitionsgüter waren im Mai 2025 um 1,9 %
höher als im Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber
April 2025). Maschinen kosteten 1,9 % mehr als
im Mai 2024 (+0,2 % gegenüber April 2025). Die
Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile
stiegen um 1,3 % gegenüber Mai 2024 (unverändert
gegenüber April 2025).
Verbrauchsgüter
waren im Mai 2025 um 3,6 % teurer als im Mai
2024 (+0,5 % gegenüber April 2025).
Nahrungsmittel kosteten 4,2 % mehr als im Mai
2024 (+0,6 % gegenüber April 2025). Deutlich
teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat war
Kaffee mit +41,2 % (-0,3 % gegenüber April
2025). Ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat
waren Rindfleisch mit +35,7 % (+3,6 % gegenüber
April 2025), Butter mit +21,6 % (-1,4 %
gegenüber April 2025) und pflanzliche Öle mit
+10,3 % (-1,6 % gegenüber April 2025).
Billiger als im Vorjahresmonat waren im Mai 2025
dagegen insbesondere Zucker mit -39,9 % (-3,0 %
gegenüber April 2025) und Schweinefleisch mit
-4,5 % (+3,0 % gegenüber April 2025).
Gebrauchsgüter waren im Mai 2025 um 1,6 % teurer
als ein Jahr zuvor (+0,2 % gegenüber April
2025).
Leichter Preisrückgang bei
Vorleistungsgütern gegenüber Mai 2024
Die
Preise für Vorleistungsgüter waren im Mai 2025
um 0,2 % niedriger als im Vorjahresmonat und
0,2 % niedriger als im Vormonat. Getreidemehl
kostete 3,5 % weniger als im Mai 2024
(unverändert gegenüber April 2025). Chemische
Grundstoffe waren 2,4 % günstiger als im
Vorjahresmonat (-1,1 % gegenüber April 2025).
Die Preise für Metalle sanken gegenüber
dem Vorjahresmonat um 1,3% (-0,3 % gegenüber
April 2025). Roheisen, Stahl und
Ferrolegierungen waren 5,2 % billiger als im Mai
2024 (-0,8 % gegenüber April 2025). Kupfer und
Halbzeug daraus kosteten 5,7 % weniger als im
Mai 2024 (+0,8 % gegenüber April 2025).
Die Preise für Betonstahl lagen dagegen im
Vorjahresvergleich 1,7 % höher (-0,3 % gegenüber
April 2025). Glas und Glaswaren waren 0,9 %
günstiger als im Vorjahresmonat (+0,8 %
gegenüber April 2025), Hohlglas war 6,1 %
billiger als im Mai 2024 (unverändert gegenüber
April 2025).
Preissteigerungen gegenüber
Mai 2024 gab es unter anderem bei Papier, Pappe
und Waren daraus mit +3,2 % (+0,4 % gegenüber
April 2025). Futtermittel für Nutztiere waren
0,8 % teurer als ein Jahr zuvor (-1,0 %
gegenüber April 2025). Holz sowie Holz- und
Korkwaren kosteten 5,0 % mehr als im Mai 2024
(+0,4 % gegenüber April 2025). Nadelschnittholz
war 13,0 % teurer als im Mai 2024 (+1,4 %
gegenüber April 2025). Dagegen war
Laubschnittholz 2,4 % günstiger als im
Vorjahresmonat (+0,2 % gegenüber April 2025).
Erzeugerpreise für Dienstleistungen im
1. Quartal 2025: +2,8 % zum Vorjahresquartal
Kostensteigerungen führen zu höheren Preisen in
vielen Dienstleistungsbereichen Erzeugerpreise
für Dienstleistungen, 1. Quartal 2025 +2,8 % zum
Vorjahresquartal +0,9 % zum Vorquartal WIESBADEN
– Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in
Deutschland lagen im 1. Quartal 2025 um 2,8 %
höher als im 1. Quartal 2024. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
stiegen die Preise gegenüber dem 4. Quartal 2024
um 0,9 %. In vielen Dienstleistungsbereichen
sind die höheren Preise auf Kostensteigerungen
für Personal, Material und Energie
zurückzuführen.
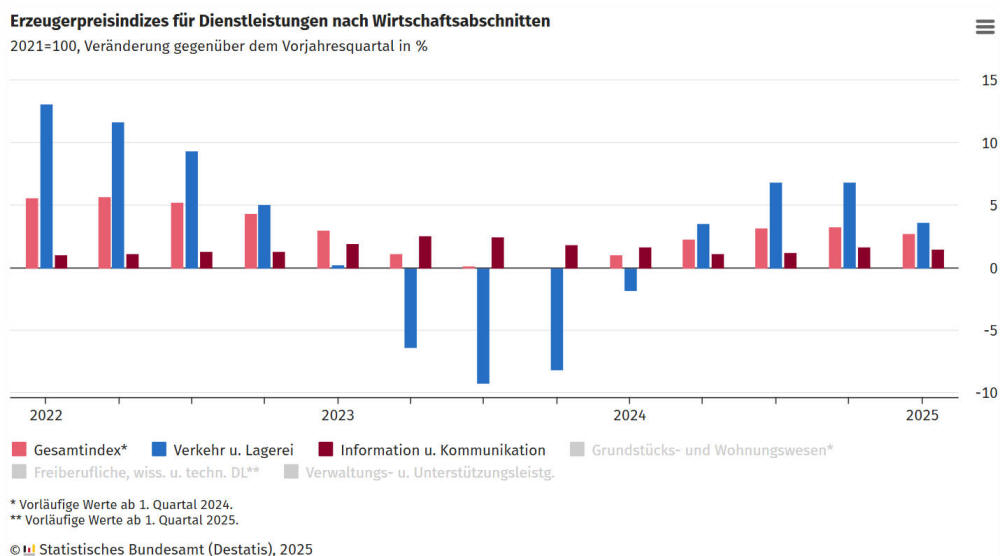
Wirtschaftsabschnitt Verkehr und
Lagerei: +3,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal
Mit +3,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal sind
die Preise im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und
Lagerei deutlich gestiegen. Die
Preissteigerungen betreffen fast alle
Verkehrsdienstleistungen.
So haben die
gestiegenen Energiekosten aufgrund des Anstiegs
der CO2-Abgabe und höhere Löhne unter anderem
infolge des Fachkräftemangels zu höheren Preisen
im Straßengüterverkehr (+2,4 % gegenüber dem
Vorjahresquartal), für Speditionsleistungen
(+2,9 %), für Lagerung und lagereiverwandte
Dienstleistungen (+2,8 %) sowie für Post-,
Kurier- und Expressdienste (+4,6 %) geführt. Die
Preise für Güterbeförderung in der See- und
Küstenschifffahrt gingen hingegen mit -1,3 % im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurück.
Hauptgrund dafür ist der Preisrückgang
auf den Strecken nach Asien. Dies dürfte mit der
gesunkenen Nachfrage nach Transportkapazitäten
infolge des Rückgangs der chinesischen Importe
zusammenhängen. Wirtschaftsabschnitt Information
und Kommunikation: +1,5 % gegenüber dem
Vorjahresquartal Im Wirtschaftsabschnitt
Information und Kommunikation gab es mit +1,5 %
einen moderaten Preisanstieg gegenüber dem
Vorjahresquartal.
Die deutlichsten
Preisanstiege gegenüber dem Vorjahreszeitraum
wurden für IT-Dienstleistungen gemessen. So
verteuerten sich Software und Softwarelizenzen
um 2,8 % gegenüber dem 1. Quartal 2024,
IT-Beratung und Support wurden um 2,4 % teurer
und im Bereich Datenverarbeitungs- und
Hostingdienstleistungen stiegen die Preise mit
+1,8 % ebenfalls.
Die Hauptursache
hierfür waren wie schon im Vorjahr die
gestiegenen Löhne als Reaktion auf den
Fachkräftemangel in der IT-Branche insgesamt.
Demgegenüber fielen die Preise für drahtlose
Telekommunikation um 1,1 %.
Die Preise
für leitungsgebundene Telekommunikation erhöhten
sich mit +0,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal
nur leicht. Wirtschaftsabschnitt Grundstücks-
und Wohnungswesen: +2,3 % gegenüber dem
Vorjahresquartal Im Wirtschaftsabschnitt
Grundstücks- und Wohnungswesen stiegen die
Preise um 2,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die Entwicklung der Mieten für Wohn- und
Gewerbeimmobilien lag mit +1,9 % gegenüber dem
Vorjahresquartal noch leicht unter dem
allgemeinen Trend der Erzeugerpreise für
Dienstleistungen. Am stärksten stiegen mit
+2,4 % die Wohnungsmieten von gewerblichen
Vermietern, die häufig an die Entwicklung des
Verbraucherpreisindex gekoppelt sind.
Deutlich stärker war mit +4,0 % gegenüber dem 1.
Quartal 2024 der Anstieg der Preise für
Vermittlung und Verwaltung von Immobilien. Als
Gründe wurden die allgemein gestiegenen Kosten,
aber auch vertraglich vereinbarte Erhöhungen
unter anderem durch Kopplung der Vergütung an
die Entwicklung spezieller Preisindizes genannt.
Preise für freiberufliche, wissenschaftliche und
technische Dienstleistungen: +2,3 % gegenüber
dem Vorjahresquartal Auch im
Wirtschaftsabschnitt freiberufliche,
wissenschaftliche und technische
Dienstleistungen gab es mit +2,3 % erneut einen
deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem
Vorjahresquartal.
In zahlreichen
Branchen dieses Wirtschaftsabschnitts wurden
noch stärkere Anstiege der Erzeugerpreise
gemessen. So lagen die Preise für technische,
physikalische und chemische Untersuchungen um
4,5 % über denen des Vorjahresquartals, die
Preise für Rechtsberatungsleistungen stiegen um
3,4 %, Dienstleistungen des Rechnungswesens
waren um 2,5 % teurer und Leistungen von
Ingenieurbüros und technische
Beratungsleistungen um 2,3 %.
In allen
diesen Branchen nennen die Anbieter gestiegene
Kosten insbesondere für Personal infolge des
Fachkräftemangels als Grund für die
Preissteigerungen. Wirtschaftsabschnitt
Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen:
+3,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal Mit +3,8 %
sind die Preise für Verwaltungs- und
Unterstützungsleistungen im Vergleich zum
Vorjahresquartal am stärksten gestiegen.
Als Grund für die Teuerung von
Reinigungsleistungen, die mit +3,8 % gegenüber
dem 1. Quartal 2024 dem allgemeinen Trend
folgen, wird meistens die Anpassung des
Tarifvertrags zum 1. Januar 2025 genannt.
Überdurchschnittlich stark sind mit +5,0 % die
Preise für die befristete Überlassung von
Arbeitskräften gestiegen.
Auch hier
liegen die Ursachen in den allgemein gestiegenen
Kosten für Verwaltung, Weiterbildung etc. und
der hohen Nachfrage nach Fachkräften und den
daraus resultierenden steigenden Lohnforderungen
seitens der Arbeitnehmenden.
Dienstag, 24. Juni 2025
Mehr
Verbraucherschutz bei Kreditverträgen: BMJV
veröffentlicht Gesetzentwurf zur Umsetzung der
Verbraucherkreditrichtlinie Verbraucherinnen und Verbraucher sollen besseren
rechtlichen Schutz erhalten, wenn sie
Kreditgeschäfte tätigen. Auch sogenannte
Buy-now-pay-later-Modelle sollen erstmals in die
verbraucherschützenden Regelungen für
Kreditverträge einbezogen werden. Das sieht ein
Gesetzentwurf vor, den das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz heute
veröffentlicht hat.
Der Gesetzentwurf
soll zugleich den europäischen Binnenmarkt für
Kredite zwischen Unternehmern und
Verbraucherinnen und Verbrauchern fördern. Er
geht zurück auf die Verbraucherkreditrichtlinie
der Europäischen Union, die damit ins deutsche
Recht umgesetzt werden soll.
Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz, Dr. Stefanie Hubig erklärt
dazu: „Heute kaufen, später zahlen‘, das klingt
für viele erstmal praktisch. Doch hinter schnell
abgeschlossenen Kreditverträgen kann sich ein
echtes Risiko verbergen. Schlimmstenfalls führen
solche Verträge in die Schuldenfalle. Deshalb
haben wir auf EU-Ebene beschlossen, den
Verbraucherschutz bei Kreditverträgen zu
stärken.

Foto: Photothek Media Lab / Dominik Butzmann
Diesen Beschluss setze ich nun in
deutsches Recht um. Mir ist wichtig, dass wir
die europäischen Regeln möglichst einfach und
bürokratiearm umsetzen. Unser Ziel ist klar:
Mehr Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher
bei Kreditverträgen – ohne vermeidbaren
bürokratischen Ballast.“
Der am 23. Juni
2025 vorgelegte Entwurf dient der Umsetzung der
überarbeiteten EU-Verbraucherkreditrichtlinie.
Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie ist bis zum
20. November 2025 in nationales Recht umzusetzen
und ab dem 20. November 2026 von den
Mitgliedstaaten anzuwenden.
Die
vorgeschlagenen Änderungen weiten den
Verbraucherschutz erheblich aus. So werden
bislang unregulierte Kreditformen erstmals in
die Regelungen zu Verbraucherkrediten
einbezogen. Fortan fallen beispielsweise
Buy-now-pay-later-Modelle und unentgeltliche
Kredite unter die Regelungen.
„Buy now,
pay later“ bedeutet, dass bei einem Kauf das
Geld erst zu einem späteren Zeitpunkt
(beispielsweise 14 oder 30 Tage nach dem Kauf)
vom Konto abgebucht wird. Es handelt sich dabei
um einen Zahlungsaufschub und damit um einen
Kurzzeitkredit. Außerdem sollen die Vorgaben für
die Kreditwürdigkeitsprüfung verschärft werden,
die verpflichtend vor dem Vertragsabschluss
durchzuführen ist.
Insbesondere erfolgt
eine Angleichung an die Maßstäbe, die bei
Darlehensverträgen für Immobilien gelten. Die
Verbraucherkreditrichtlinie verfolgt einen
Vollharmonisierungsansatz, der es den
EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich nicht erlaubt,
strengere oder weniger strenge
Verbraucherschutzvorschriften vorzusehen. Soweit
Umsetzungsspielraum vorhanden ist, hat BMJV
diesen grundsätzlich für eine möglichst
bürokratiearme Regulierung genutzt, etwa bei dem
Umfang vorvertraglicher Informationspflichten.
Auch bei der Form des Vertragsschlusses
wurde der Spielraum der Richtlinie genutzt,
sodass Allgemein-Verbraucherdarlehen künftig in
Textform statt bislang in Schriftform
abgeschlossen werden können. Der Gesetzentwurf
sieht grundsätzlich keine nationalen
Verschärfungen oder Erweiterungen über die
zwingenden europäischen Vorgaben vor (kein
sogenanntes Goldplating).
Der
Referentenentwurf wurde heute an die Länder und
Verbände versandt und auf der Internetseite des
BMJV veröffentlicht. Die interessierten Kreise
haben nun Gelegenheit, bis zum 18. Juli 2025
Stellung zu nehmen. Die Stellungnahmen werden
auf der Internetseite des BMJV veröffentlicht.
Der Gesetzentwurf sowie weitere Informationen
zum Gesetzentwurf sind
hier abrufbar.
Moers: 1.
Bastelwerkstatt „Ein Kessel Buntes“ für Kinder
ab 4 Jahren
Schmetterlinge, Blumen und andere bunte
Kleinigkeiten können an diesem Nachmittag
gebastelt werden. Eine vorherige Anmeldung ist
erforderlich, für das Material wird ein
Kostenbeitrag von 2 Euro erhoben.
Nähere
Infos und Anmeldung unter Telefon: 0 28 41 /
201-751, unter jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek Moers.
Veranstaltungsdatum 24.06.2025 - 15:00
Uhr - 16:00 Uhr. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Marktsprechstunde gemeinsam mit der
Freiwilligenzentrale Moers
Das Team des Stadtteilbüros Neu_Meerbeck kommt
am Mittwoch, 25. Juni, von 10 bis 12 Uhr
gemeinsam mit der Freiwilligenzentrale Moers der
Grafschafter Diakonie mit einem Infostand auf
den Meerbecker Marktplatz an der Lindenstraße.
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit,
sich über das Thema "rund ums Ehrenamt“ zu
informieren.
Verantwortung übernehmen, Kontakte knüpfen und
Dinge bewegen: Das sind nur drei Gründe, um sich
ehrenamtlich zu engagieren. Interessierte, die
Ideen für Projekte haben oder wissen möchten, wo
ihre Erfahrungen und ihr Wissen gebraucht
werden, sind herzlich eingeladen
vorbeizukommen.
Darüber hinaus können
Bürger und Bürgerinnen mit dem Team des
Stadtteilbüros ins Gespräch kommen und sich über
die verschiedenen Projekte zur Entwicklung von
Meerbeck und Hochstraß informieren.
Rückfragen sind telefonisch beim Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck unter 0 28 41 / 201 - 530 oder per
Mail unter stadtteilbuero.meerbeck@moers.de möglich.
Event details Veranstaltungsdatum 25.06.2025 -
10:00 Uhr - 12:00 Uhr. Veranstaltungsort
Marktplatz Meerbeck, Lindenstraße 1, 47443
Moers.
Quiz
Die drei besten Teams werden mit einem
Verzehr-Gutschein belohnt. Pro Team können
maximal 6 Teilnehmende antreten, die Startgebühr
beträgt 3 Euro pro Person. Anmelden könnt ihr
euch dienstags bis samstags ab 18 Uhr. Entweder
vor Ort bei dem Servicepersonal selbst oder ihr
ruft kurz an (02841 – 169 257 8).
Veranstaltungsdatum 25.06.2025 - 19:30
Uhr - 22:00 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers.
Moers:
Penguin’s Days 2025 - Das besondere Leben der
Hilletje Jans
echtzeit- theater
Das Waisenmädchen Hilletje Jans wird im 18.
Jahrhundert fälschlich als Mörderin beschuldigt.
Nach Jahren im Spinnhaus entschließt sie sich
als Junge verkleidet auf einem Schiff
anzuheuern. Dort wird ihr der verdiente Respekt
zuteil, sie kämpft gegen Piraten und kehrt als
Held(in) in ihre Heimatstadt zurück. Doch dann
wird ihr Geheimnis aufgedeckt.

Mit Papierkostümen und Instrumenten erzählen und
besingen die Spieler und Spielerinnen die
Geschichte von Hilletje Jans und gestalten mit
Ihren Körpern nicht nur Figuren sondern auch
Orte und Gegenstände. Mit direkter, manchmal
derber Sprache und pointiertem Witz entwirft das
Ensemble ein Stück über Gleichberechtigung und
Freiheit.
Alter: ab 9 Jahren
Kartenvorverkauf unter 0 28 41 / 88 34-113 oder info@schlosstheater-moers.de
Tickets: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro
Weitere Infos unter Junges STM, Schlosstheater
Moers Veranstaltungsdatum 24.06.2025 -
09:00 Uhr - 10:00 Uhr. Veranstaltungsort Firma
Geschwister-Scholl-Gesamtschule
Fantastival
mit Melissa Etheridge, BAP und Joris Dinslaken
Die mehrfache Grammy-Gewinnerin Melissa
Etheridge eröffnet am 9. Juli das Fantastival in
Dinlaken. Bis zum 19. Juli stehen zahlreiche
bekannte Künstler auf der Bühne des Burgtheaters
in Dinslaken, darunter Joris, Gregor Meyle sowie
Cordula Stratmann und Michel Adollahi.
Die Konzerte von BAP und Berq und die
traditionelle Sommernacht des Musicals sind
bereits ausgebucht. Organisiert wird das
Fantastival von einer Kultur-Aktiengesellschaft,
die von Dinslakener Bürgern gegründet wurde.
idr. Infos:
http://www.fantastival.de
Moers: Berührendes Wiedersehen nach zehn Jahren
Anlässlich des Moers Festivals 2025 hatte
Bürgermeister Christoph Fleischhauer im Rahmen
des Projektes Moersify erneut zu einem Konzert
in sein Büro eingeladen. Er hatte dabei
gegenüber dem künstlerischen Leiter Tim Isfort
den Wunsch geäußert, ob der Saxophonist Hayden
Chisholm erneut sein Gast sein könnte.
Und es klappte: „Das Wiedersehen in meinem Büro
nach zehn Jahren war für uns beide ein sehr
bewegender Moment. Ein Treffen von Freunden, die
sich lange nicht gesehen hatten“, schilderte
Fleischhauer. Chisholm war ebenfalls begeistert:
„Ich freue mich sehr, wieder in Moers zu sein
und heute hier bei Christoph spielen zu
dürfen.“
Bevor das Konzert begann, bat
der neuseeländischer Musiker die rund 50 der
Gäste aus dem Büro des Stadtoberhaupts in das
Foyer des Rathauses. „Klar gehen wir ins Foyer,
der Klang dort ist einzigartig“, erinnerte sich
Chisholm an seine beiden Bürgerkonzerte im Jahr
2015 als er Improviser in Residence in Moers
war. Altsaxophon, Shrutibox, weitere
Blasinstrumente aus der Heimat des Musikers und
sein perfekter Kopfstimmengesang nutzte er zu
Werkzeugen seiner feinsinnigen Improvisationen,
die nicht nur für stehenden Beifall und eine
Zugabe sorgten.
„Dieses Konzert war mehr
als improvisierte Musik. Es war ein musikalisch
einmaliges Erlebnis und Geschenk für alle
Zuhörer und die Stadt“, resümierte treffend ein
Gast.
Moers und
Tummelferien: Pässe verschickt – Rückmeldung bei
fehlender Zustellung
Die Pässe für die ‚Tummelferien‘ sind
verschickt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im
Anmeldeprozess – speziell bei Zahlung über
PayPal - konnten nahezu alle offenen Fragen
geklärt werden. Sollte trotz bestätigter
PayPal-Zahlung kein Tummelferien-Pass angekommen
sein, bittet das Kinder- und Jugendbüro um
Rückmeldung. Telefon: 0 28 41 / 201-949,
E-Mail: tummelferien-innenstadt@moers.de
Moerser Musikschule lädt am 29. Juni
zum Liederabend ein
Zu einem
weiteren Konzert von Dozentinnen und Dozenten
lädt die Moerser Musikschule am Sonntag, 29.
Juni, ein. Es findet um 18 Uhr im
Kammermusiksaal des Martinstifts (Filder Straße
126) statt. Unter dem vielversprechenden Titel
‚Mein Liebeslied muss ein Walzer sein‘
interpretiert die Sopranistin Clarissa Lang
zusammen mit Bongju Lee am Klavier Arien aus
zahlreichen Operetten.
Zu hören sind
unter anderem Werke von Franz Lehár, Johann
Strauß und Paul Lincke. Der Abend bietet sicher
nicht nur Operettenliebhaberinnen und -liebhaber
ein reizvolles Programm. Der Eintritt zu dem
musikalischen Sommerabend ist frei.
Moers: Verschiedene Stadtführungen Ende
Juni erleben
Den ‚Geheimnisvollen
Schlosspark‘ beleuchtet eine Führung am Sonntag,
29. Juni, um 10.30 Uhr. Start ist vor dem
Haupteingang des Moerser Schlosses (Kastell 9).
Der Buchautor und Gästeführer Dr. Wilfried
Scholten berichtet aus unveröffentlichten
Quellen Wissenswertes und Kurioses, Amüsantes
und Verbotenes über Schlosspark, Wall und
Graben.

Foto: pst
Im geschichtlichen Rückblick
geht es um riskante Kaufverträge, umstrittene
Baumaßnahmen, erfolgreiche und gescheiterte
Projekte, ungewöhnliche Nutzungskonzepte sowie
überraschende Ver- und Gebote. Die Teilnahme
kostet pro Person 8 Euro.
Altstadt ist
von Wasser umgeben
Bei der Führung mit dem
Fahrrad ‚Moers und sein Wasser‘ am Sonntag, 29.
Juni, um 11 Uhr dreht sich alles um das nasse
Element. Die Tour mit Gästeführerin Anne-Rose
Fusenig startet vor dem Verwaltungsgebäude des
Kreises Wesel, Mühlenstraße 9 – 11. Sie ist rund
zwölf Kilometer lang.
Die Altstadt Moers
ist von Wasser umgeben. Doch wo kommt es her und
wo gibt es Erholung und Freizeit am Wasser? Ein
besonderes Ziel während der Radtour ist das
Schloss Lauersfort. Die einstige Wasserburg ist
noch immer von einem Graben umgeben. Die
Teilnahme kostet pro Person 10 Euro.
Verbindliche Anmeldungen zu
den Führungen sind in der Stadt- und
Touristinformation von Moers Marketing möglich:
Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 60.
Moers: Bauausschuss berät über
Terheydenhaus für Theaterbau
Der An- und Umbau des ‚Weißen Haus‘ zum Theater
ist Thema Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und
Liegenschaften am Montag, 30. Juni. Die Sitzung
findet um 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses,
Rathausplatz 1, statt.
Die Verwaltung
schlägt für das mit Landes- und Bundesmitteln
stark geförderte Bauprojekt vor, auch das
Terheydenhaus hinzuzunehmen. Weitere Themen sind
unter anderem die eigenverantwortliche
Durchführung Klimaschutzprojektes der Stadt und
der Bebauungsplan rund um das Gelände des
ehemaligen Finanzamtes. Die Sitzung ist
öffentlich.
Moers: Noch bis 7.
Juli Unterlagen für Kandidatur zum
Integrationsrat einreichen
Noch bis 7. Juli können Kandidatinnen und
Kandidaten ihre Unterlagen für die Wahl in den
Integrationsrat einreichen. Grundsätzlich
wählbar sind alle Personen, die zur
Integrationsratswahl berechtigt sind.
Ebenfalls dürfen sich alle Bürgerinnen und
Bürger der Stadt, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, sich seit mindestens einem Jahr
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und seit
mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in
Moers haben, zur Wahl aufstellen lassen.
Die eigentliche Integrationsratswahl findet
parallel zu den Kommunalwahlen am Sonntag, 14.
September, statt. Ziel des Gremiums ist es unter
anderem, politische Mitsprache von Menschen mit
internationaler Familiengeschichte zu
ermöglichen, Maßnahmen gegen Rassismus zu
entwickeln und ein gutes Miteinander in der
Stadt zu schaffen.
Informationen über
die Arbeit des Integrationsrates sind bei der
Geschäftsführung erhältlich: Diana Schmitz,
Telefon 0 28 41 / 201-226, E-Mail: diana.schmitz@moers.de.
Weitere Informationen zu den Formalitäten der
Kandidatur gibt es bei der Fachgruppe Wahlen,
Telefon 0 24 81 / 201-948 oder E-Mail an wahlen@moers.de.
„Du bist einmalig!“ – Kopfkino-Vorlesen
in der Stadtbücherei Kleve am 28. Juni 2025
Am Samstag, 28. Juni 2025, findet ab 10:30 Uhr
das nächste „Kopfkino“ in der Stadtbücherei
Kleve, Wasserstraße 30-32, statt. “Du bist
einmalig! “ lautet das Motto der Geschichten,
die an diesem Tag vorgelesen werden. Die
gleichnamige Erzählung von Max Lucado, gelesen
von Jeroen Blok, macht den Anfang. In dieser
herzerwärmenden Story hilft der Holzschnitzer
Eli Punchinello einer Wemmick-Holzpuppe dabei zu
erkennen, wie einmalig sie ist – ganz egal, was
die anderen Wemmicks von ihr denken.

Karin Brock wird mit Nelli de Jong die
Geschichte „Der Bücherfresser“ vorlesen. Ein
fantastisches Bilderbuch von Erfolgsautorin
Cornelia Funke über die besondere Magie von
Geschichten, bei dem garantiert jedes Kind seine
Liebe zu Büchern entdeckt. Frieda Schlüter und
sechs Kinder der Johanna-Sebus Grundschule
werden außerdem eine Episode aus „Ella und ihre
Freunde außer Rand und Band“ von Timo Parvela
vortragen. Der Eintritt zum Kopfkino ist
selbstverständlich frei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Neue Studie untersucht
„Realexperimente“ - IMK: Kein empirischer Beleg
dafür, dass weniger Feiertage das Wachstum
stärken
In der Empirie gibt es keine
Belege dafür, dass die Abschaffung von
Feiertagen die Wirtschaftsleistung erhöht. Das
zeigt die Analyse von konkreten Fällen, in denen
in Deutschland beziehungsweise in einzelnen
Bundesländern in den vergangenen 30 Jahren
arbeitsfreie Feiertage gestrichen oder neu
eingeführt wurden. In gut der Hälfte der Fälle
entwickelte sich die Wirtschaft sogar danach in
jenen Bundesländern besser, in denen
arbeitsfreie Feiertage beibehalten wurden oder
neu hinzukamen.
Das ergibt eine neue
Kurzstudie des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.* „Die Gleichung: Wenn
Feiertage wegfallen, steigt das Wachstum, geht
offensichtlich nicht auf. Denn sie ist zu simpel
und wird einer modernen Arbeitsgesellschaft
nicht gerecht – so wie viele aktuelle Ideen zur
Arbeitszeitverlängerung“, sagt Prof. Dr.
Sebastian Dullien,wissenschaftlicher Direktor
des IMK und Ko-Autor der Untersuchung. „Die
Forderung nach einem solchen Schritt zur
Wachstumsförderung ist deshalb nicht
zielführend.“
Üblicherweise wird die
These einer positiven wirtschaftlichen Wirkung
gestrichener Feiertage damit begründet, dass in
Monaten mit besonders vielen Feiertagen (oder
wenig Arbeitstagen, wie durch die regelmäßig
kurze Monatslänge im Februar) weniger produziert
wird als in anderen Monaten. So kalkuliert etwa
das arbeitgebernahe Institut der Deutschen
Wirtschaft mit einer vermeintlichen zusätzlichen
Wirtschaftsleistung von 5 bis 8,6 Milliarden
Euro pro gestrichenem Feiertag, oder etwa 0,2
Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Betrachtet man allerdings reale Fälle, in denen
die Zahl der Feiertage verändert wurde, sieht
das Bild anders aus. Das IMK betrachtet sechs
solcher „Realexperimente“ seit 1990. Dabei
wurden in manchen Bundesländern gesetzliche
Feiertage gestrichen oder neu eingeführt, in
anderen nicht. Hier kann man im Jahr der
Einführung oder Streichung die
Wirtschaftsleistung dieser Länder mit jener der
Bundesrepublik insgesamt und ähnlich
strukturierten (benachbarten) Bundesländern
vergleichen.
Dullien und die
IMK-Forscher*innen Dr. Ulrike Stein und Prof. Dr
Alexander Herzog-Stein betrachten in ihrer
Studie: Erstens die Abschaffung des Buß- und
Bettages in allen Bundesländern außer Sachsen ab
dem Jahr 1995, zweitens die einmalige Ausdehnung
des Reformationstages auf alle Bundesländer
2017, drittens den erneuten Wegfall des
arbeitsfreien Reformationstages in vielen
Bundesländern im Folgejahr, viertens die
Einführung des Internationalen Frauentages als
gesetzlicher Feiertag in Berlin 2019, fünftens
die Einführung des Weltkindertages in Thüringen
im selben Jahr und sechstens die Einführung des
Internationalen Frauentags als gesetzlicher
Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern 2023. Basis
für die Analyse sind die Daten des Statistischen
Bundesamts zum jährlichen nominalen
Bruttoinlandsprodukt auf Ebene der Bundesländer.
Würde die einfache Gleichung aufgehen:
„Weniger Feiertage = Mehr Wirtschaftsleistung“,
dann müsste man 1995 ein niedrigeres Wachstum
des Bruttoinlandsprodukts in Sachsen als in
anderen Bundesländern sehen, ebenso in Berlin
und Thüringen 2019 und in Mecklenburg-Vorpommern
2023.
2017 müsste das Bruttoinlandsprodukt
in jenen Bundesländern, die den Reformationstag
erstmals als gesetzlichen Feiertag begingen,
langsamer gewachsen sein als im Rest der
Republik, 2018 dann in jenen Ländern stärker, in
denen der Reformationstag nicht mehr
gesetzlicher Feiertag war.
Sachsen 1995:
Beibehaltung des Buß- und Bettages
Tatsächlich hat sich das Bruttoinlandsprodukt
1995 in Sachsen aber stärker entwickelt als im
Rest Deutschlands. Nominal wuchs die
Wirtschaftsleistung im Bundesschnitt um 3,4
Prozent, im ostdeutschen Freistaat dagegen um
9,7 Prozent. Dabei stellen die Forschenden
natürlich in Rechnung, dass Mitte der 1990er
Jahren noch der wirtschaftliche Aufholprozess in
Ostdeutschland lief. Es ist also plausibel, dass
Sachsens Wirtschaft deutlich schneller wuchs als
jene Gesamtdeutschlands.
Ein Vergleich
mit den angrenzenden ostdeutschen Bundesländern
Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt allerdings:
Auch ihnen gegenüber legte das nominale BIP in
Sachsen 1995 erheblich stärker zu, obwohl die
beiden anderen Bundesländer den Buß- und Bettag
als Feiertag strichen. Der Vorsprung lag bei 3,7
Prozentpunkten gegenüber Sachsen-Anhalt und 4,3
Prozentpunkten gegenüber Thüringen (siehe auch
Abbildung 1).
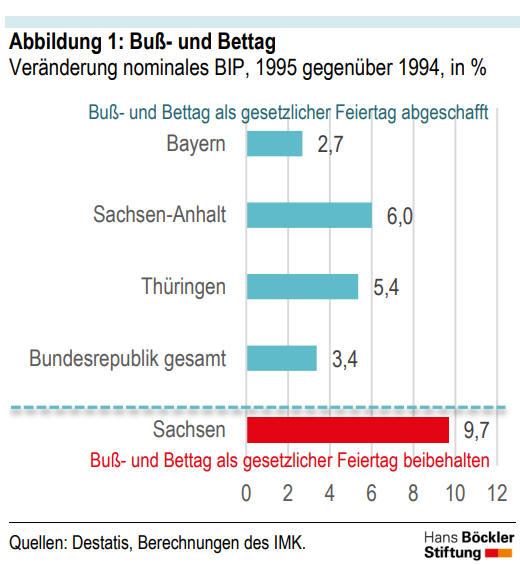
Reformationstag 2017 und 2018
2017 wurde
anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation
in allen Bundesländern der 31. Oktober als
gesetzlicher Feiertag begangen. In den
ostdeutschen Bundesländern, in denen der
Feiertag schon zuvor gesetzlich verankert war,
fiel das nominale Wachstum in diesem Jahr
tatsächlich minimal um 0,2 Prozentpunkte stärker
aus als in jenen Ländern, in denen der
Reformationstag einmalig arbeitsfrei war
(Abbildung 2 in der Studie).
Allerdings
zeigte der Wegfall des Feiertages im Folgejahr
in den betroffenen Bundesländern wiederum keinen
positiven Effekt. 2018 war der 31. Oktober in
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland wieder normaler Arbeitstag.
Vergleicht man das Wirtschaftswachstum in diesen
Bundesländern mit jenen westdeutschen
Bundesländern, die den Reformationstag 2017 als
gesetzlichen Feiertag eingeführt haben und 2018
beibehielten, so hatten die Bundesländer mit
Wegfall des Feiertages sogar ein minimal um 0,2
Prozentpunkte schwächeres Wirtschaftswachstum
als jene, die den Feiertag dauerhaft
beibehielten (Bremen, Niedersachsen, Hamburg,
Schleswig-Holstein; Abbildung 3).
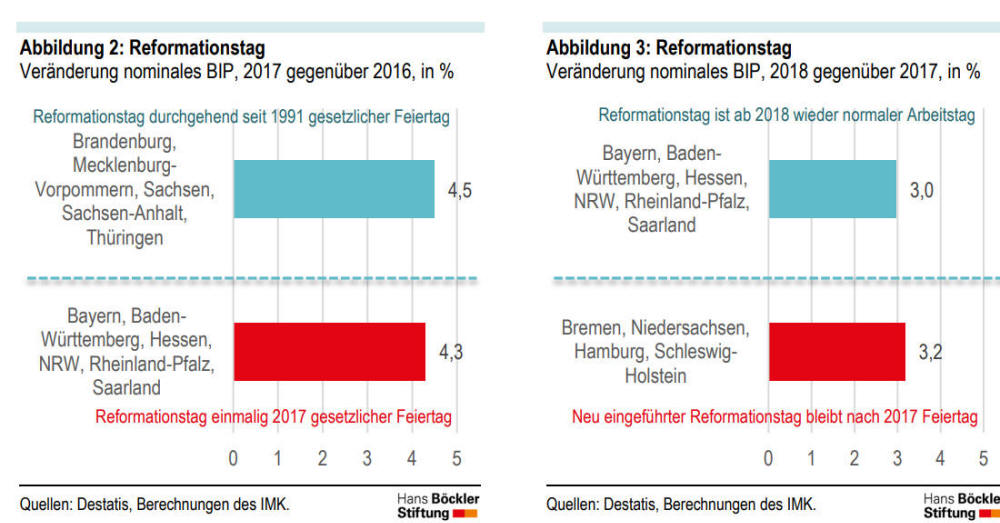
Internationaler Frauentag in Berlin und
Weltkindertag in Thüringen 2019
In Berlin
wurde 2019 der Internationale Frauentag am 8.
März erstmals als gesetzlicher Feiertag
begangen. Die Wirtschaftsleistung in der
Bundeshauptstadt entwickelte sich in dem Jahr
besser als im Bundesdurchschnitt: Der Vorsprung
beim Wachstum des nominalen BIPs lag bei 2,0
Prozentpunkten. Auch im Vergleich zu den anderen
beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie dem
umliegenden Brandenburg wuchs das BIP in Berlin
stärker, nicht schwächer.
In Thüringen
wurde ebenfalls 2019 der Weltkindertag am 20.
September als gesetzlicher Feiertag eingeführt.
Hier fiel das Wachstum um 0,4 Prozentpunkte
niedriger aus als im Bundesdurchschnitt
(Abbildung 4).
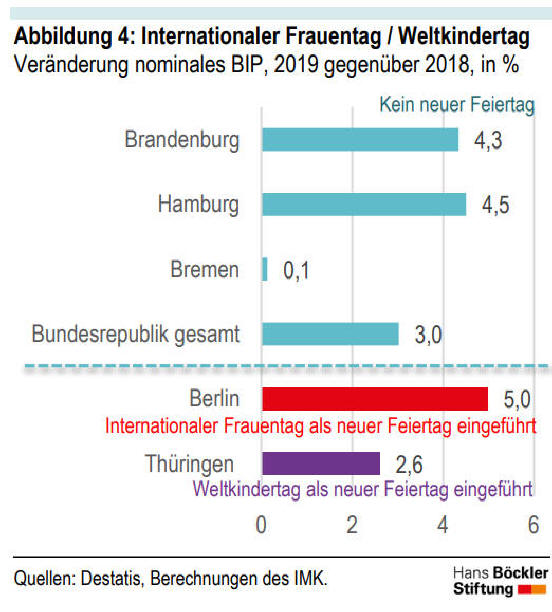
Internationaler Frauentag in
Mecklenburg-Vorpommern 2023
In
Mecklenburg-Vorpommern wurde der Internationale
Frauentag 2023 gesetzlicher Feiertag. Dort fiel
das Wachstum höher aus als in der Bundesrepublik
insgesamt und im angrenzenden Bundesland
Schleswig-Holstein, allerdings niedriger als in
Brandenburg und Niedersachsen (Abbildung 5). Zu
beachten ist hier laut IMK jedoch, dass es
sowohl für Niedersachsen als auch für
Mecklenburg-Vorpommern 2023 Sonderfaktoren gab:
In Stade wurde in dem Jahr ein LNG-Terminal
fertiggebaut und in Betrieb genommen.
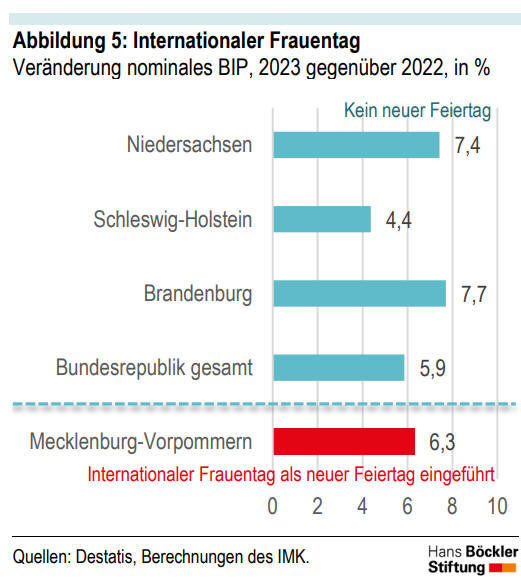
Mecklenburg-Vorpommern war zum einen
besonders negativ von der Unterbrechung der
russischen Gaslieferungen durch die
Nordstream-Pipelines betroffen, gleichzeitig
liefen die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme
eines LNG-Terminals in Mukran 2024, die das BIP
erhöht haben dürften. Von daher sei fraglich,
wie aussagekräftig letztlich dieses Beispiel
ist.
Schaden weniger Feiertage der
Produktivität?
Dass ein Feiertag weniger
keinen klaren positiven Einfluss auf die
Wirtschaftsleistung hat, erklären die
Forschenden des IMK einerseits mit der
Flexibilität einer modernen Volkswirtschaft:
Unternehmen planen die Abarbeitung ihrer
Aufträge so, dass diese möglichst nicht an
Feiertagen stattfindet, auch, weil dann
Zuschläge gezahlt werden. Unklar ist, ob ohne
diese Feiertage tatsächlich über das Jahr mehr
produziert würde – wie es die Befürworter*innen
von Streichungen annehmen –, oder ob die
Produktion nur anders verteilt würde.
Viel spricht aber laut IMK dafür, dass – auch in
Zeiten vielerorts beklagten Fachkräftemangels –
die Nachfragesituation der Unternehmen der
bestimmende und begrenzende Faktor für die
Produktion ist. So gaben in den jüngsten
Umfragen des Ifo-Instituts 36,8 Prozent der
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes an,
mangelnde Aufträge seien ein Hindernis für die
Produktion, während nur 17,5 Prozent sagten,
Personalmangel behindere die Produktion.
Hinzu kommt, dass die gesamtwirtschaftliche
Produktion nicht nur auf die geleistete Zahl der
Arbeitsstunden zurückgeht, sondern auch
Produktivität und Innovation eine wichtige Rolle
spielen. „Denkbar ist, dass die Beobachtung
fehlender positiver Wachstumseffekte einer
geringeren Zahl an Feiertagen darauf zurückgeht,
dass die geringere Erholungszeit die
Produktivität senkt“, schreiben Dullien, Stein
und Herzog-Stein.
Möglich sei auch der
Effekt, dass Erwerbstätige, die sich durch ihre
Arbeit und andere Verpflichtungen in Familie
oder Haushalt stark belastet fühlen, zumindest
mittel- und langfristig als Reaktion auf die
Streichung des Feiertages ihr Arbeitsangebot an
anderer Stelle zurückfahren, etwa durch die
Verringerung der Arbeitszeit in Teilzeitstellen
oder die Aufgabe eines zusätzlichen Minijobs. So
gibt es Hinweise, dass während der
Covid-Pandemie Pflegekräfte als Reaktion auf die
hohe Belastung ihre Arbeitszeit verringert
haben.

Bundestagswahl 2025: Ergebnisse der
repräsentativen Wahlstatistik
WIESBADEN, 23. Juni 2025 - Bei der Wahl zum 21.
Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 gaben
82,5 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.
Damit lag die Wahlbeteiligung gegenüber der
Bundestagswahl 2021 um 6,2 Prozentpunkte höher
und damit so hoch wie seit der Bundestagswahl
1987 nicht mehr. Detailliertere Ergebnisse
liefert die repräsentative Wahlstatistik des
Statistischen Bundesamtes (Destatis), die in
Deutschland bei Bundestags- und Europawahlen
durchgeführt wird.
Mit ihr lässt sich das
Wahlverhalten, das heißt die Wahlbeteiligung und
die Stimmabgabe, nach Geschlecht und
Geburtsjahresgruppe analysieren. Für die
repräsentative Wahlstatistik zur Bundestagswahl
2025 wurden 1.790 Urnen- und
899 Briefwahlbezirke ausgewertet. Damit waren
rund 1,9 Millionen Wahlberechtigte und rund
1,6 Millionen Wählerinnen und Wähler in der
Stichprobe.
Wahlbeteiligung von Jüngeren
stärker gestiegen als von Älteren Vor allem
Wählerinnen und Wähler in den Altersgruppen bis
44 Jahren beteiligten sich an der Bundestagswahl
2025 deutlich stärker: Ihre Wahlbeteiligung
stieg gegenüber 2021 zwischen 7,1 und
8,3 Prozentpunkten.
Trotz der
gestiegenen Wahlbeteiligung von Jüngeren lag die
Wahlbeteiligung der bis 34-Jährigen unter allen
Wahlberechtigten unter dem Durchschnitt. Am
geringsten war sie in der Altersgruppe 21 bis 24
Jahre mit 78,3 % ausgeprägt. In den
Altersgruppen ab 35 bis 69 Jahren fiel die
Wahlbeteiligung überdurchschnittlich aus, am
höchsten bei den 50- bis 69-Jährigen mit 85,5 %.
In der ältesten Altersgruppe
„70 Jahre und mehr“ verfestigt sich hingegen ein
Trend seit der Bundestagswahl 2017: Ihre
Wahlbeteiligung sank weiter unter den
Durchschnitt und lag jetzt bei 79,3 %. Mit
Ausnahme der ältesten Altersgruppe „70 Jahre und
mehr“ beteiligten sich Frauen häufiger an der
Wahl als die gleichaltrigen Männer.
Die
Unterschiede sind in den jüngeren Altersgruppen
größer. In der Altersgruppe ab 70 Jahren betrug
die Wahlbeteiligung der Männer 82,6 % und
entsprach damit nahezu dem Bundesdurchschnitt.
Frauen in dieser Altersgruppe wählten bei einer
Wahlbeteiligung mit 76,8 % vergleichsweise
selten.
Einfluss der Generation 60plus
auf das Wahlergebnis nimmt weiter zu
Die
Zahlen der Wahlberechtigten in der mittleren
Generation zwischen 30 und 59 Jahren sowie in
der älteren Generation ab 60 Jahren liegen
inzwischen demografiebedingt nahe beieinander.
Während die mittlere Generation unter allen
Wahlberechtigten 44,4 % ausmachte, lag der
Anteil der älteren Generation bei 42,6 %.
Bei der Bundestagswahl 2017 lagen die
Anteile noch bei 48,9 % für die mittlere
Generation und 36,3 % für die ältere Generation,
bei der Bundestagswahl 2021 bei 47,0 % bzw.
38,8 %. Zusammen mit ihrer Wahlbeteiligung hat
dadurch der Einfluss der „60plus“-Generation
noch mehr Einfluss auf das Wahlergebnis
genommen.
Keine Partei war in allen
erhobenen Gruppen stärkste Kraft
Bezogen auf
die Zweitstimmenanteile war keine Partei
durchweg über alle Altersgruppen stärkste Kraft.
Bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern bis
24 Jahre dominierten Die Linke (27,3 % aller
gültigen Zweitstimmen), in den darauffolgenden
Altersgruppen von 25 bis 34 sowie 35 bis
44 Jahren jeweils die AfD (20,8 % bzw. 27,1 %)
und in den übrigen Altersgruppen ab 45 Jahren
die Unionsparteien CDU und CSU (45 bis 59 Jahre:
28,7 %, 60 bis 69 Jahre: 31,6 % und 70 Jahre und
mehr: 41,4 %).
Die SPD erhielt ihren
stärksten Zuspruch von den ab 70-Jährigen mit
24,9 % (hinter den Unionsparteien). Die GRÜNEN
erzielten mit 15,9 % ihr bestes Ergebnis in der
Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren (hinter AfD
und Die Linke). Nach Geschlecht wurden die SPD
(Differenz Frauen/Männer: 3,0 Prozentpunkte),
GRÜNE (1,9 Prozentpunkte), Die Linke
(2,9 Prozentpunkte) und das BSW
(1,3 Prozentpunkte) anteilig stärker von Frauen
gewählt.
Die Unionsparteien CDU und CSU
(Differenz Männer/Frauen: 0,7 Prozentpunkte),
FDP (1,0 Prozentpunkte) und AfD
(8,5 Prozentpunkte) erhielten hingegen mehr
Zweitstimmen von den Männern. FDP bei jüngeren
Männern über der Fünfprozenthürde, BSW bei
Frauen unter 70 Hätte das Stimmverhalten der 18-
bis 24-jährigen oder 25- bis 34-jährigen Männer
allein gezählt, hätte die FDP die 5-%-Hürde
überwunden (7,5 % bzw. 6,3 %) und somit an der
Sitzverteilung teilgenommen.
Hätten
allein Frauen mit Ausnahme der ältesten
Altersgruppe ab 70 Jahren (zwischen 5,6 %und
6,7 %) oder die Männer zwischen 18 und 34 Jahren
(5,0 % bzw. 5,3 %) entscheiden dürfen, wäre das
BSW erfolgreich in den Bundestag gewählt worden.
Die unterdurchschnittlichen Stimmenanteile der
übrigen Altersgruppen verhinderten deren Einzug.
Briefwahl eher von Älteren und Frauen
genutzt
Bei der Bundestagswahl 2025
beantragten 32,3 % aller Wahlberechtigten einen
Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Mit 36,2 %
lag die Antragsquote der ab 70-Jährigen unter
allen Wahlberechtigten am höchsten, am
geringsten bei den 18- bis 20-Jährigen (23,0 %).
Von den wahlberechtigten Frauen beantragten
34,2 % die Briefwahl, von den wahlberechtigten
Männern 30,3 %.
Bevölkerung Deutschlands wächst im
Jahr 2024 geringfügig um 0,1 %
•
Zum Jahresende 2024 lebten knapp 83,6 Millionen
Menschen in Deutschland
• Erneut mehr
Sterbefälle als Geburten – Bevölkerungswachstum
beruht auf Wanderungsüberschuss
• 30 % der
Bevölkerung mindestens 60 Jahre alt
Zum
Jahresende 2024 lebten knapp 83,6 Millionen
Personen in Deutschland. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist die
Bevölkerung in Deutschland somit im Jahr 2024 um
121 000 Personen beziehungsweise 0,1 %
gewachsen, nachdem sie im Vorjahr noch um 338
000 beziehungsweise 0,4 % zugenommen hatte.
Diese Entwicklung ergibt sich zum einem aus den
Geburten und Sterbefällen, zum anderen aus den
Wanderungsbewegungen.
Der Überschuss der
Sterbefälle über die Geburten war dabei nach
vorläufigen Ergebnissen mit +330 000 ähnlich
hoch wie im Vorjahr. Der vorläufige
Wanderungssaldo, also die Differenz zwischen den
Zu- und Fortzügen über die Grenzen Deutschlands,
ist hingegen von +660 000 auf +420 000
zurückgegangen. Das Bevölkerungswachstum ist
somit auch 2024 auf den Wanderungsüberschuss
zurückzuführen.
Zahl der Menschen
zwischen 60 und 80 Jahren nimmt um 2,2 % zu
Die Entwicklung der Bevölkerung fällt nach
Altersgruppen unterschiedlich aus. So nahm die
Zahl der 60- bis 79-Jährigen um 416 000 (+2,2 %)
zu, während die Zahl der 40- bis 59-Jährigen um
323 000 beziehungsweise 1,4 % abnahm. Diese
entgegengesetzten Entwicklungen können vor allem
darauf zurückgeführt werden, dass der
geburtenstarke Jahrgang 1964 im Jahr 2024 in die
Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen gewechselt
ist.
Die Zahl der Kinder und
Jugendlichen unter 20 Jahre (15,6 Millionen)
sowie die Zahl der jüngeren Erwachsenen zwischen
20 und 39 Jahren (20,3 Millionen) hat sich
dagegen kaum verändert. Neben der Zahl der 60-
bis 79-Jährigen nahm auch die Zahl der Personen
im Alter von 80 Jahren und älter mit +14 000 auf
6,1 Millionen Menschen (+0,2 %) leicht zu.
Insgesamt waren 25,5 Millionen Personen
60 Jahre oder älter, das entpricht 30,5 % der
Bevölkerung in Deutschland. Ausländeranteil
liegt bei 14,8 % Die ausländische Bevölkerung
wuchs 2024 um 283 000 auf 12,4 Millionen
(+2,3 %), während die deutsche Bevölkerung um
162 000 auf 71,2 Millionen zurückging (-0,2 %).
Infolgedessen erhöhte sich der Ausländeranteil
von 14,5 % Ende 2023 auf 14,8 % Ende 2024.
Die Anteile fallen je nach Altersgruppe
jedoch unterschiedlich aus: Am höchsten ist der
Ausländeranteil in der Altersgruppe 20 bis 59
Jahre mit 19,7 %, am niedrigsten bei den ab
60-Jährigen mit 6,3 %. Bei den Kindern und
Jugendlichen unter 20 Jahre liegt der
Ausländeranteil bei 15,4%. Die größte
ausländische Gruppe bilden wie in den
vergangenen Jahren Türkinnen und Türken
(1 403 000), gefolgt von Staatsangehörigen aus
der Ukraine (1 085 000), Syrien (889 000),
Rumänien (771 000) und Polen (723 000).
Zensus 2022: Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mittleren Alters leben immer seltener
in Wohneigentum
* Menschen im Alter
von 24 bis 32 Jahren wohnen besonders häufig zur
Miete
* Ab einem Alter von 49 Jahren leben
die meisten Menschen im Eigentum
* Rückgang
der Eigentumsquoten betrifft vor allem Personen
unter 72 Jahren
Zum Zensusstichtag am
15.05.2022 lebten in NRW 46,8 % der Personen in
Wohneigentum. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, waren es beim Zensus 2011 noch 49,8 %.
Junge Erwachsene zwischen 24 und 32 lebten
besonders häufig in Mietverhältnissen, während
ältere Erwachsene ab 49 sowie Seniorinnen und
Senioren eher in Wohneigentum wohnten.
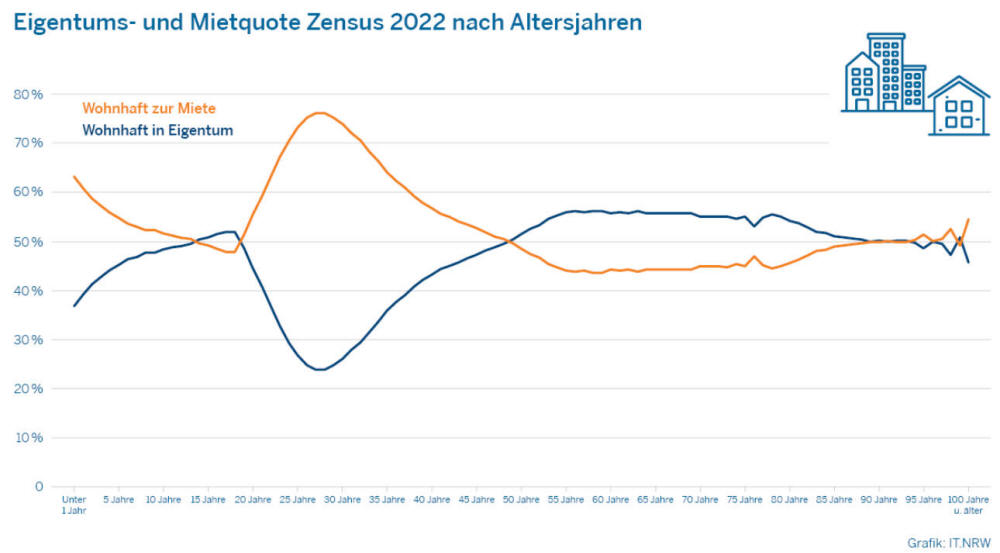
Über alle Altersgruppen betrachtet, lag die
Mietquote im Alter von 27 mit 76,1 % am
höchsten. Die höchste Eigentumsquote, also
Personen, die in Wohneigentum lebten, wiesen die
58- und 59-Jährigen mit 56,2 % auf. Personen
unter 72 Jahren leben 2022 seltener in
Wohneigentum als 2011 – Ältere hingegen häufiger
Ab einem Alter von 49 Jahren lag die
Eigentumsquote für Erwachsene höher als die
Mietquote.
Beim Zensus 2011 war dieser
Wendepunkt bereits bei einem Alter von 41 Jahren
erreicht. Beim detaillierten Vergleich der
Eigentumsquote zwischen dem Zensus 2011 und 2022
ist zu erkennen, dass in fast allen
Altersgruppen unter 72 die Wohneigentumsquote
gesunken ist.
Besonders deutlich wird
dies bei Kindern und Jugendlichen sowie
Erwachsenen mittleren Alters. So lebten 57,2 %
der nordrhein-westfälischen Kinder im Alter von
13 Jahren im Jahr 2011 noch in Haushalten, die
im Eigentum wohnten. 2022 waren es dagegen nur
49,5 %. Das entspricht einem Rückgang von 7,7
Prozentpunkten.
Ähnlich sah es bei
Erwachsenen im Alter von 43 Jahren aus: Sie
wohnten 2011 noch zu 53,2 % im Eigentum, während
2022 nur 45,8 % dieses Alters in den eigenen
vier Wänden lebten (- 7,4
Prozentpunkte). Dagegen hat die Eigentumsquote
im hohen Alter zugenommen: Für Personen im Alter
von über 72 Jahren hat die Eigentumsquote
zwischen 2011 und 2022 zugenommen.
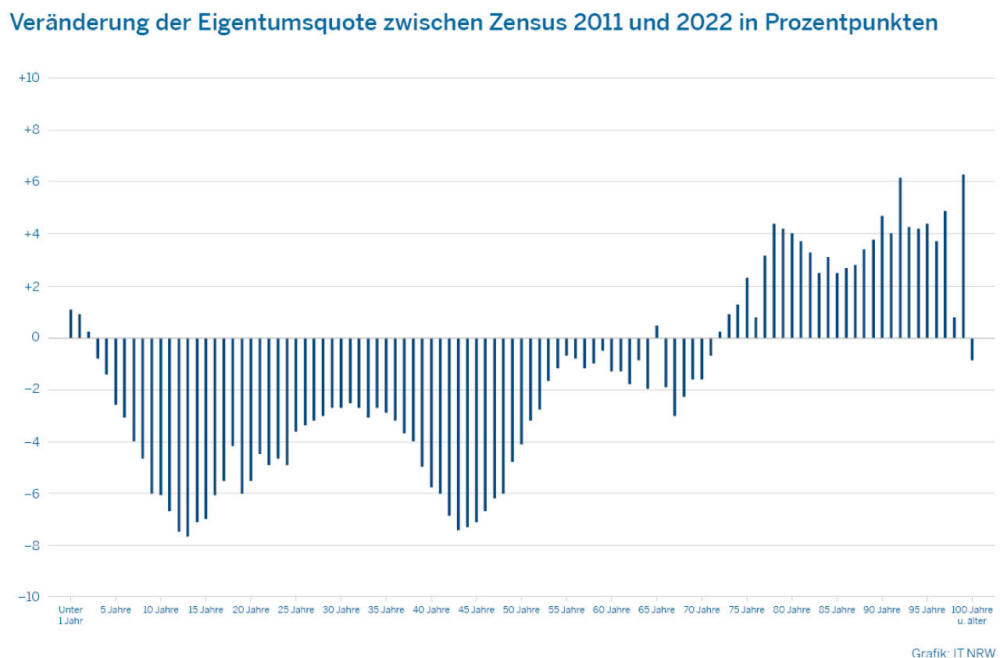
Den größten Anstieg über alle Altersjahre
hinweg gab es im Alter von 99 und 92 Jahren.
Demnach lebten in diesem Alter mit +6,3 bzw.
+6,2 Prozentpunkten mehr Menschen in
Wohneigentum als 2011.
Montag, 23. Juni 2025
Da freuen sich Igel- und Gartenfeunde

Foto Barbara Jeschke
Bei heißen und trockenen
Tagen haben alle Durst. Und auch Igel und Vögel
müssen trinken. Darauf weist auch das
Igel-Notnetz mit einer Wurfsendung in Vororten
mit Gärten eindringlich hin. Im Bild sind wohl
Mutter Igel am Samstagabend in Kapellen mit
Nachwuchs an der Vogeltränke.
Mehr auch unter info@igel-notnetzt.net
Wesel: Förder-Freitag Ruhr:
Internationale Märkte im Blick – mit Förderung
zum Erfolg
Kleine und
mittelständische Unternehmen stehen bei der
Erschließung internationaler Märkte oftmals vor
erheblichen Herausforderungen – insbesondere bei
der Finanzierung ihrer Vorhaben. Um Unternehmen
im Kreis Wesel bei diesem wichtigen Schritt zu
unterstützen, lädt die EntwicklungsAgentur
Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel gemeinsam mit
der NRW.Bank zur nächsten Ausgabe des
„Förder-Freitag Ruhr“ ein.
Die
Online-Veranstaltung findet am Freitag, 27. Juni
2025, von 13:00 bis 13:45 Uhr statt und bietet
einen kompakten Überblick über Förder- und
Unterstützungsprogramme der NRW.Bank in den
verschiedenen Phasen der Internationalisierung –
von der ersten Planung bis zur konkreten
Umsetzung im Ausland. Als Referent wird Dr.
Klaus-Hendrik Mester, Prokurist der NRW.BANK,
praxisnahe Einblicke in die Möglichkeiten der
EU- und Außenwirtschaftsförderung geben.
Teilnehmende erhalten konkrete Hinweise, wie
sie bestehende Förderangebote gezielt für ihre
internationalen Projekte nutzen können. Dr.
Frederik Graff, Leiter des
EAW.Unternehmensservice: „Der Zugang zu
internationalen Märkten ist für viele
Unternehmen im Kreis Wesel ein wichtiger
Wachstumstreiber – doch gerade in der frühen
Planungsphase fehlt es oft an Informationen über
passende Fördermittel und andere
Unterstützungsangebote.
Die
Veranstaltung bietet eine hervorragende
Gelegenheit, sich kompakt und praxisnah über
solche Angebote zu informieren.“
Die
Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung und weitere
Informationen unter
www.kreis-wesel.de/veranstaltungskalender.
Der Förder-Freitag Ruhr (FFR) ist eine
gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderungen
der Städte Bottrop, Essen, Hamm, Gelsenkirchen,
Hagen, Herne, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen
und des Ennepe-Ruhr Kreises, des Kreises Wesel,
des Kreises Recklinghausen und des Kreises Unna.
Ziel des FFR ist es, Unternehmen aus dem
Ruhrgebiet regelmäßig freitags kurz und kompakt
über ausgewählte Förderinstrumente des Landes,
des Bundes, der EU und weiterer
Fördermittelgeber zu informieren.
In
kompakten Webinaren von 45 bis 60 Minuten
erfahren Unternehmen, wie sie von Zuschüssen und
Leistungen profitieren können. Der FFR richtet
sich an alle Unternehmen aus dem Ruhrgebiet und
angrenzender Regionen unabhängig von ihrer
Größe. Er findet ca. alle sechs Wochen statt.
Rheinberg: Konzert der kanadischen Band
„Bywater Call“ am 29. Juni
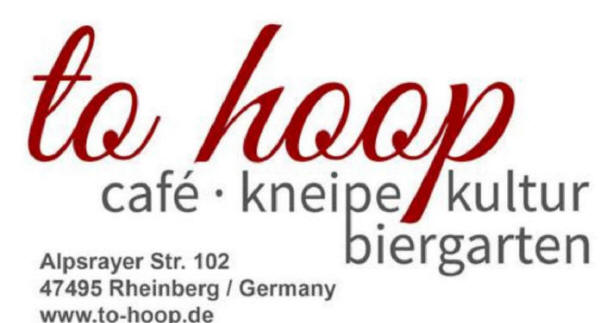
Sonntag, 29.6.25 20h to hoop
Alpsrayer Str. 102 47495 Rheinberg-
Tickets
im „to hoop“, an allen VVK Stellen im Netz unter
www.reservix.de
oder
www.adticket.de oder an der AK. VVK 24.-
zzgl. Geb. / AK: 30.-

Kleve: Theater: Kalter Weißer Mann -
Ersatztermin für 27.06.
Do.,
26.06.2025 - 20:00 - Do., 26.06.2025 - 22:00
Der Tod ist nie schön. Aber es
könnte schlimmer kommen, als mit 94 Jahren
friedlich einzuschlafen: Zum Beispiel eine
Trauerfeier, die völlig aus dem Ruder gerät.
Gernot Steinfels, Patriarch einer Firma des
alten deutschen Mittelstands, ist verstorben,
und sein designierter Nachfolger (60) richtet
für das Unternehmen die Beisetzung aus.
Doch sein Text auf der Schleife sorgt für
heftige Irritation: „In tiefer Trauer. Deine
Mitarbeiter“. Schnell hat der neue „alte weiße
Mann“ an der Spitze nicht nur seine
Marketing-Leiterin, den Social-Media-Chef und
seine Sekretärin gegen sich, sondern auch die
sehr selbstbewusste Praktikantin. Vor dem
Theaterpublikum als versammelter Trauergemeinde
zerfleischt sich in diesem hochpointierten Stück
schließlich die Führungsetage der Firma immer
mehr. Und nicht einmal der verzweifelte Pfarrer
kann die Wogen glätten.
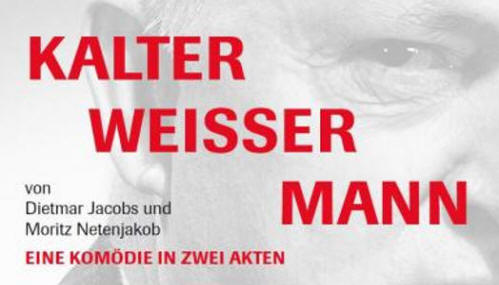
Die wendungsreiche Komödie von Dietmar Jacobs
und Moritz Netenjakob (u.a. EXTRAWURST) zeichnet
mit scharfem Blick und lustvoller Hingabe die
Abgründe, Fallstricke und rhetorischen Kniffe
der aktuellen Diskussion über soziale
Umgangsnormen, ihre menschlich-allzumenschlichen
Ursachen, weckt aber auch die Sehnsucht nach
einem aufmerksamen und respektvollen Umgang
miteinander.
Die Tickets sind bei der
Buchhandlung Hintzen sowie über das
XOX-Kartentelefon (Tel.: 02821-78755) oder per
E-Mail an xox-theater@web.de erhältlich.
Moers: Klezmer-Musik mit Hüsch-Texten am 29.
Juni erleben
Tach zusammen – sajt gesunt
mir!‘ Klezmer-Musik und Texte von Hanns Dieter
Hüsch präsentiert das Bernsteyn-Trio am Sonntag,
29. Juni, um 17 Uhr im Haus der
Demokratiegeschichte im Alten Landratsamt
(Kastell 5).

(Foto: privat)
Auf ganz eigene Weise
nähert sich das Klezmer-Trio in diesem Programm
dem niederrheinischen Poeten und Kabarettisten:
Ute Bernstein (Geige, Gesang, Rezitation), Achim
Lüdecke (Gitarre, Gesang) und Peter Hohlweger
(Akkordeon, Gesang) gelingt eine
außergewöhnliche Verbindung zwischen den sowohl
humorvollen als auch zutiefst
menschenfreundlichen Texten von Hanns Dieter
Hüsch und der jiddischen Musik.
Mit
Feingefühl, einer deutlichen Ernsthaftigkeit und
einem hintergründigen Sinn für Humor schaffen
die Künstler einen Raum, der verdeutlicht, was
wesentlich ist: Menschen wollen in Frieden
miteinander leben. Veranstalter des Abends ist
der Freundeskreis Hanns Dieter Hüsch e.V. in
Kooperation mit: Grafschafter Museum,
Bildungswerk FRIEDA Kirchenkreis Moers, Erinnern
für die Zukunft e.V., Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Moers e. V.,
Moerser Gesellschaft zur Förderung des
literarischen Lebens e. V.
Tickets sind
im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro im
Grafschafter Museum (Kastell 9) und in der
Barbara Buchhandlung Moers (Burgstraße 12)
erhältlich. Der Eintritt an der Abendkasse
kostet 15 Euro.
Kleve:
Führung mit Käse und Wein am 29. Juni
Wenn es um Weinanbau geht, denkt man direkt an
die Pfalz oder Rheinhessen, aber dass auch am
Niederrhein und sogar in Kleve Wein angebaut
wurde, ist vielen unbekannt.

Gästeführerin am Eingangsportal der Schwanenburg
Am Sonntag, den 29. Juni um 11 Uhr lädt die
Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt
Kleve GmbH (WTM) zu einer Führung ein, bei der
es neben dem Thema Wein auch um die
Käseherstellung geht. Gästeführerin Birgit van
den Boom weiß dazu allerhand interessante und
kuriose Geschichten zu erzählen. „Im 17.
Jahrhundert wurde Wein in Kleve auch als
Zahlungsmittel für besondere Dienste genutzt und
für Frauen im alten Rom war es gar
lebensgefährlich, Wein zu verkosten“, berichtet
die zertifizierte Gästeführerin.
Damit
man bei dem Rundgang voll in das Thema
eintauchen kann, gibt es zwischendurch auch Käse
und Wein zum Probieren. „Natürlich wird auch
Maria Reymer, die das Geheimnis der
Käseherstellung aus den Niederlanden nach Kleve
gebracht hat, bei der Führung eine Rolle
spielen“, erzählt Martina Gellert, Leitung
Tourismus & Freizeit bei der WTM.
Die
circa 90-minütige Führung startet am
Eingangsportal der Schwanenburg (Schloßberg 1)
und kostet 15 € pro Person. Vorab ist eine
Anmeldung auf www.kleve-tourismus.de oder bei
der WTM (Tel.: 02821 84806) erforderlich.
Neue Ausgrabungen im Klever Land – eine
Region im Schatten des Niedergermanischen Limes
- Di., 01.07.2025 - 18:30 Uhr
Dr.
Julia Rücker, Archäologin beim LVR-Amt für
Bodendenkmalpflege im Rheinland (Außenstelle
Xanten), präsentiert im Rahmen eines Vortrags an
der VHS Kleve spannende Erkenntnisse und neueste
Ausgrabungsergebnisse. Neben einem allgemeinen
Überblick über römische Spuren im Kreis Kleve
gewährt sie exklusive Einblicke in aktuelle
Funde und ihre Bedeutung für die regionale
Forschung.

Zeichnung ein gepflasterter Weg mit zwei
Soldaten und zwei Bürgern
Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen, sich
auf eine faszinierende Reise in die römische
Vergangenheit der Region zu begeben und das
archäologische Erbe ihrer Heimat neu zu
entdecken. Anmeldung unter
www.vhs-kleve.de
Abschluss
des Bibliotheksführerscheins: Lesung mit der
Autorin Tina Schilp in der Stadtbibliothek
Dinslaken
Zum Abschluss des
Bibliotheksführerscheins erwartet rund 300
Viertklässler*innen ein besonderes Highlight: Am
2. Juli 2025 liest die Kinderbuchautorin Tina
Schilp im Dachstudio der Stadtbibliothek
Dinslaken aus ihrem Buch „Schwapp, der
Geheimschleim – Der große Schleimassel“. Die
Geschichte ist ein humorvolles und
fantasievolles Abenteuer, das junge Leser*innen
begeistert.
In den vergangenen
Schuljahren haben die Kinder im Rahmen des
Bibliotheksführerscheins die Stadtbibliothek
kennengelernt und gelernt, sich selbstständig in
der Welt der Bücher und Medien zu orientieren.
Ziel war es, Medienkompetenz zu vermitteln,
Neugier zu wecken und die Fähigkeit zur
eigenständigen Nutzung von Bibliotheken zu
stärken.
„Lesen, recherchieren,
Informationen einordnen – all das sind
Schlüsselkompetenzen“, betont
Bibliotheksleiterin Constanze Palotz. „Der
Bibliotheksführerschein unterstützt Kinder
darin, sich sicher und selbstbewusst in der
Medienwelt zu bewegen.“
Die Lesung bildet
den feierlichen Abschluss des
Bibliotheksführerscheins und soll die Freude am
Lesen weitertragen. Sie zeigt den Kindern, wie
spannend Bücher sein können und wie lebendig
Geschichten werden, wenn sie direkt von einer
Autorin erzählt werden.
Studie zu privaten Krankenversicherungen - Lange
Laufzeiten entschärfen Probleme
Langfristige Verträge der privaten
Krankenversicherung in Deutschland kommen nah an
das, was die Wirtschaftstheorie als „optimal“
beschreibt. Eine internationale Studie mit
Beteiligung der Universität Duisburg-Essen
zeigt: Viele Probleme des Versicherungsmarkts
lassen sich durch lange Laufzeiten abfedern –
ganz ohne komplizierte Konstruktion der
Verträge. Veröffentlicht wird die Studie im
Journal of Political Economy, einem der fünf
führenden Fachjournale der
Volkswirtschaftslehre.
Einer der vier
Studienleiter ist Prof. Dr. Martin Karlsson von
der Universität Duisburg-Essen (UDE). Gemeinsam
mit Kollegen der Cornell University, der
University of Pennsylvania (beide USA) sowie des
Leibniz-Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung analysierte er, wie gut die
langfristigen Verträge in der privaten
Krankenversicherung (PKV) funktionieren –
gemessen an dem, was die ökonomische Theorie als
„optimal“ beschreibt.
Optimal ist ein
Vertrag dann, wenn er sich flexibel an die
aktuelle Lebenslage anpasst. In
einkommensstarken Lebensphasen zahlt man mehr,
in schwächeren wird man entlastet. In der
Realität funktioniert das kaum. Trotzdem zeigen
die Gesundheitsökonomen: Die PKV-Verträge kommen
diesem Ideal erstaunlich nah – vor allem, wenn
das Einkommen im Lauf des Lebens relativ stabil
bleibt.
Stadtrat
tagt
Am Dienstag, 1. Juli 2025,
tagt der Rat der Stadt Dinslaken. Die Sitzung
beginnt um 17 Uhr in der Kathrin-Türks-Halle. Tagesordnungen
und Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen
finden Interessierte grundsätzlich im
Ratsinformationssystem
Inflation für 8 von 9 Haushaltstypen unter
Zielrate der EZB, weiterer EZB-Zinsschritt
notwendig
Die Inflationsrate in
Deutschland hat im Mai bei 2,1 Prozent verharrt
und liegt damit fast am Inflationsziel der
Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent.
Von neun verschiedenen Haushaltstypen, die sich
nach Einkommen und Personenzahl unterscheiden,
hatten acht eine haushaltsspezifische
Teuerungsrate unter dem Zielwert, der neunte
direkt beim Inflationsziel. Konkret reichte die
Spannweite im Mai von 1,4 bis 2,0 Prozent, der
Unterschied lag also bei 0,6 Prozentpunkten,
zeigt der neue Inflationsmonitor des Instituts
für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
der Hans-Böckler-Stiftung.*
Zum
Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle
im Herbst 2022 betrug die Spanne 3,1
Prozentpunkte. Während Haushalte mit niedrigen
Einkommen, insbesondere Familien, während des
akuten Teuerungsschubs der Jahre 2022 und 2023
eine deutlich höhere Inflation schultern mussten
als Haushalte mit mehr Einkommen, war ihre
Inflationsrate im Mai 2025 wie in den Vormonaten
gering: Der Warenkorb von Paaren mit Kindern und
niedrigen Einkommen verteuerte sich um 1,4
Prozent. Auf 1,7 Prozent Inflationsrate kamen
Alleinlebende mit niedrigen Einkommen.
Alleinerziehende sowie Alleinlebende mit jeweils
mittlerem Einkommen wiesen mit 1,5 bzw. 1,6
Prozent ebenfalls relativ niedrige
Teuerungsraten auf.
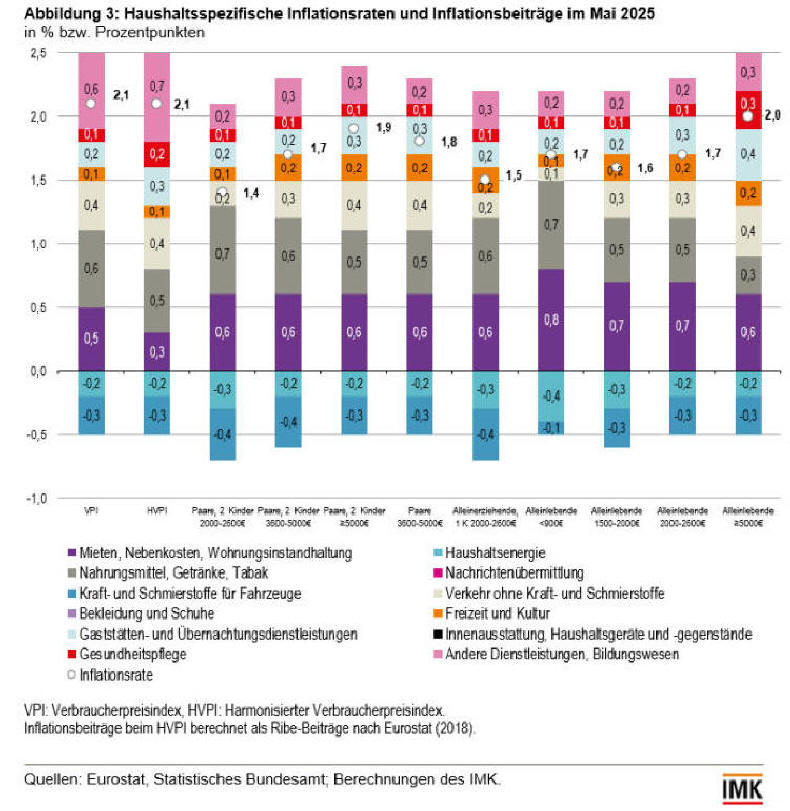
Als einziger Haushaltstyp hatten im Mai
Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen mit 2,0
Prozent eine Inflation direkt auf dem Niveau der
EZB-Zielrate. Es folgten Paare mit Kindern und
hohen Einkommen (1,9 Prozent) sowie Paare ohne
Kinder mit mittleren Einkommen (1,8 Prozent).
Ein wichtiger Faktor für das etwas höhere Niveau
ist, dass bei diesen drei konsumstarken
Haushaltstypen die niedrigeren Energiepreise
weniger stark ins Gewicht fallen als bei
Haushalten mit weniger Einkommen, deren
Warenkörbe stärker durch Güter des täglichen
Bedarfs geprägt sind.
Zudem fragen
Haushalte mit höheren Einkommen stärker
Dienstleistungen nach, die sich derzeit noch
merklich verteuern, wie
Versicherungsdienstleistungen,
Pflegedienstleistungen und Dienstleistungen des
Gastgewerbes. Allerdings verzeichneten alle drei
Haushaltsgruppen einen leichten Rückgang ihrer
Inflationsrate, weil sich der Preisauftrieb bei
Pauschalreisen gegenüber dem Vormonat
normalisiert hat. In der Folge hat sich die
Spanne zwischen den haushaltsspezifischen
Inflationsraten von 0,8 Prozentpunkten im April
auf 0,6 Prozentpunkte im Mai verringert.
Die beiden anderen untersuchten
Haushaltstypen, Familien mit mittleren Einkommen
und Alleinlebende mit höheren Einkommen,
verzeichneten im Mai eine Inflationsrate von je
1,7 Prozent. Dass aktuell alle vom IMK
ausgewiesenen haushaltsspezifischen
Inflationsraten leicht unter der Gesamtinflation
liegen, wie sie das Statistische Bundesamt
berechnet, liegt an unterschiedlichen
Gewichtungen: Das IMK nutzt für seine
Berechnungen weiterhin die repräsentative
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, während
Destatis seit Anfang 2023 die
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung heranzieht.
Zusätzliches Argument für Zinssenkung: Euro
hat deutlich aufgewertet
Im Jahresverlauf
2025 dürfte sich die Inflationsrate weiter
normalisieren und um den Wert von zwei Prozent
schwanken, so die Erwartung von Dr. Silke Tober,
IMK-Expertin für Geldpolitik und Autorin des
Inflationsmonitors. Allerdings sind die Risiken
für die Inflationsprognose in den vergangenen
Wochen etwas gestiegen, und zwar in beide
Richtungen: Während ein länger andauernder
Konflikt zwischen Israel und dem Iran zu
anhaltend höheren Rohöl- und Erdgaspreisen
führen könnte, besteht durch den weiter
schwelenden von US-Präsident Donald Trump
provozierten Zollkonflikt das Risiko, dass die
Teuerung sogar unter die Zielinflation fällt.
Denn auch wenn sich die handelspolitische
Auseinandersetzung zeitweilig etwas beruhigt
hat, hält sie die Gefahr einer weltweiten
Rezession hoch, die die Preisentwicklung
zusätzlich dämpfen würde.
Tober hält eine
weitere Leitzinssenkung durch die EZB für
erforderlich. Die Zinsschritte der vergangenen
Monate, zuletzt am 11. Juni auf 2,0 Prozent,
hätten zwar für Entlastung gesorgt. Sie reichten
aber noch nicht aus, zumal seit Jahresbeginn der
Euro gegenüber dem US-Dollar um 10 Prozent
aufgewertet hat, was die ohnehin verhaltenen
Exportaussichten der Europäer bremst. Ein
weiterer Zinsschritt solle „zeitnah folgen,
zumal die aktuelle Inflationsprognose der EZB
dies ohnehin annimmt“, erklärt die Ökonomin.
„Eine Belebung der Binnennachfrage ist dringend
erforderlich und könnte zudem einen Beitrag zur
Lösung des Zollkonflikts liefern.“
Langfristiger Vergleich: Lebensmittel knapp 40
Prozent teurer als 2019
Das IMK berechnet
seit Anfang 2022 monatlich spezifische
Teuerungsraten für neun repräsentative
Haushaltstypen, die sich nach Zahl und Alter der
Mitglieder sowie nach dem Einkommen
unterscheiden (mehr zu den Typen und zur Methode
unten). In einer Datenbank liefert der
Inflationsmonitor zudem ein erweitertes
Datenangebot: Online lassen sich Trends der
Inflation für alle sowie für ausgewählte
einzelne Haushalte im Zeitverlauf in
interaktiven Grafiken abrufen.
Die
längerfristige Betrachtung illustriert, dass
Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen
von der starken Teuerung nach dem russischen
Überfall auf die Ukraine besonders stark
betroffen waren, weil Güter des Grundbedarfs wie
Nahrungsmittel und Energie in ihrem Budget eine
größere Rolle spielen als bei Haushalten mit
hohen Einkommen.
Diese wirkten lange als
die stärksten Preistreiber, zeigt ein
längerfristiger Vergleich, den Tober in ihrem
neuen Bericht ebenfalls anstellt: Die Preise für
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen
im Mai 2025 um 39,6 Prozent höher als im Mai
2019, also vor Pandemie und Ukrainekrieg. Damit
war die Teuerung für diese unverzichtbaren
Basisprodukte mehr als dreimal so stark wie mit
der EZB-Zielinflation von kumuliert 12,6 Prozent
in diesem Zeitraum vereinbar. Energie war trotz
der Preisrückgänge in letzter Zeit um 33,0
Prozent teurer als im April 2019.
Informationen zum Inflationsmonitor
Für den
IMK Inflationsmonitor werden auf Basis der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des
Statistischen Bundesamts die für
unterschiedliche Haushalte typischen
Konsummuster ermittelt. So lässt sich gewichten,
wer für zahlreiche verschiedene Güter und
Dienstleistungen – von Lebensmitteln über
Mieten, Energie und Kleidung bis hin zu
Kulturveranstaltungen und Pauschalreisen – wie
viel ausgibt und daraus die haushaltsspezifische
Preisentwicklung errechnen.
Die Daten zu
den Haushaltseinkommen stammen ebenfalls aus der
EVS. Im Inflationsmonitor werden neun
repräsentative Haushaltstypen betrachtet:
Paarhaushalte mit zwei Kindern und niedrigem
(2000-2600 Euro), mittlerem (3600-5000 Euro),
höherem (mehr als 5000 Euro) monatlichem
Haushaltsnettoeinkommen; Haushalte von
Alleinerziehenden mit einem Kind und mittlerem
(2000-2600 Euro) Nettoeinkommen; Singlehaushalte
mit niedrigem (unter 900 Euro), mittlerem
(1500-2000 Euro), höherem (2000-2600 Euro) und
hohem (mehr als 5000 Euro)
Haushaltsnettoeinkommen sowie Paarhaushalte ohne
Kinder mit mittlerem Haushaltsnettoeinkommen
zwischen 3600 und 5000 Euro monatlich. Der IMK
Inflationsmonitor wird monatlich aktualisiert.

Baugenehmigungen für Wohnungen im April
2025: +4,9 % zum Vorjahresmonat +15,4 % bei
Einfamilienhäusern
-9,7 % bei
Zweifamilienhäusern
-0,1 % bei
Mehrfamilienhäusern
Im April 2025 wurde
in Deutschland der Bau von 18 500 Wohnungen
genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 4,9 % oder 900
Baugenehmigungen mehr als im April 2024. Von
Januar bis April 2025 wurden insgesamt 73 900
Wohnungen genehmigt. Das waren 3,7 % oder 2 700
Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum.
In diesen Ergebnissen sind sowohl
Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn-
und Nichtwohngebäuden als auch für neue
Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. In
neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im April
2025 insgesamt 15 000 Wohnungen genehmigt. Das
waren 5,1 % oder 700 Wohnungen mehr als im
Vorjahresmonat.
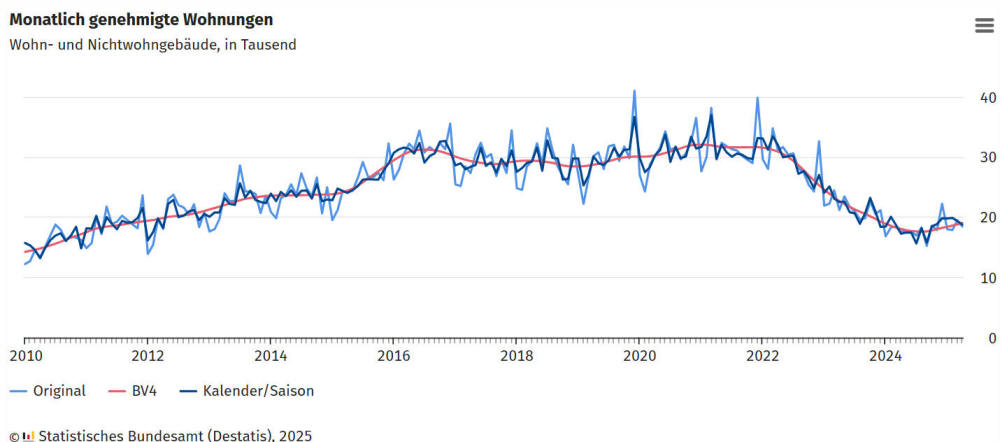
Januar bis April 2025: Aufwärtstrend bei
Einfamilienhäusern setzt sich fort, Stagnation
bei Mehrfamilienhäusern Von Januar bis April
2025 wurden in Wohn- und Nichtwohngebäuden 4,3 %
oder 2 500 mehr Neubauwohnungen genehmigt als im
Vorjahreszeitraum 2024. Dabei stieg die Zahl der
Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um 15,4 % (+1 900) auf
14 200 an.
Der positive Trend bei den
Einfamilienhäusern hält bereits seit Dezember
2024 an. Bei den Zweifamilienhäusern sank die
Zahl in den ersten vier Monaten 2025 um 9,7 %
(-400) auf 4 000 genehmigte Wohnungen. Bei den
Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten
Gebäudeart, blieb die Zahl der Baugenehmigungen
gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit
38 600 Wohnungen nahezu konstant (-0,1 % oder
-40 Wohnungen).
Leicht unter
EU-Schnitt: 40,2 Wochenstunden haben in Vollzeit
Erwerbstätige hierzulande 2024 gearbeitet
• Im EU-Durchschnitt arbeiten 15- bis 64-jährige
Vollzeitbeschäftigte 40,3 Stunden pro Woche
• Teilzeitquote in Deutschland deutlich höher
als in den meisten EU- Staaten
•
Erwerbstätigenquote in Deutschland
überdurchschnittlich hoch, vor allem bei Frauen
Vollzeitbeschäftigte in Deutschland
leisten durchschnittlich etwas weniger
Arbeitsstunden pro Woche als im EU-Durchschnitt.
15- bis 64-jährige Erwerbstätige in Vollzeit
haben im Jahr 2024 im Schnitt 40,2 Wochenstunden
gearbeitet. Sie lagen damit geringfügig unter
dem EU-Durchschnitt von 40,3 Wochenstunden, wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis
von Daten der europäischen Statistikbehörde
Eurostat mitteilt. In den letzten zehn Jahren
ist die Arbeitszeit in Deutschland und EU-weit
leicht zurückgegangen: 2014 hatte sie
hierzulande noch bei 41,5 Wochenstunden gelegen,
EU-weit waren es 41,3 Wochenstunden.
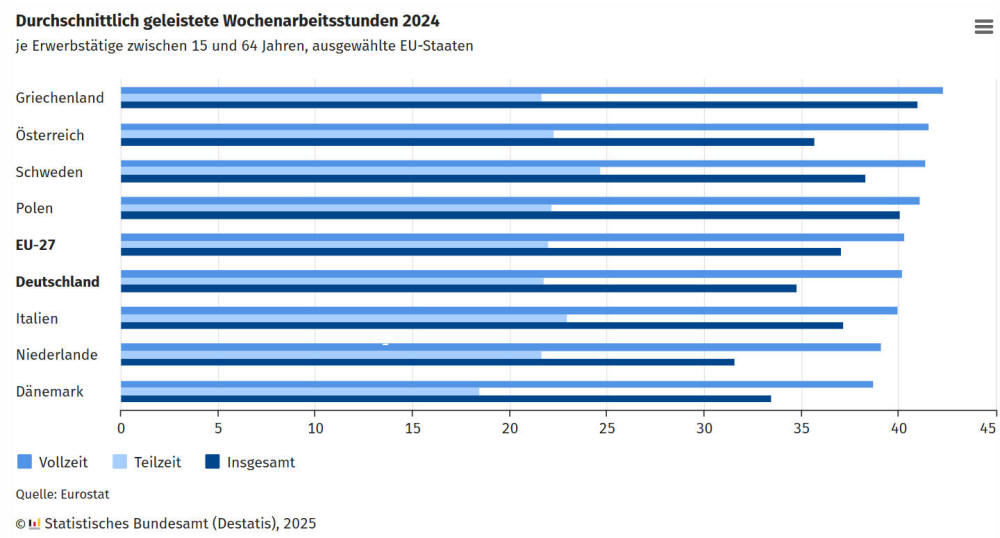
Teilzeitquote in Deutschland mit 29 % eine
der höchsten in der EU
Im Jahr 2024
arbeiteten in Deutschland nach Daten der
Europäischen Arbeitskräfteerhebung 29 % der
Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 Jahren in
Teilzeit. Höher war die Teilzeitquote lediglich
in den Niederlanden (43 %) und in Österreich
(31 %). EU-weit arbeiteten 18 % der
Erwerbstätigen in Teilzeit.
Frauen waren
dabei hierzulande mehr als viermal so häufig in
Teilzeit tätig wie Männer: Während 48 % der
Frauen Teilzeit arbeiteten, traf dies nur auf
12 % der Männer zu. Auf EU-Ebene fallen die
Geschlechterunterschiede bei insgesamt deutlich
niedrigeren Quoten geringer aus; Frauen
arbeiteten gut dreimal so häufig in Teilzeit wie
Männer: EU-weit waren 28 % der Frauen in
Teilzeit tätig und 8 % der Männer.
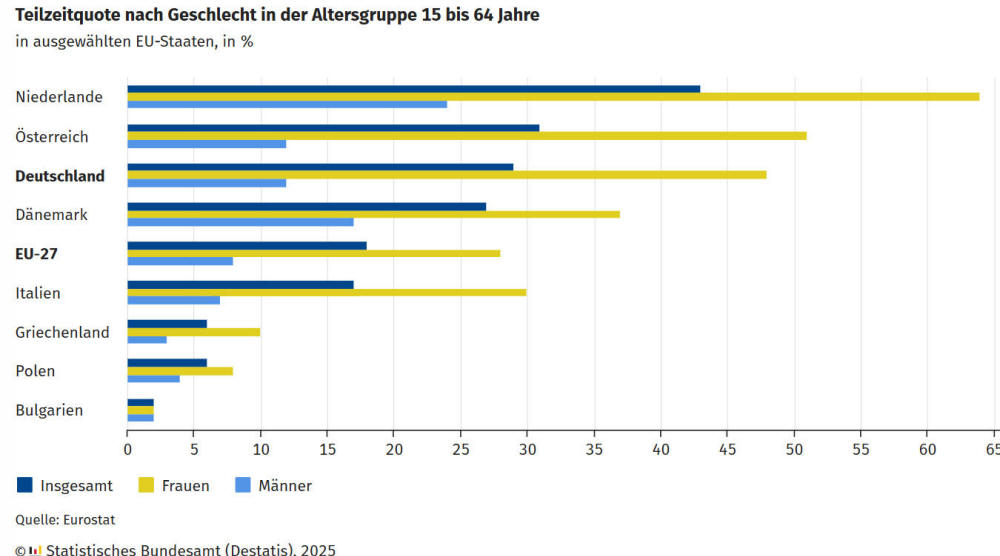
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist
EU-weit in den letzten Jahren leicht
zurückgegangen (2014: 19 %), was auf einem
Rückgang der Teilzeitquote bei den Frauen
beruht. In Deutschland ist der Anteil der
Teilzeit Arbeitenden hingegen gestiegen, und
zwar geschlechterübergreifend: 2014 waren 27 %
der Beschäftigten hierzulande in Teilzeit tätig,
9 % der Männer und 46 % der Frauen.
Erwerbstätigenquote mit 77 % deutlich höher als
in der EU Eine Teilzeittätigkeit kann als
Möglichkeit wahrgenommen werden, Beruf und
Familie zu vereinbaren. In Deutschland geht die
im EU-Vergleich höhere Teilzeitbeschäftigung mit
einer höheren Erwerbstätigkeit, vor allem von
Frauen, einher.
77 % der 15- bis
64-jährigen Bevölkerung waren hierzulande im
Jahr 2024 erwerbstätig – ein Rekordwert, der
deutlich über der EU-Erwerbstätigenquote von
71 % lag. Noch deutlicher war der Unterschied
bei der Erwerbstätigkeit von Frauen: Die Quote
betrug hierzulande 74 % und war damit
8 Prozentpunkte höher als im EU-Durchschnitt mit
66 %.
Gegenüber 2014 nahm die
Erwerbstätigkeit hierzulande zu – damals waren
noch knapp drei Viertel (74 %) erwerbstätig. Der
Anstieg fiel in diesem Zeitraum bei Frauen (von
70 % auf 74 %) etwas deutlicher aus als bei
Männern (von 78 % auf 81 %). EU-weit stieg die
Erwerbstätigkeit im selben Zeitraum noch
deutlicher an: von 64 % auf 71 %. Bei Männern
nahm sie von 69 % auf 75 % zu, bei Frauen von
59 % auf 66 %.
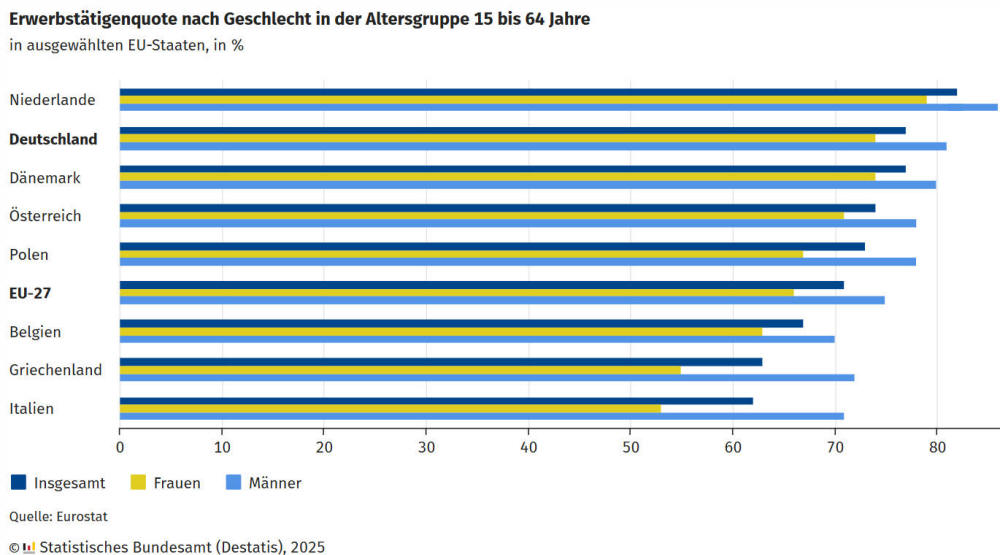
|

















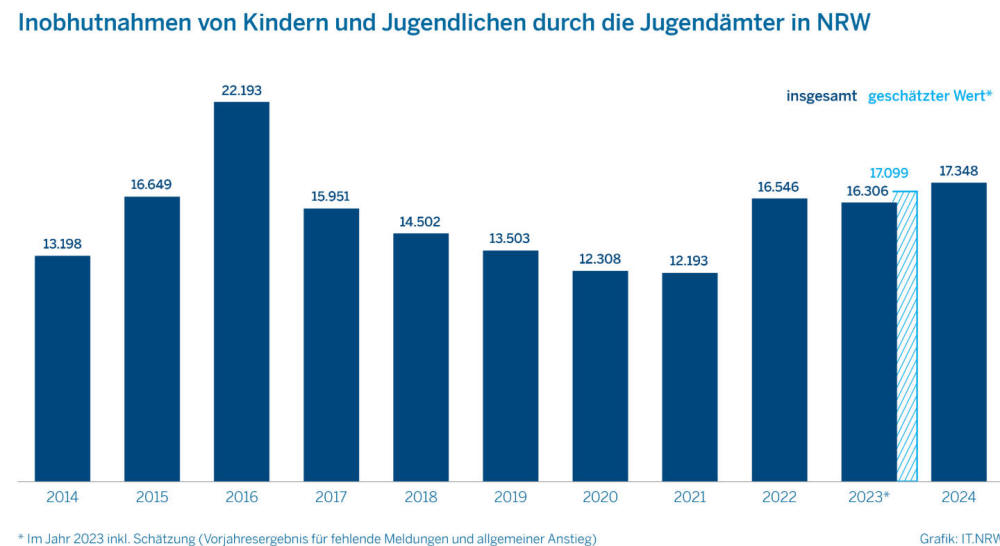
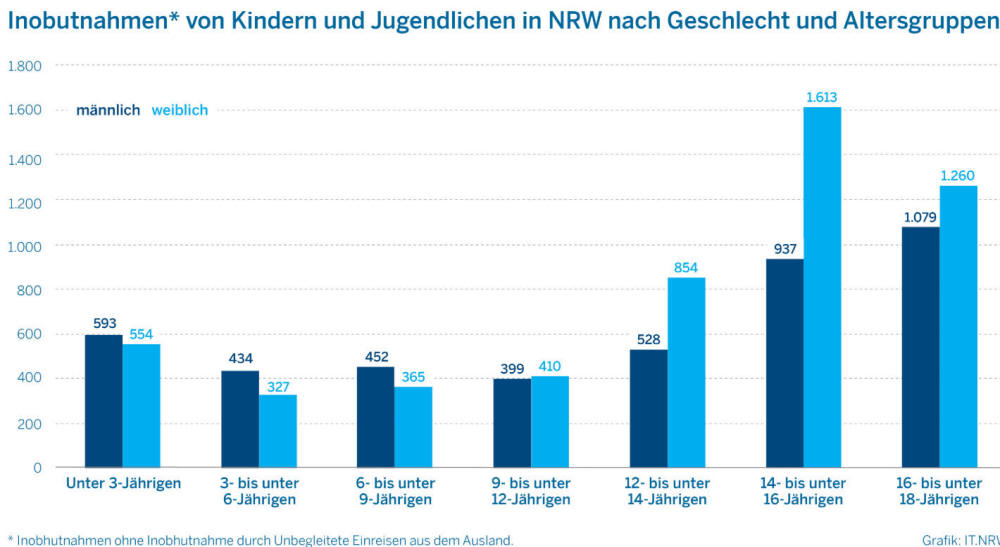
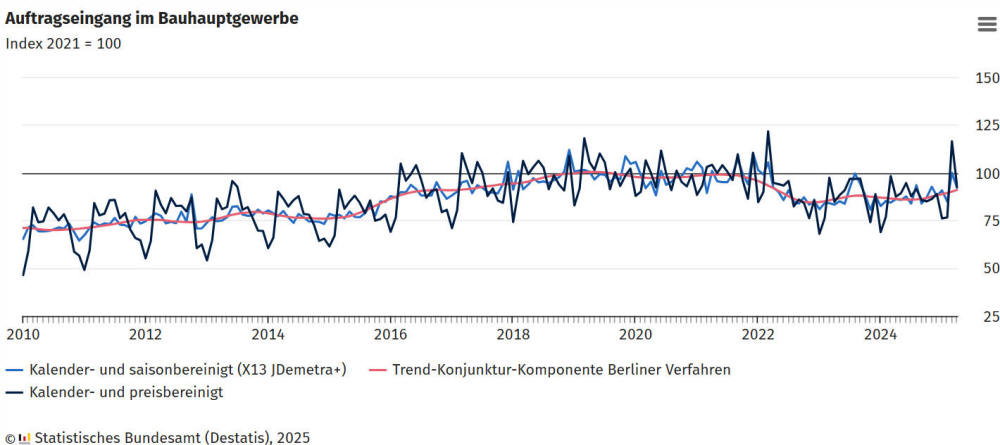
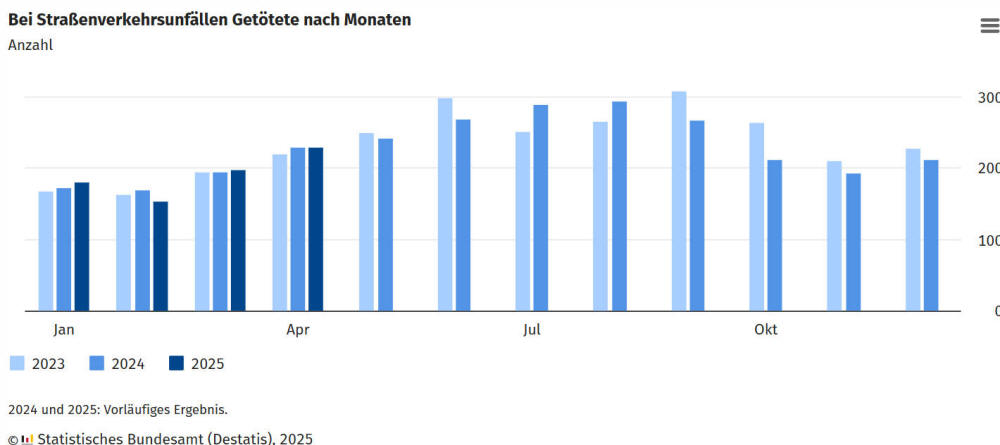


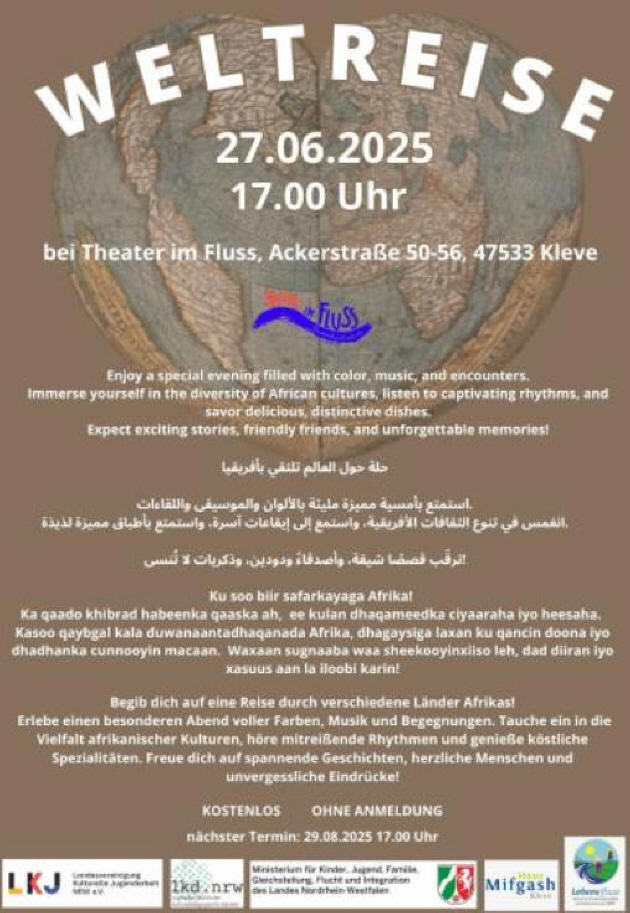



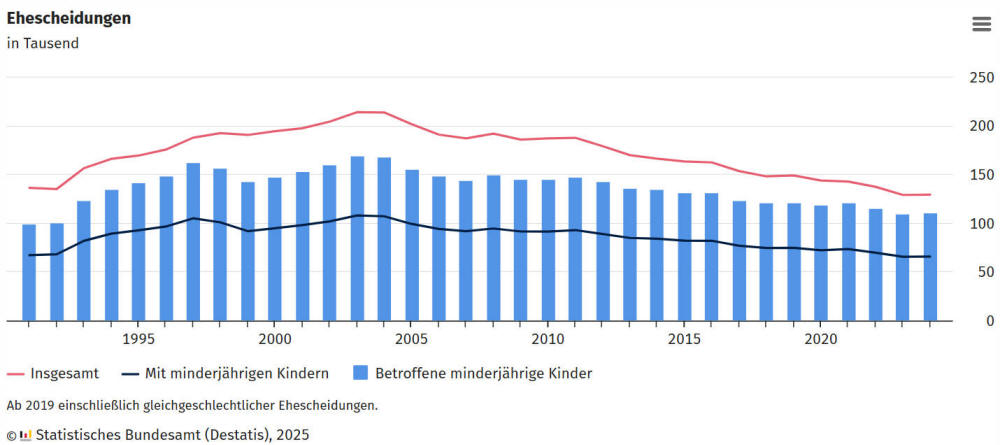
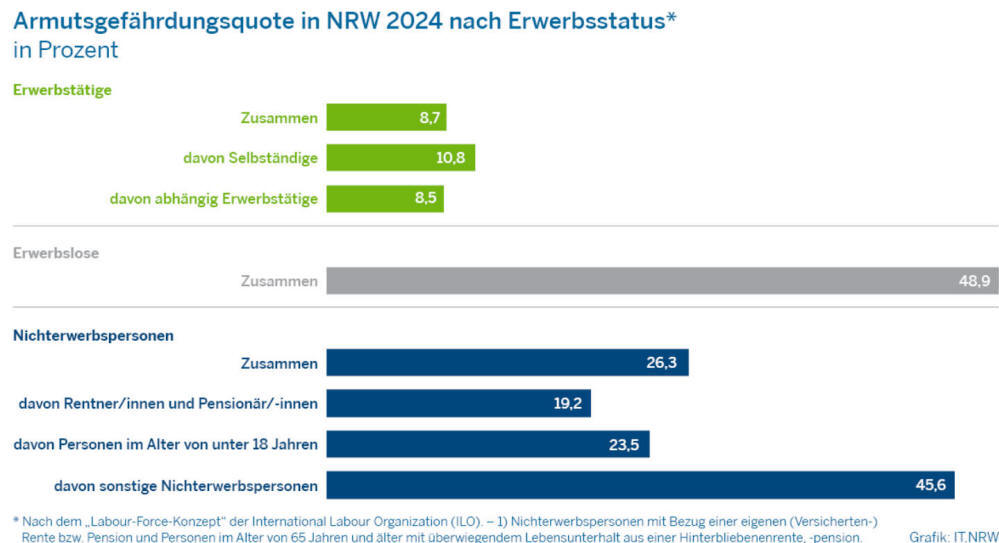
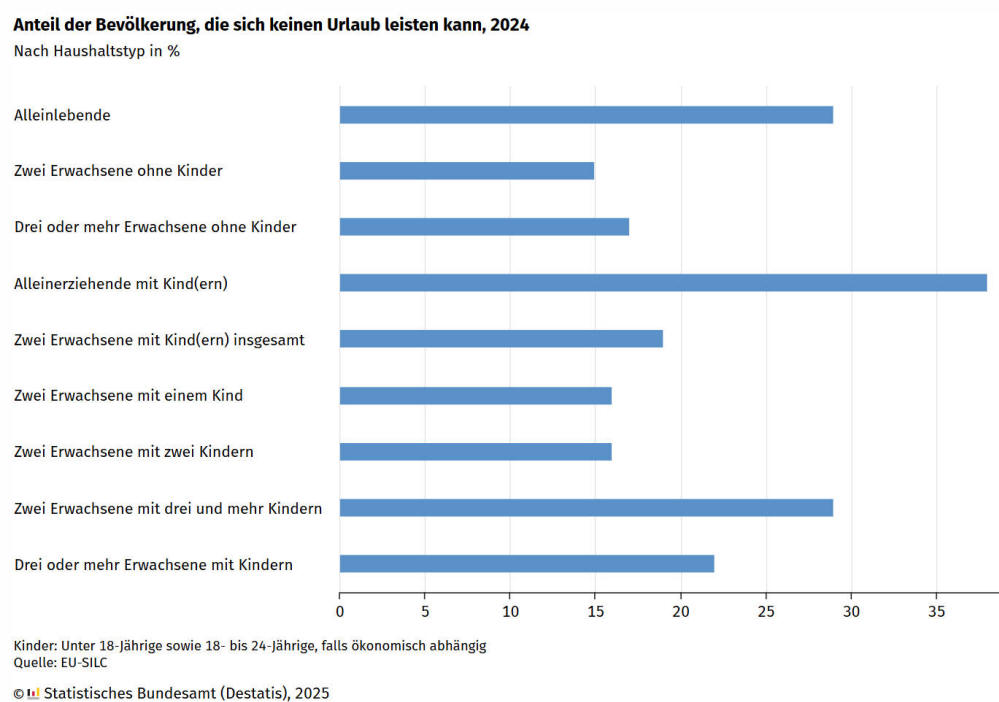
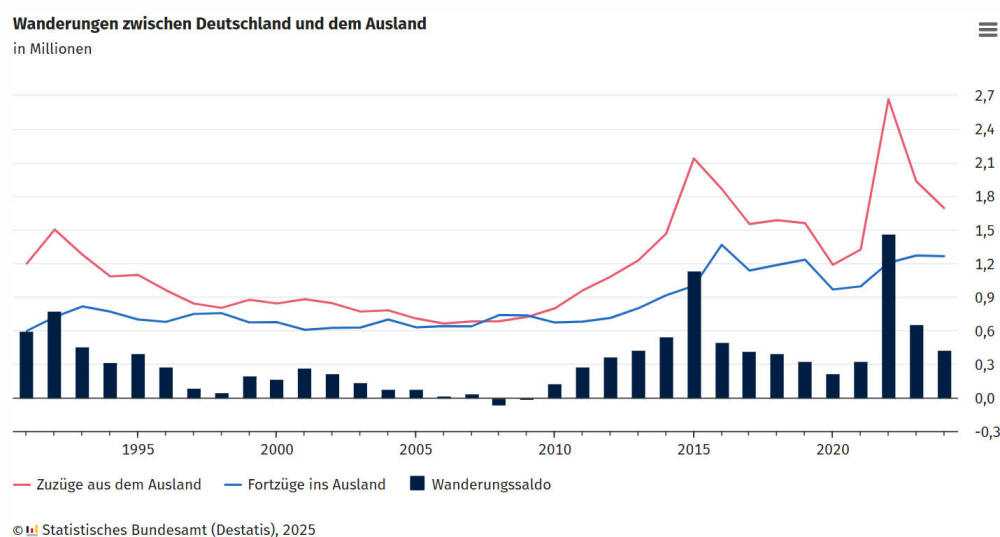

 :
: