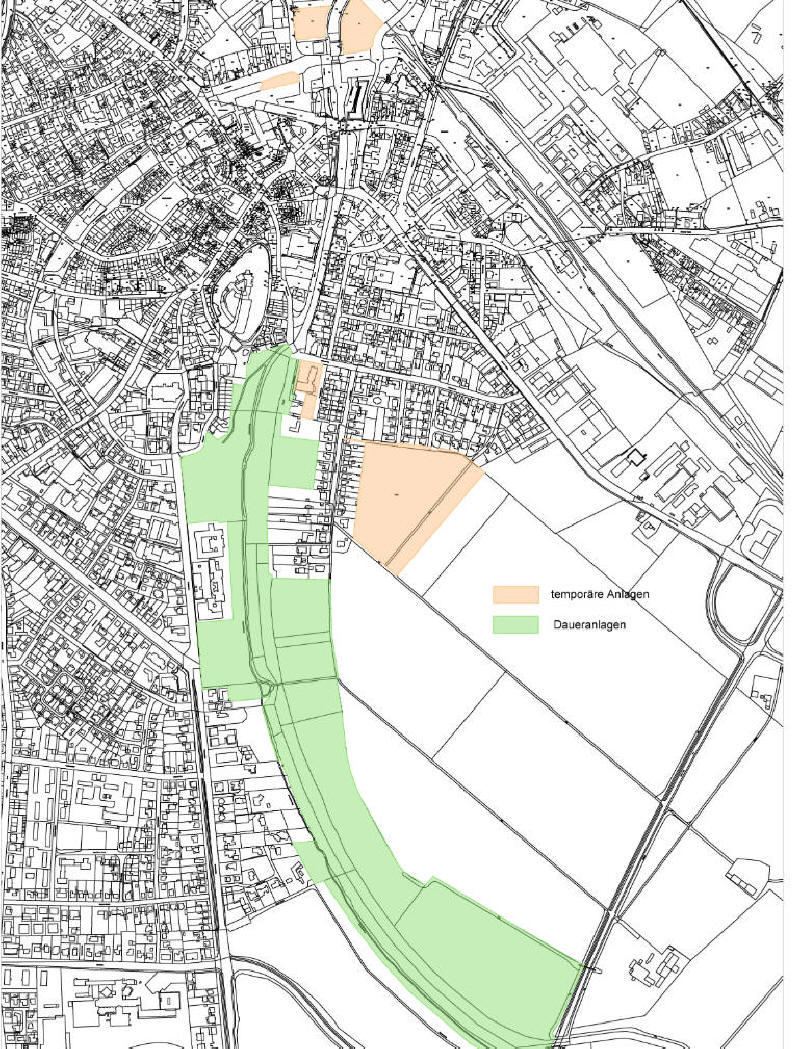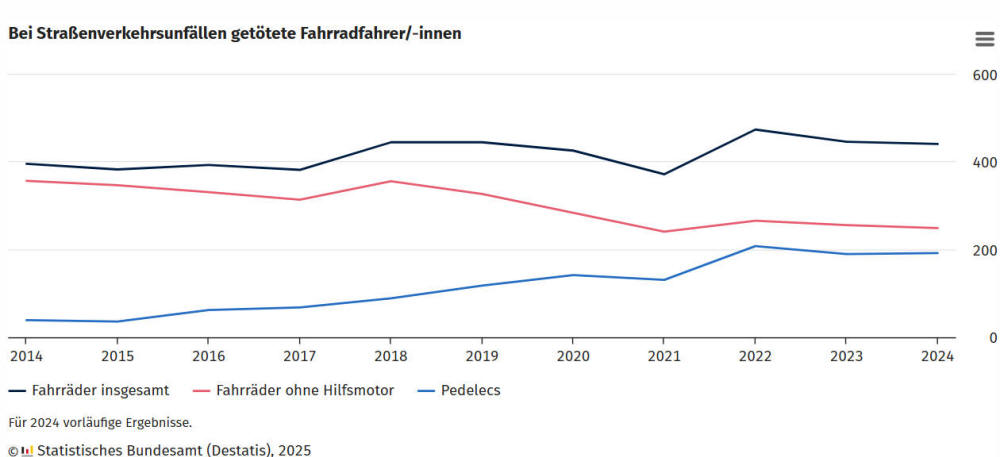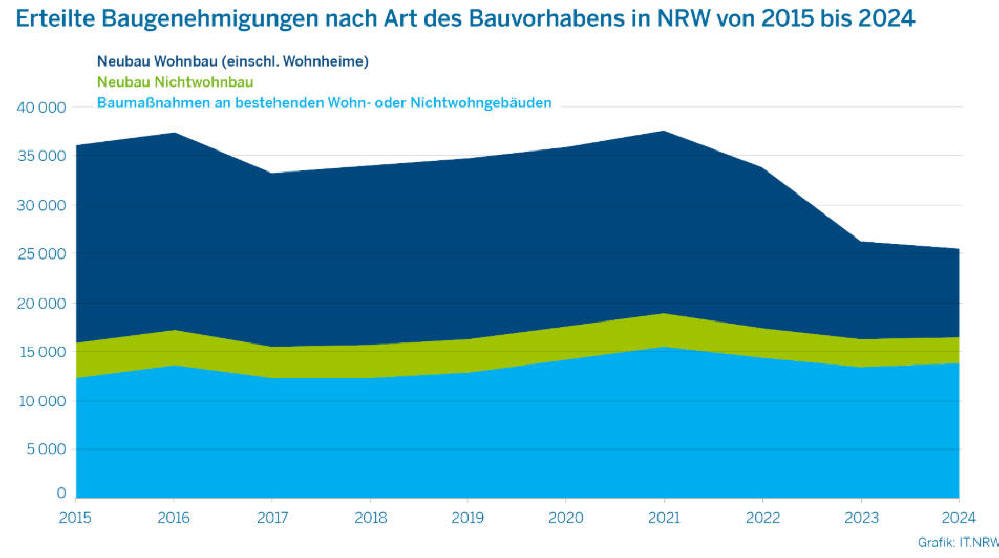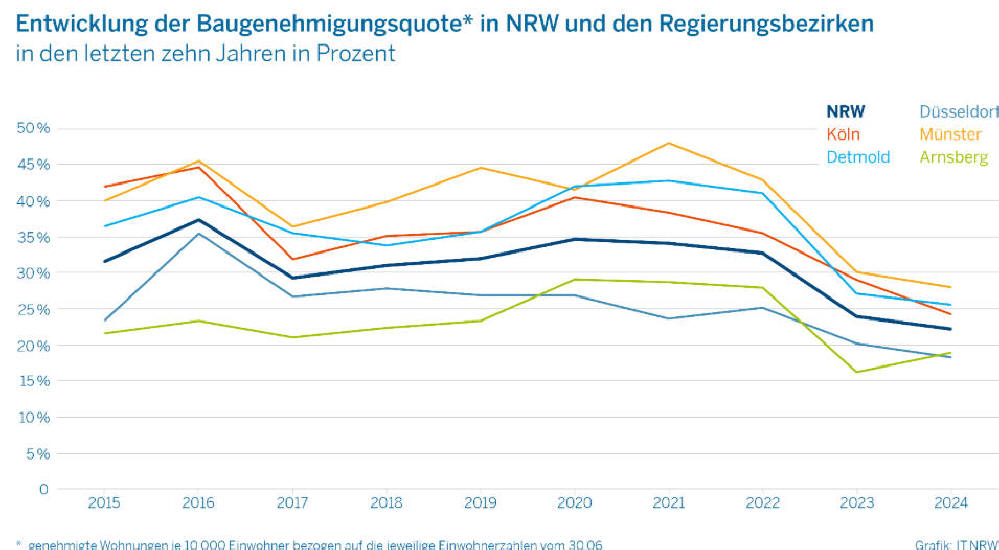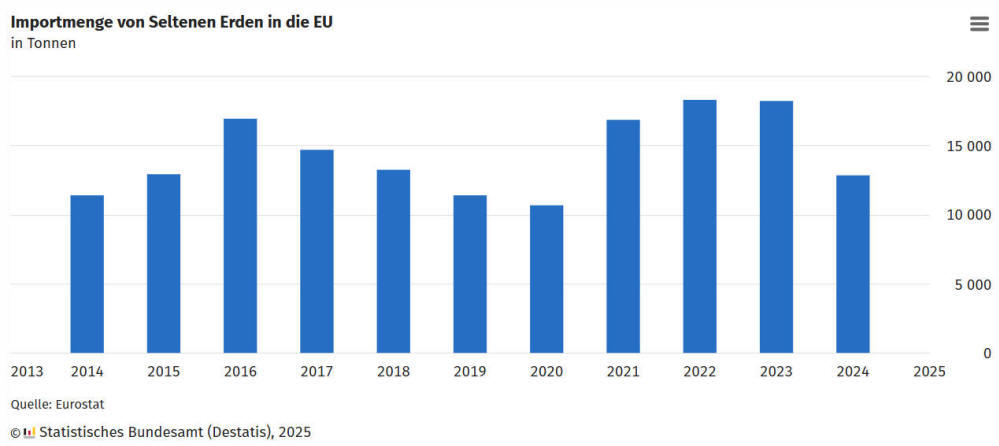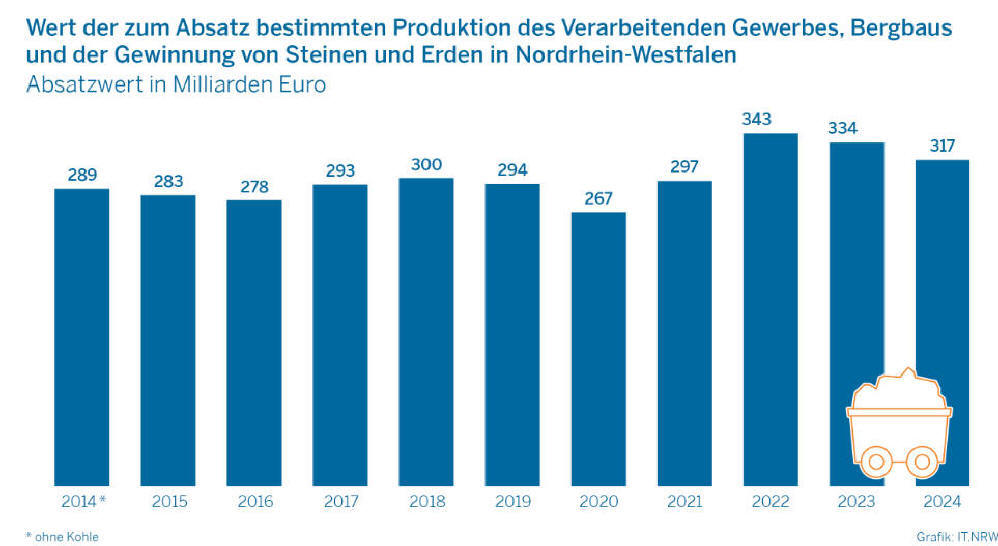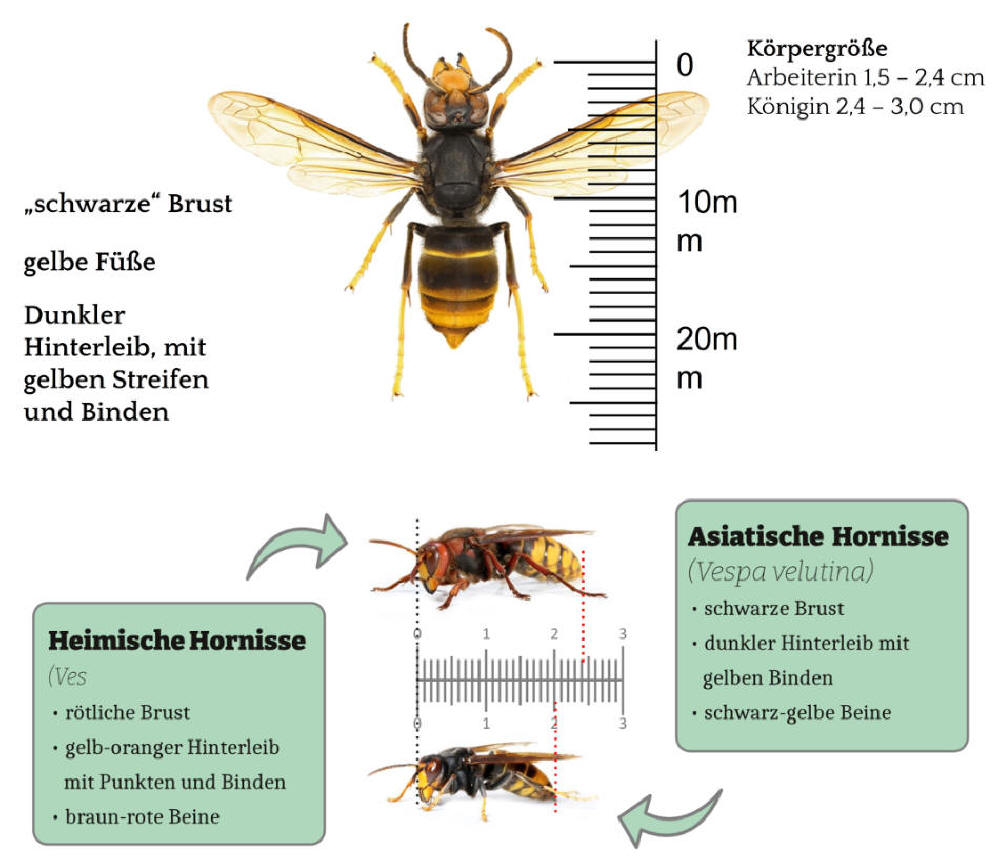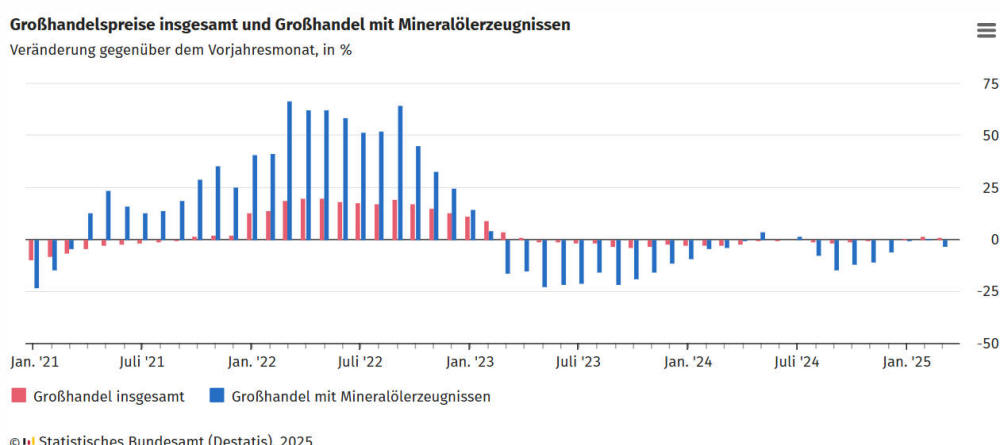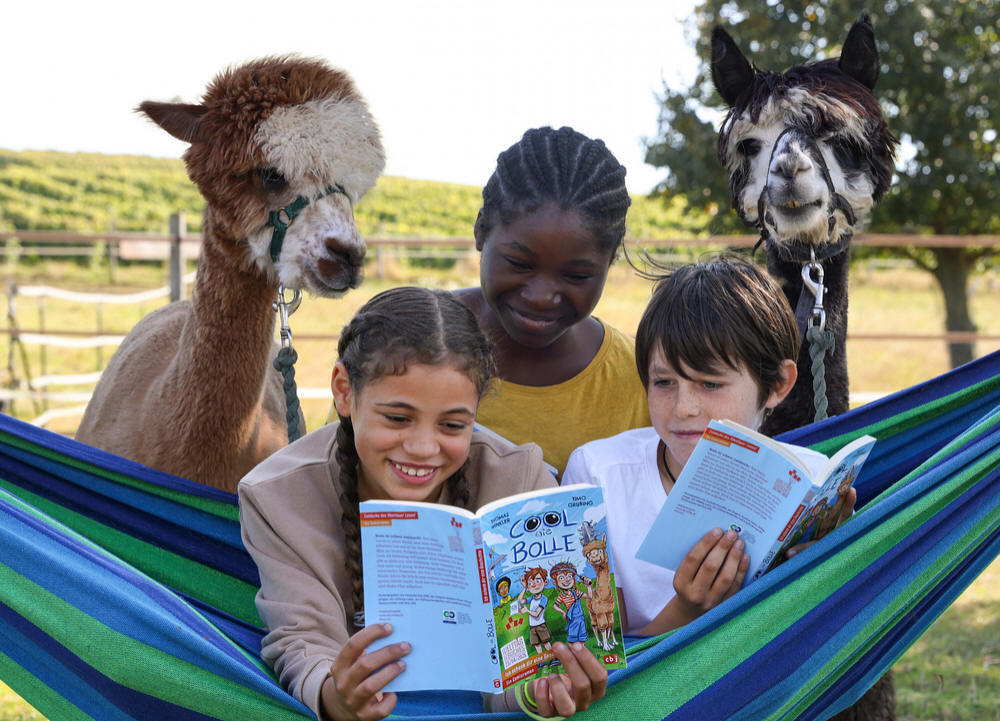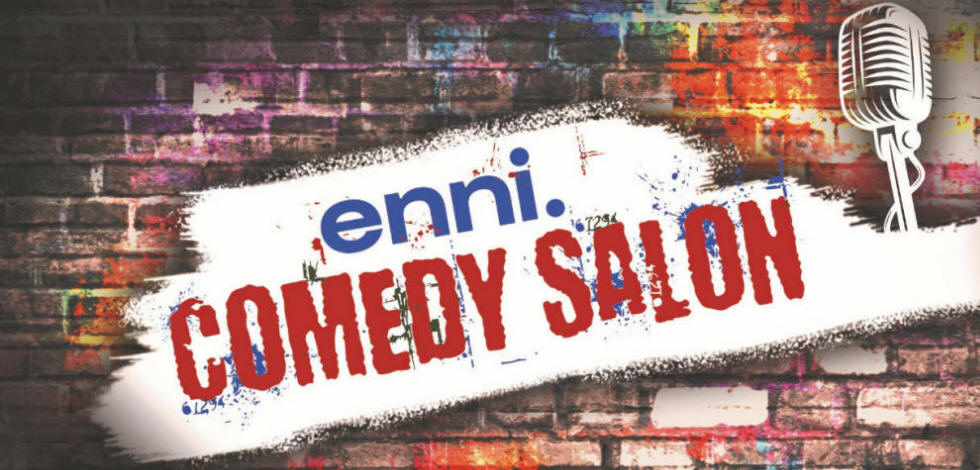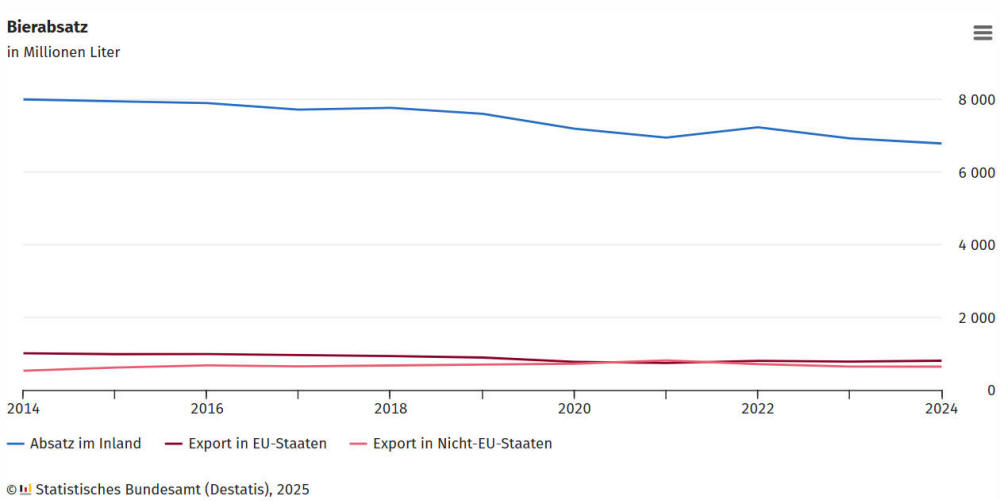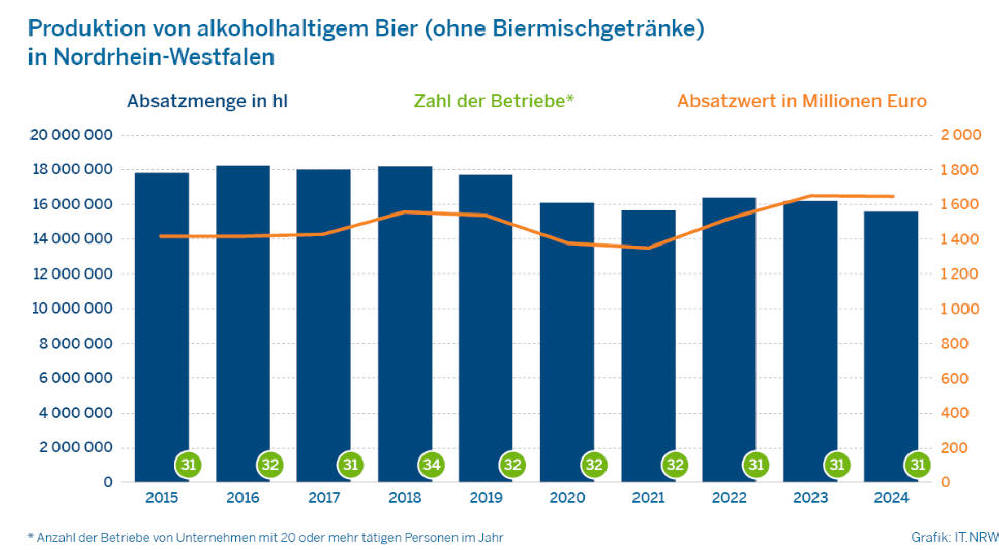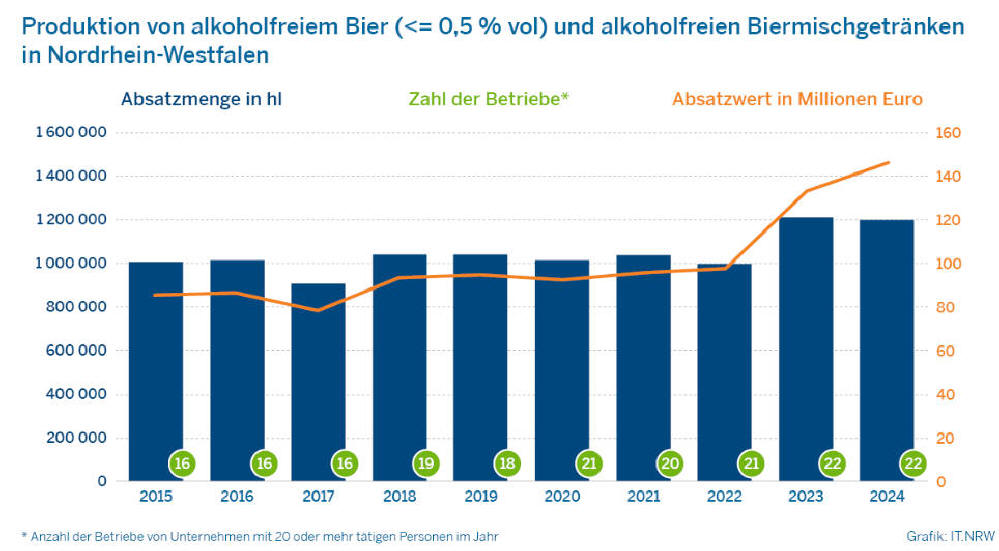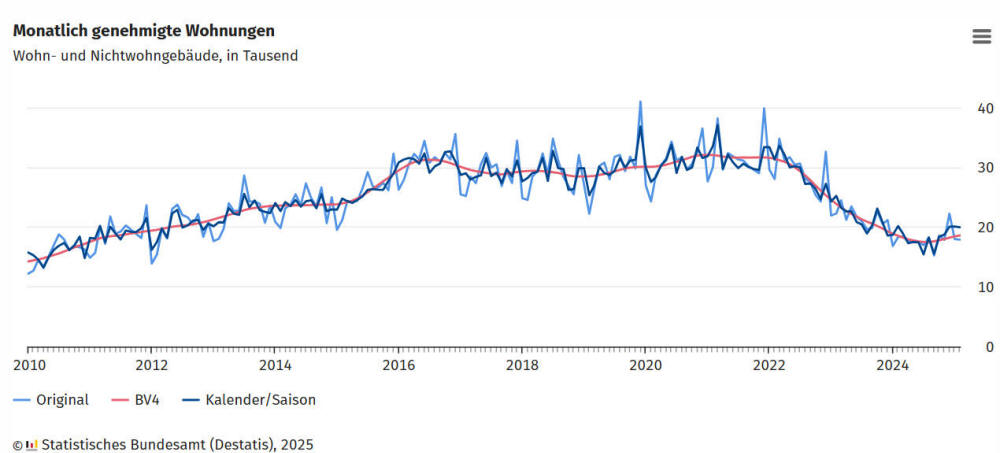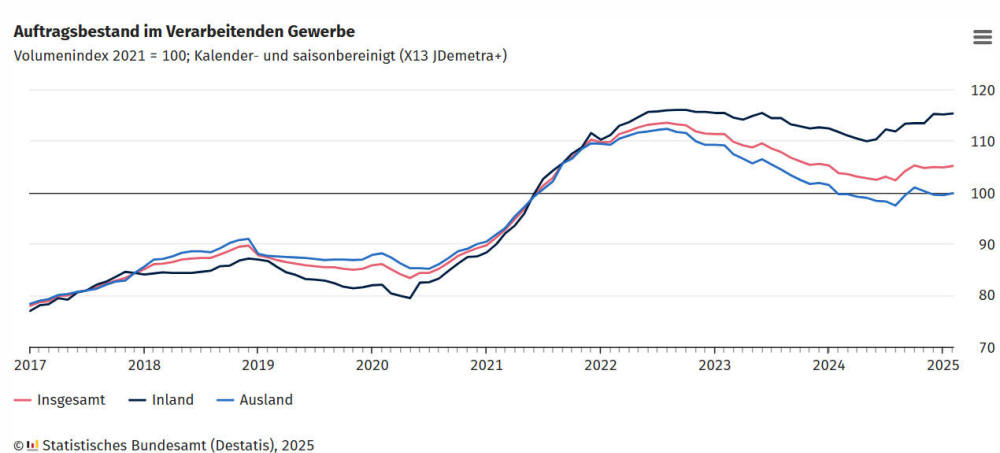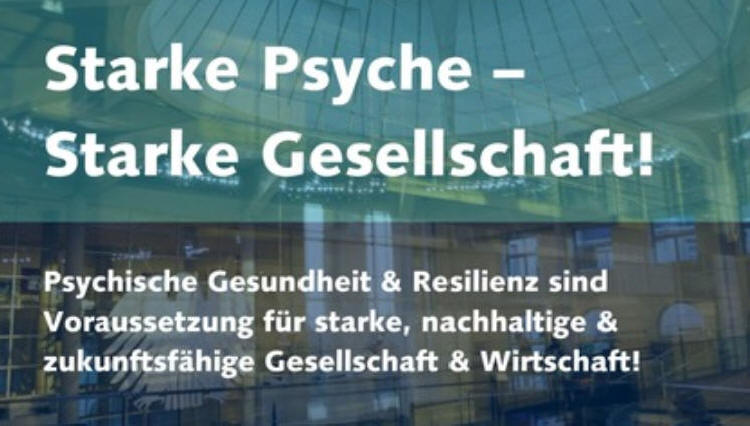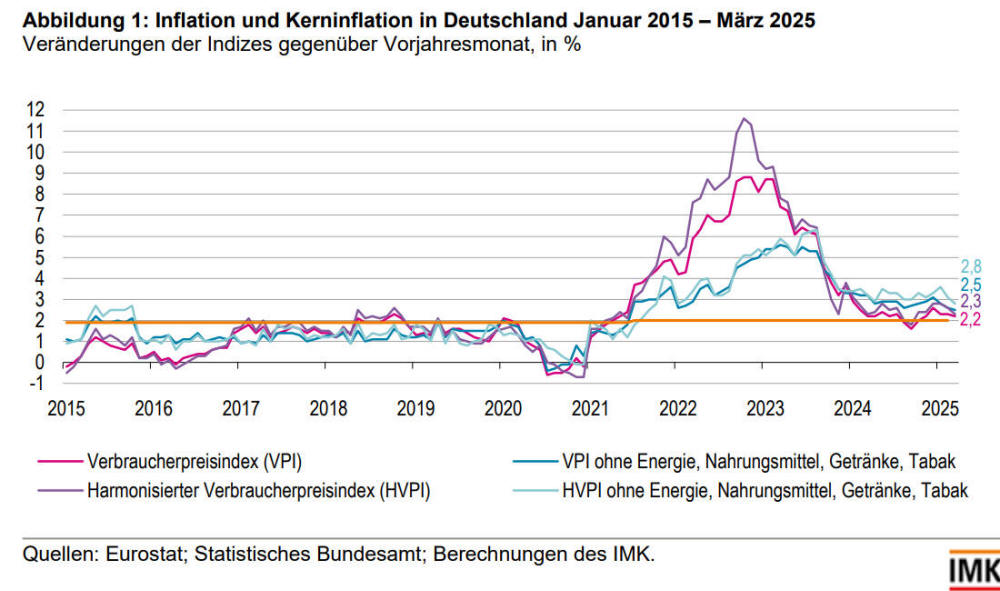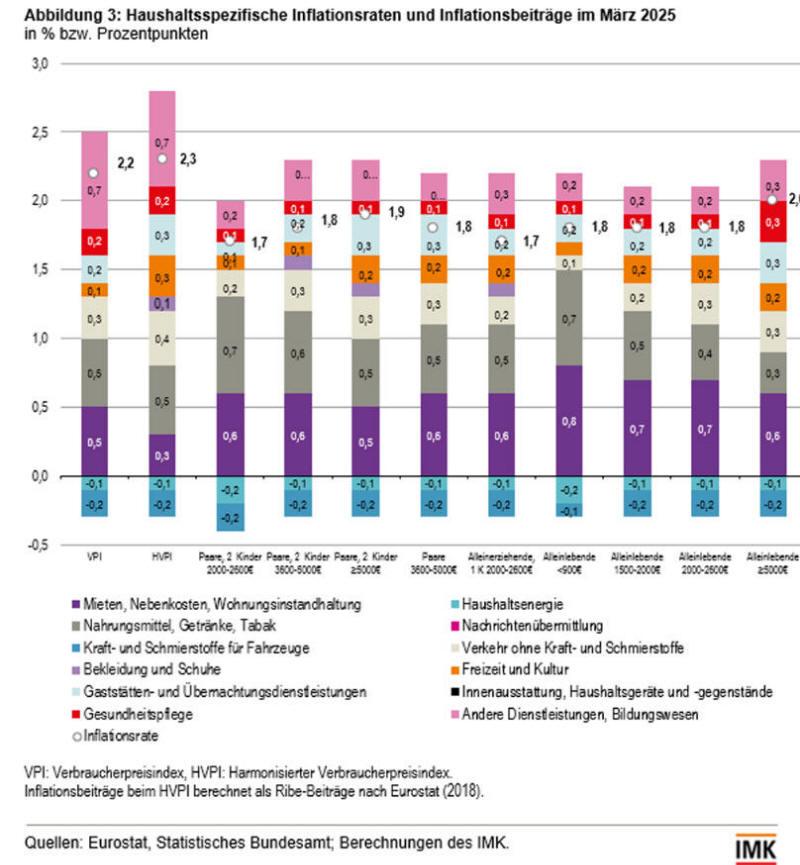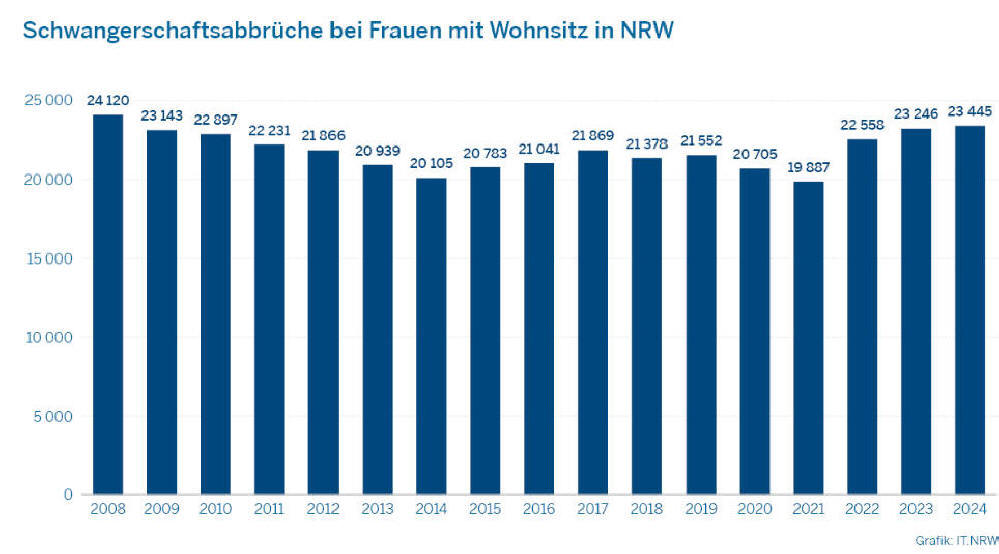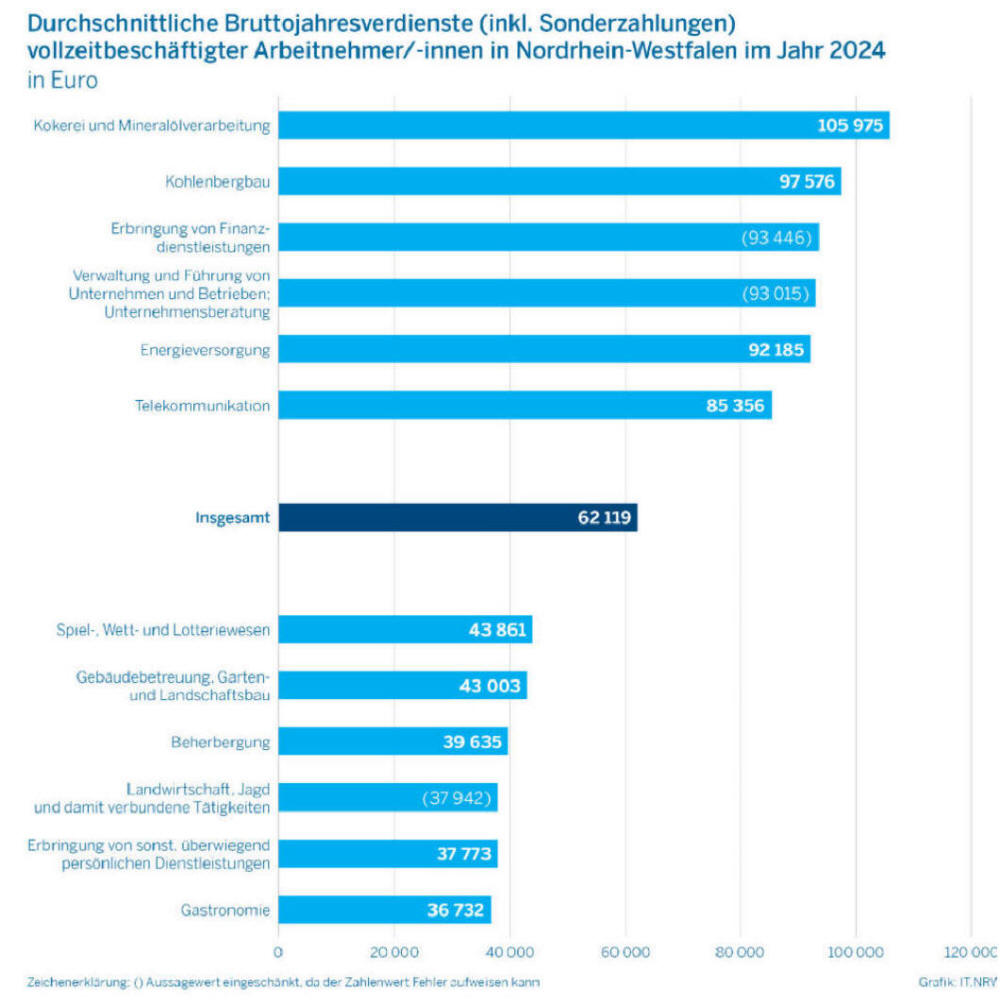|
Samstag, 26., Sonntag, 27. April 2025
Trauerbeflaggung
anlässlich des Todes von Papst Franziskus
Innenminister
Herbert Reul hat für Samstag, den 26. April
2025, anlässlich des Todes Seiner Heiligkeit
Franziskus, Papst der römisch-katholischen
Kirche, Oberhaupt der nichtstaatlichen
souveränen Macht des Heiligen Stuhls und
Staatsoberhaupt des Staates Vatikanstadt für
alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie der übrigen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes
unterliegen, Trauerbeflaggung angeordnet.
Berlin: TÜV-Verband begrüßt EU-Vorschläge
für mehr Fahrzeugsicherheit
Aktualisierung der Prüfvorgaben für
Elektrofahrzeuge und Assistenzsysteme ist
überfällig. Prüforganisationen erhalten Zugang
zu sicherheitsrelevanten Fahrzeugdaten.
Jährliche Prüfung älterer Fahrzeuge leistet
Beitrag zur Verkehrssicherheit. Erweiterung der
Abgasprüfungen verringern schädliche Emissionen
für Mensch und Umwelt.
Neue EU-Vorschriften: Jährliche Kontrollen: Für
Pkw und Transporter, die älter als zehn Jahre
sind - Abstimung Rat und Parlamen notwendig
Zu den aktuellen Vorschlägen der EU-Kommission
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, weniger
Luftverschmutzung und Fahrzeugdaten sagt Richard
Goebelt, Bereichsleiter Fahrzeug und Mobilität
beim TÜV-Verband:
„Der TÜV-Verband
begrüßt die Vorschläge der EU-Kommission für die
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in
Europa. Die Reform adressiert zentrale
Herausforderungen im Bereich der
Verkehrssicherheit und der Erreichung der Vision
Zero, indem sie die Prüfpflichten modernisiert
und den Fokus stärker auf sicherheits- und
emissionsrelevante Defizite lenkt.
Eine
Aktualisierung der Prüfvorgaben für
Elektrofahrzeuge und Assistenzsysteme ist längst
überfällig. Die neuen Regelungen sehen vor, dass
künftig auch Hochvolt-Komponenten von Elektro-
und Hybridfahrzeugen sowie elektronische
Sicherheitsfunktionen wie Fahrerassistenzsysteme
(ADAS) systematisch in die Hauptuntersuchung
einbezogen werden.
Damit wird
sichergestellt, dass die sicherheitsrelevanten
Systeme auch über die gesamte Lebensdauer eines
Fahrzeugs hinweg zuverlässig funktionieren.
Diese Erweiterung ist notwendig, da der
derzeitige Prüfumfang nicht mit dem
technologischen Fortschritt Schritt gehalten
hat.“
„Besonders begrüßenswert ist der
geplante EU-weite digitale Datenaustausch über
die MOVE-Hub-Plattform. Der TÜV-Verband
unterstützt das Ziel der EU-Kommission, die
Fahrzeug- und Prüfdaten europaweit besser zu
vernetzen und die Nachverfolgbarkeit von
Fahrzeughistorien sowie die Bekämpfung von
Tachomanipulation zu ermöglichen. Diese digitale
Vernetzung stärkt nicht nur die Sicherheit auf
unseren Straßen, sondern senkt auch
Bürokratiekosten und erleichtert die
Umschreibung von Fahrzeugen beim Wechsel in ein
anderes EU-Land erheblich.“
„Der
TÜV-Verband begrüßt ausdrücklich, dass die
EU-Kommission in ihrer Reform vorsieht, den
Zugang zu sicherheits- und emissionsrelevanten
Fahrzeugdaten zu standardisieren und gesetzlich
zu verankern. Hersteller sollen verpflichtet
werden, alle notwendigen technischen
Informationen – inklusive Softwareversionen,
Diagnosecodes, Zugang zur elektronischen
Schnittstelle des Fahrzeugs und relevante
Warnanzeigen – kostenfrei, diskriminierungsfrei
und maschinenlesbar bereitzustellen.
Nur
so können Prüfstellen ihrer Aufgabe nachkommen,
auch moderne Fahrzeuge mit komplexer Elektronik
und digitalen Assistenzsystemen vollumfänglich
zu überprüfen. Das schafft Rechtssicherheit,
fördert die Gleichbehandlung aller Marktakteure
und schützt letztlich auch Verbraucherinnen und
Verbraucher – zum Beispiel bei der Entdeckung
manipulierter Software oder bei nicht
funktionierenden Sicherheitssystemen.“
„Der TÜV-Verband unterstützt die Überlegungen
der EU-Kommission, die Prüffristen für ältere
Fahrzeuge anzupassen. Eine jährliche
Hauptuntersuchung von Pkw und leichten
Nutzfahrzeugen, die älter als zehn Jahre sind,
trägt zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Das
Durchschnittsalter des Pkw-Bestands in
Deutschland steigt seit Jahren kontinuierlich
und liegt aktuell bei 10,3 Jahren.
Die
alternde Fahrzeugflotte spricht einerseits für
eine höhere Langlebigkeit der Fahrzeuge, auf der
anderen Seite stellt sie eine Herausforderung
für die Verkehrssicherheit dar. Die Mängelquoten
bei der Hauptuntersuchung (HU) steigen mit dem
Alter der Fahrzeuge erheblich an. In der
Altersgruppe der zehn bis elf Jahre alten
Fahrzeuge fällt bei der HU fast jedes vierte
Fahrzeug (23 Prozent) mit erheblichen oder
gefährlichen Mängeln durch. Insbesondere die
Halter älterer Autos sind gefordert, regelmäßig
in die Wartung und Pflege ihrer Fahrzeuge zu
investieren.“
Derzeit erfolgt die erste
Hauptuntersuchung in Deutschland bei privaten
Pkw drei Jahre nach der Erstzulassung und
anschließend alle zwei Jahre. Die technische
Sicherheit von Mietwagen, Taxis,
Carsharing-Autos, Krankenwagen und anderen
Fahrzeugen für die Personenbeförderung wird in
der Regel jährlich überprüft.
„Ein
weiterer Meilenstein der Reform ist die
Erweiterung der Abgasprüfungen: Neben
klassischen Labortests werden künftig
Partikelanzahlmessungen und NOₓ-Kontrollen im
realen Fahrbetrieb (Real Driving Emissions)
verpflichtend in die Hauptuntersuchung
integriert. Damit wird sichergestellt, dass
Fahrzeuge nicht nur auf dem Rollenprüfstand,
sondern auch auf der Straße sauber bleiben.
Durch die verbindliche Nutzung von
On-Board-Diagnose-Daten (OBD) und gezielte
Remote-Sensing-Kontrollen lassen sich
Manipulationen und technische Defekte frühzeitig
erkennen.“
Die Vorschläge der
EU-Kommission sind der Auftakt zu einem
EU-Gesetzgebungsverfahren, bei dem das
EU-Parlament und die Mitgliedsländer eingebunden
werden. Dafür müssen drei Richtlinien
überarbeitet werden: Richtlinien über die
regelmäßige technische Kontrolle von Fahrzeugen
(PTI), die Zulassungsdokumente für Fahrzeuge und
die Unterwegskontrolle (RSI).
Neue Starkregen- und
Hochwasserschutz-App wird landesweit ausgerollt
Wie sicher ist das
eigene Zuhause vor Überflutung, Starkregen oder
Hochwasser? Die "H2OCH Wasser App/für’s Haus"
beantwortet jetzt diese Frage für alle Kommunen
im Ruhrgebiet und ganz Nordrhein-Westfalen.
Die Starkregen- und Hochwasserschutz-App der
Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft
und Lippeverband (EGLV) und der Ministerien für
Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
sowie für Umwelt, Naturschutz und Verkehr wurde
heute (25. April) landesweit ausgerollt.
Mit der App lassen sich nach Eingabe der
Adresse verschiedene Varianten – von einem
extremen bis außergewöhnlichen
Starkregenereignis sowie unterschiedliche
Hochwassersituationen – durchspielen. Angezeigt
wird schematisch nicht nur, welche Flächen
überflutet werden können, sondern auch, wie hoch
das Wasser an dieser Adresse stehen würde.
Möglich sind darüber hinaus auch drehbare
3D-Ansichten eines Wohnobjektes. In Form eines
Ampelsystems erfolgt eine Gefährdungsbeurteilung
der Immobilie bzw. des Grundstücks in Bezug auf
Überflutungen durch Starkregen und durch
Flusshochwasser.
idr - Informationen:
https://www.hochwasser-app.nrw/
Ein Zeichen für zukünftige
Generationen: Stadt Kleve ehrt Spenderinnen und
Spender von 11 Bäumen
Im Rahmen der Aktion „Mein Baum für
Kleve“ haben Bürgerinnen und Bürger elf Bäume an
die Stadt Kleve gespendet. Am Mittwoch, den
23.04. wurden die Urkunden feierlich durch
Bürgermeister Wolfgang Gebing überreicht. Seit
August des vergangenen Jahres läuft die
Baumspendeaktion „Mein Baum für Kleve“.
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen und
andere Zusammenschlüsse können im Rahmen der
Aktion Bäume für unsere Stadt spenden. Mit einer
Spende von 500 € werden der Einkauf und die
Pflanzung jeweils eines Baumes finanziert. Um
die weiteren Kosten und die Organisation der
Bewässerung sowie der Pflegeschnitte kümmert
sich die Stadt Kleve.
Bereits im Februar
wurden die Ende 2024 gespendeten Bäume im
Willibrordpark, am Spielplatz an der Eichenallee
und in dem Grünzug an der Berliner Straße
gepflanzt. Seither haben sie sich prächtig
entwickelt und zeigen aktuell ihr frisch
ausgetriebenes, hellgrünes Blätterkleid. Viele
der gepflanzten Arten werden bald blühen und
somit im weiteren Jahresverlauf eine
Lebensgrundlage für viele Insekten und Vögel
bilden.

Baumspenderinnen und Baumspender April 2025
Am Mittwoch, 23. April 2025, hat
Bürgermeister Wolfgang Gebing nun im
Willibrordpark vor den gespendeten Bäumen
feierlich die Urkunden an die Spender und
Spenderinnen übergeben.
In seiner
Dankesrede zu Beginn der Veranstaltung betonte
er die Bedeutung der gepflanzten Bäume: „Es ist
eine Sache, von der Wichtigkeit des
Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit zu
sprechen, doch es ist eine ganz andere, aktiv
Verantwortung zu übernehmen und konkrete Taten
folgen zu lassen. Und genau das haben all die
Personen getan, die heute hier sind. Sie haben
nicht nur ein Stück Natur geschenkt, sondern
auch ein Stück Zukunft für unsere Stadt, für
unsere Kinder und für kommende Generationen.“
Die Stadt Kleve bedankt sich bei der
Familie Egici, der Volksbank Kleverland, der
CDU-Ratsfraktion der Stadt Kleve, dem
Bundesverband Credit Management e.V., den
Eheleuten Hunck sowie der Sparkasse Rhein-Maas,
die im vergangenen Jahr einen oder sogar mehrere
Bäume gespendet haben.
Wer Interesse an
der Aktion hat und in diesem Jahr Bäume spenden
möchten, findet alle Informationen auf www.kleve.de/baumspenden.
Für Rückfragen ist die Stadt Kleve per E-Mail
unter umwelt@kleve.de oder per Telefon unter
02821/84-408 erreichbar.
Kleve: Flächenverfügbarkeit im Rahmen der
Landesgartenschau 2029
Der Zuschlag für die Landesgartenschau in Kleve
kam vor einem Jahr, im April 2024. Seitdem
wurden die gGmbH und der Förderverein gegründet,
die Bildmarke und das Erscheinungsbild
(corporate design) definiert, Umfragen und
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung initiiert
und die Auslobung der Planungswettbewerbe
vorbereitet – für die Innenstadt und die
dauerhaften Parkanlagen. Im Mai startet die
Bewerbungsphase. Mitte September entscheidet
eine Fachjury über die eingereichten Entwürfe
der Fachplaner.
„Vor allem das Thema
,Flächenverfügbarkeit‘ ist gegenwärtig viel
diskutiert und Aufhänger der Schlagzeilen.“ sagt
Marijke Noy, seit Anfang April zuständig für den
Bereich Kommunikation und Marketing. „Hierbei
ist die Unterscheidung zwischen den wesentlichen
Daueranlagen und ergänzenden, temporären
Erweiterungsflächen zu beachten.“
Inhalt
des Planungswettbewerbs sind ausschließlich die
Daueranlagen, also die Flächen, die auch nach
2029 bestehen bleiben und nicht zurück gebaut
werden. Alle hierfür -schon in der
Bewerbungsphase benannten- relevanten Areale
befinden sich in städtischem Eigentum. Auf dem
vorhandenen Gelände können alle Themen für eine
erfolgreiche Landesgartenschau problemlos
dargestellt werden.
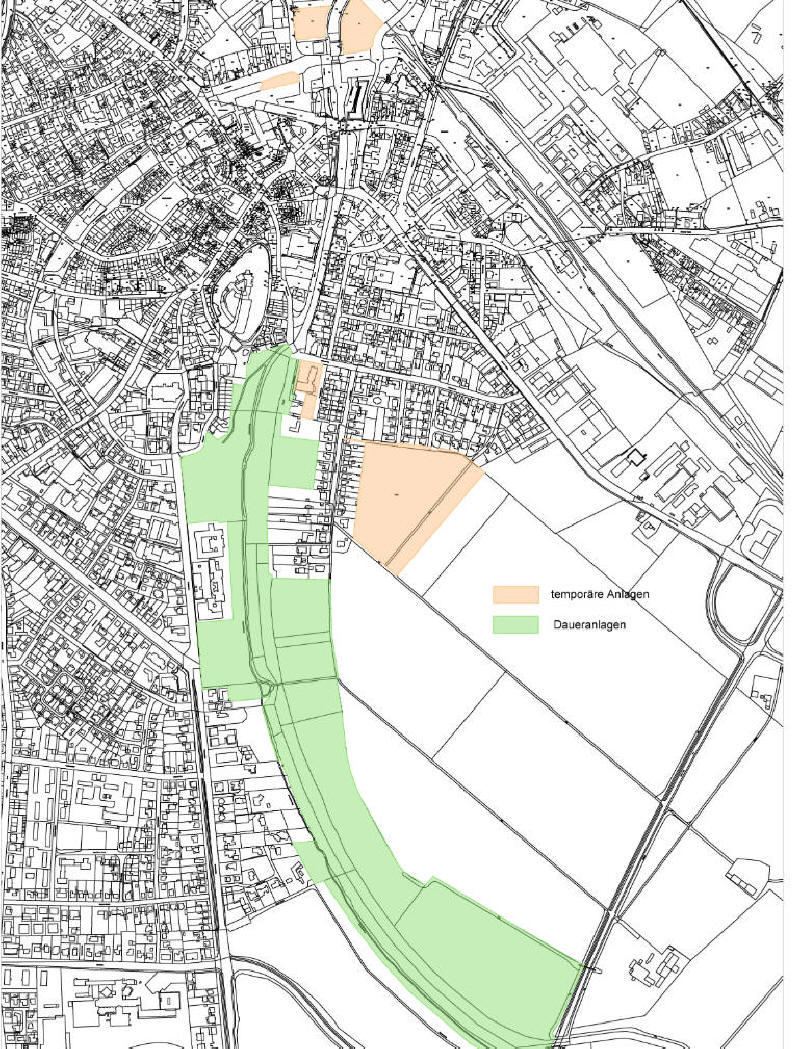
Karte Flächen Landesgartenschau Stand April 2025
Es ist richtig, dass in der Bewerbungsphase
Felder ins Auge gefasst wurden, die heute nicht
mehr Bestandteil der Planungen sind. Sowohl in
der Bewerbungsbroschüre als auch bei der
Begehung mit der Bewertungskommission wurde
transparent dargestellt, dass sich diese Flächen
in Privateigentum befinden. Wie zwischenzeitlich
bekannt ist, konnte über die Verpachtung dieser
Flächen trotz vielversprechender Vorgespräche
mit dem privaten Eigentümer in den konkreten
Verhandlungen keine Einigung erzielt werden.
Die betroffenen Flächen wären aufgrund ihrer
nur temporären Nutzbarkeit ohnehin nicht Teil
des Planungswettbewerbs gewesen. Sie waren für
die Umsetzung von Themengärten und zur
großflächigen Präsentation der (experimentellen)
Landwirtschaft angedacht. Für die Umsetzung von
Themengärten hat sich nach Vorlage eines
Bodengutachtens rund um das ehemalige Hallenbad
die Chance ergeben, die umliegenden Flächen im
Rahmen der Landesgartenschau zu entwickeln. Auch
diese Flächen befinden sich in städtischem
Eigentum.
Vorteil: die dann dauerhaft
aufbereiteten Anlagen können von den Bürgerinnen
und Bürgern über den Zeitraum der
Landesgartenschau hinaus genutzt werden. In
zentraler, naturnaher Lage -mit direktem Zugang
zum Wasser sowie schöner Szenerie mit Blick auf
die Schwanenburg- bringt das städtische
Flurstück beste Voraussetzungen für den Aufbau
öffentlicher Gartenstrukturen mit. Überdies
sollen auch bereits bestehende städtische
Parkanlagen einbezogen und aufgewertet werden.
Fazit: Die Daueranlagen der
Landesgartenschau in Kleve erfüllen mit einer
Gesamtfläche von 23 Hektar alle Anforderungen an
Landesgartenschauen in NRW. Die
Ausstellungsfläche wird durch zusätzliche,
temporär genutzte Flächen noch wesentlich größer
ausfallen.
Heinrich Sperling, Prokurist
und wichtiger Berater der gGmbH mit langjähriger
Erfahrung im Bereich Landesgartenschauen sagt
hierzu: „Der Erfolg einer Landesgartenschau ist
überdies nicht von der Größe der
Veranstaltungsfläche abhängig. Ausschlaggebend
sind die inhaltliche Qualität und die
Präsentation der Ausstellungselemente. Die
Landesgartenschau in Kleve hat alle
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Veranstaltung.“
Erste
Mobilstation im Stadtgebiet: Knotenpunkt für
Mobilitätsangebote am Klever Bahnhof
Mit der Aufstellung der letzten Beschilderungen
ist sie nun komplett: am Klever Bahnhof ist die
erste Mobilstation im Stadtgebiet entstanden.
Mobilstationen verknüpfen verschiedene
Verkehrsmittel an einem Ort und ermöglichen
Fahrgästen so, flexibel zwischen ÖPNV,
Sharingangeboten und Co. zu entscheiden.

Nun steht auch die Beschilderung: Kleves erste
Mobilstation ist jetzt komplett.
Auch am
Bahnhof in Kleve werden mit der Mobilstation
alle wesentlichen Verkehrsmittel vernetzt und
vereint. Dort treffen Bus, Bahn, Rad, Auto samt
Car-Sharing, Taxiständen und einem großen
Park-and-Ride-Parkplatz sowie wesentliche
fußläufige Verbindungen in die Klever Innenstadt
aufeinander.
Durch die Fertigstellung
der Radstation in unmittelbarer Bahnhofsnähe hat
die Mobilstation im vergangenen Jahr ein hohes
Maß an Komfort hinzugewonnen. Neben sicheren
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie
Schließfächer samt Akku-Ladestationen beheimatet
die Radstation eine öffentliche und
barrierefreie WC-Anlage. Ergänzt wird das
dortige Angebot um die Fahrradwerkstatt
„Drehmoment“ des Berufsbildungszentrums Kreis
Kleve e.V.
Zuletzt hatten der
Mobilstation noch Wegweiser und letzte
Beschilderungen gefehlt, die nun aufgestellt
werden konnten. Kernstück des Leitsystems ist
eine große Stele, die alle Angebote der Station
auf einen Blick zusammenfasst. Sie dient der
Kenntlichmachung der Mobilstation im
Verkehrsraum und informiert die Kleverinnen und
Klever, aber auch Besucherinnen und Besucher der
Stadt zu den vielfältigen Dienstleistungen rund
um das Thema vernetzte Mobilität. Zusätzliche
Wegweiser zeigen den Fahrgästen insbesondere den
Weg zur Radstation auf.
Die Gestaltung
der Stele sowie der Wegweiser folgt einem
NRW-weit einheitlichen Design des
Landesprogrammes mobil.nrw, einer
Gemeinschaftskampagne des
NRW-Verkehrsministeriums sowie der
Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde im
Bundesland. Fahrgäste werden dadurch in ganz
Nordrhein-Westfalen mit denselben leicht
verständlichen Piktogrammen, denselben Farben
und Logos über die Verkehrsangebote des
jeweiligen Standortes informiert.
Die
Errichtung der Mobilstation wurde durch den
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefördert. Alle
Details zur Radstation
Wer sich für die
Angebote der Radstation am Bahnhof interessiert,
findet alle Informationen hierzu in unserer
Vorstellung der Radstation aus dem vergangenen
Jahr: Alles rund um’s Fahrrad: Radstation am
Klever Bahnhof eröffnet!
Moers: Neue
Energie- und Wassernetze in der Innenstadt
Durch ein Materiallager fallen in der Meerstraße
einige Stellplätze weg
Der Start der Sanierung der Moerser Innenstadt
nimmt Fahrt auf. Bevor im nördlichen Bereich der
Fieselstraße Mitte Mai die erste Kanalsanierung
in offener Bauweise ansteht, wird die ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) hier bereits
ab der kommenden Woche mit vorbereitenden
Maßnahmen beginnen.
Ein Teil der
Fieselstraße und später auch die Straße Im
Rosen-thal bekommen in vier Bauabschnitten bis
Ende Juni neue Energie- und Wasserleitungen.
„Bei der Maßnahme erneuern wir gleichzeitig auch
die Hausanschlüsse“, sei dies laut
Projektleiterin Diane Schiffer Teil des gesamten
Sanierungskonzeptes.
Ab Montag, 5.
Mai, startet die Baumaßnahme an der Einmündung
der Haag- zur Fieselstraße. Ab dort wird sich
Enni dann in jeweils nur rund 15 Meter langen
Baufeldern Richtung Rosenthal vorarbeiten.
„Durch die kleinen Bauabschnitte werden Anwohner
nur gering beeinträchtigt. Die Feuerwehrzufahrt
und weitgehend auch die Zufahrt der
Privatfahrzeuge bleibt in der sehr engen Straße
möglich.“
Erst im dritten Bauabschnitt
biegt die Baustelle dann in das Rosenthal ein.
Hier verlegt Enni neben Strom und Wasser auch
eine neue Gasleitung. Bereits vor Beginn der
eigentlichen Arbeiten wird Enni einen Teil des
Parkplatzes in der Meerstraße gegenüber dem Haus
am Park für ein notwendiges Baumateriallager
sperren und die Baustelle einrichten.
„Hierdurch fällt ab dem 28. April für die
gesamte Bauzeit die Hälfte der Stellplätze weg“,
sagt Schiffer. Bis dahin sind alle direkt
betroffenen Anwohner schriftlich über die
Baumaßnahme informiert. Vertreter der Stadt und
der Feuerwehr waren in die Planungen
eingebunden. Fragen beantwortet wie gewohnt das
Enni-Baustellentelefon unter 02841 104-600.
Schon mal ein E-Lastenrad
gefahren? Die Cargobike Roadshow kommt nach
Wesel
Ob Kinderbeförderung, Einkauf
oder Ausflug – Lastenräder liegen im Trend und
haben ein großes Potenzial für die
Verkehrswende. Bei der Cargobike Roadshow können
Fahrspaß und Vorteile von Lastenrädern ganz
praktisch „erfahren“ werden.
Am Dienstag, 13. Mai 2025, gastiert das Team der
Cargobike Roadshow auf Einladung der Stadt Wesel
auf dem Großen Markt und bietet dort zwischen 13
und 18 Uhr allen interessierten Bürger*innen
seinen Fuhrpark an E-Lastenrädern zum Testen an
(offizielle Eröffnung um 13 Uhr).
Ausgestellt werden zwölf unterschiedliche
E-Lastenräder von zwölf Herstellern. Dabei sind
sowohl zwei- als auch dreirädrige Modelle,
Marktneuheiten und Klassiker. Dazu gibt es eine
hersteller- und händlerneutrale Beratung durch
das Roadshow-Team.
Die Cargobike
Roadshow wurde 2016 von unabhängigen
Lastenrad-Experten ins Leben gerufen und wird
inzwischen von der Berliner
Verkehrswende-Agentur cargobike.jetzt
organisiert. Colin Pöstgens aus Essen ist einer
der Cargobike Roadshow-Gründer und sagt: „Die
vielen freudestrahlenden Gesichter nach der
ersten Testfahrt sind das Schönste an unserer
Roadshow. Die meisten wollen gleich noch eine
Runde drehen – vor allem die mitfahrenden
Kinder“.
Alle ausgestellten Testräder
haben einen E-Antrieb, der bis maximal 25 km/h
unterstützt und sind für die private Nutzung,
insbesondere für den Kindertransport,
ausgerüstet. Aber nicht nur Familien mit
(kleinen) Kindern sind zum Testen eingeladen.
Die meisten Testräder sind auch mit
Transportaufbauten erhältlich und somit
beispielsweise für Gewerbetreibende
interessant.
Wer möchte, darf gerne
seinen eigenen Helm mitbringen. Einige Weseler
Fahrradhändler sind ebenfalls der Einladung der
Stadt Wesel gefolgt und präsentieren an diesem
Nachmittag ihr eigenes Angebot an Lastenrädern
auf dem Großen Markt. Organisiert wird die
Veranstaltung vom Klimaschutzmanagement der
Stadt Wesel, welches ebenfalls mit einem
Infostand vor Ort sein wird.
Für die
Weseler Bürger*innen sind das Testangebot und
die Beratung der Cargobike Roadshow kostenlos.
Vorerfahrungen mit Lastenrädern sind nicht
erforderlich. Für Testfahrten muss lediglich ein
Lichtbildausweis vorgelegt werden. Weitere
Informationen zum Veranstalter finden
Interessierte auf der Internetseite der
Cargobike Roadshow unter cargobike.jetzt
Wesel: Ranger-Spaziergänge im
Jubiläumsjahr – Natur erleben, verstehen und
respektieren
Im Rahmen des
Jubiläumsjahres „50 Jahre Kreis Wesel“ laden die
Ranger des Kreises Wesel in Zusammenarbeit mit
der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel
zu besonderen Spaziergängen in ausgewählten
Schutzgebieten ein. Interessierte Bürgerinnen
und Bürger haben dabei die Gelegenheit, die
spannende Arbeit der Ranger kennenzulernen und
mehr über die vielfältige Natur im Kreis Wesel
zu erfahren.
Bereits seit 2019 besteht
eine Kooperation zwischen dem Regionalverband
Ruhr Grün und der Unteren Naturschutzbehörde zum
Einsatz von Rangern im Kreis Wesel. In 2023
wurde eine weitere Kooperation mit dem
Regionalforstamt Niederrhein ins Leben gerufen.
Die insgesamt vier Ranger sind in den
Schutzgebieten des Kreises unterwegs, überwachen
sensible Bereiche und stehen gleichzeitig als
Ansprechpartner für Erholungssuchende zur
Verfügung. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer
Arbeit liegt auf der Aufklärung und dem
respektvollen Miteinander von Mensch und Natur.
Bei den geführten Spaziergängen geben die
Ranger spannende Einblicke in ihre tägliche
Arbeit, berichten von Begegnungen im Gelände und
beantworten Fragen rund um Naturschutz,
Artenvielfalt und den richtigen Umgang mit der
Natur. Unterstützt werden sie dabei von Förstern
sowie Mitarbeitenden der Unteren
Naturschutzbehörde des Kreises Wesel.
Die
Teilnahme ist kostenlos aber auf 30 Teilnehmende
je Termin beschränkt. Eine vorherige Anmeldung
ist erforderlich (siehe Termine). Weitere
Informationen zu den Treffpunkten, den Inhalten
der Spaziergänge und der Anmeldung finden
Interessierte unter:
kreis-wesel.de/50-jahre-kreis-wesel
Die
Termine im Überblick:
Licht und Schatten -
Die geheimnisvolle Schönheit des Dämmerwaldes
Samstag (10.05.2025) von 9.00 – 12.00 Uhr
Naturschutzgebiet Dämmerwald, Parkplatz
„Wildnistor Dämmerwald“
Zur Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013409
und
Samstag (10.05.2025) von 13.00 – 16.00
Uhr
Naturschutzgebiet Dämmerwald, Parkplatz
„Wildnistor Dämmerwald“
Zur Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013415
Land, Wasser, Kies - Die zurückeroberte
Wildnis des Orsoyer Rheinbogens
Samstag
(31.05.2025) von 9.00 – 12.00 Uhr
Naturschutzgebiet Orsoyer Rheinbogen, Parkplatz
„LINEG-Kläranlage Ossenberg“
Zur Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013487
und
Samstag (31.05.2025) von 13.00 – 16.00
Uhr
Naturschutzgebiet Orsoyer Rheinbogen,
Parkplatz „LINEG-Kläranlage Ossenberg“
Zur
Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013489
Könige der Lüfte und des Wassers - Die
atemberaubende Vielfalt der Bislicher Insel
Samstag (05.07.2025) von 9.00 – 12.00 Uhr
Naturschutzgebiet Bislicher Insel, Parkplatz
„Naturforum Bislicher Insel“
Zur Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013491
und
Samstag (05.07.2025) von 13.00 – 16.00
Uhr
Naturschutzgebiet Bislicher Insel,
Parkplatz „Naturforum Bislicher Insel“
Zur
Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013493
Sand, Moor und Heide - Die
abwechslungsreiche Heimat des fliegenden
Hirsches, der Moosjungfer und des Moorfrosches
Freitag (01.08.2025) von 9.00 – 12.00 Uhr
Naturschutzgebiet Diersfordter Wald, Parkplatz
„Diersfordter Wald“
Zur Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013494
und
Freitag (01.08.2025) von 13.00 – 16.00
Uhr
Naturschutzgebiet Diersfordter Wald,
Parkplatz „Diersfordter Wald“
Zur Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013495
Zentrum für Europäischen
Verbraucherschutz startet mit
grenzüberschreitender Rechtsdurchsetzung
Das Zentrum für Europäischen
Verbraucherschutz e. V. (ZEV) übernimmt eine
neue, zentrale Aufgabe: Als erste und einzige in
Deutschland zugelassene Einrichtung ist das ZEV
zur kollektiven, grenzüberschreitenden
Rechtsdurchsetzung in Europa befugt.

© Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.
V.
Das Team „Rechtsdurchsetzung in
Europa“ wird tätig, wenn deutsche
Verbraucherinnen und Verbraucher durch
systematische Rechtsverstöße von Unternehmen im
EU-Ausland in ihren Rechten benachteiligt werden
– insbesondere, wenn eine außergerichtliche
Einigung nicht erzielt werden kann.
Typische Fälle sind unzulässige
Vertragsbedingungen (AGB), intransparente oder
irreführende Gestaltung von Webseiten, Abofallen
oder unklare Kündigungsbedingungen.
Rechtsgrundlage für diese neue Befugnis ist die
EU-Verbandsklagenrichtlinie (EU 2020/1828) sowie
deren Umsetzung in deutsches Recht.
Das
ZEV wurde als einzige deutsche Einrichtung zur
Durchführung grenzüberschreitender
Verbandsklagen zugelassen und ist als
qualifizierte Einrichtung nach § 4d UKlaG in der
Liste des Bundesamts für Justiz (BfJ) geführt.
„Mit der Zulassung bietet sich für das
ZEV nun die Möglichkeit, Verstöße von
Unternehmen gezielt anzugehen und zu unterbinden
– wenn nötig auch vor Gericht“, sagt Jakob
Thevis, stellvertretender Vorstand des ZEV.
„Gleichzeitig gilt: Wir setzen weiterhin auf
außergerichtliche Einigungen, bevor wir
rechtlich gegen ein Unternehmen im Ausland
vorgehen.“

Das ZEV (Fußgängerbrücke Kehl/Straßburg als
Vereins-LOGO - Foto ZEV) folgt bei seiner
Tätigkeit einem klaren Prinzip: Feststellung
eines strukturellen Verbraucherproblems – z. B.
durch eine Beschwerde über das
Online-Formular. Prüfung und Versuch einer
außergerichtlichen Einigung mit dem Unternehmen.
Falls nötig: Klage - kommt keine
außergerichtliche Einigung zustande, kann das
ZEV rechtlich gegen das Unternehmen vorgehen.

Das Bürogebäude des Vereins in der Bahnhofsplatz
3, 77694 Kehl - Foto ZEV
Wenn viele
Verbraucherinnen und Verbraucher geschädigt
sind, ist auch eine EU-Verbandsklage möglich.
Das ZEV arbeitet dabei eng mit dem Netzwerk der
Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net)
zusammen. Wie sich die neue Rolle des ZEV auf
das Verhalten von Unternehmen auswirken wird,
bleibt abzuwarten – erste konkrete Schritte
gegen Unternehmen im EU-Ausland sind bereits in
Planung.

Genauere Informationen zum Thema
Rechtsdurchsetzung und EU-Sammelklagen stellt
das ZEV auf seiner Website zur Verfügung. Dort
wird künftig auch über laufende Verfahren
informiert und darüber, ob und wie sich
betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher
einer Klage anschließen können. Weitere
Informationen:
www.cec-zev.eu/de/themen/eu-sammelklage/
Im Reich der Burgen und
Schlösser
Die spannende Geschichte
des Niederrheins zeigt sich in beeindruckenden
Bauten.
Wer hat nicht als Kind davon
geträumt, als Ritter oder Prinzessin in einem
prächtigen Schloss zu wohnen oder eine wehrhafte
Burg zu besitzen? Ehrwürdige Bauten aus längst
vergangenen Zeiten üben eine besondere
Faszination auf uns aus. Sie verströmen Historie
und erzählen Geschichten. Ihr bloßer Anblick
beflügelt die Phantasie. Am Niederrhein gibt es
dafür zahlreiche Beispiele, die zu einem Besuch
einladen.
Eine namhafte Bewohnerin
des Schlosses Moers war im 16. Jahrhundert
Gräfin Walburgis von Neuenahr-Moers. Sie hatte
jedoch kein Glück mit ihren Männern: Ihren
ersten Gatten köpften die Spanier, der zweite
kam bei einer Explosion ums Leben. Heute
empfängt sie – als Projektion natürlich – die
Gäste und begleitet sie durch die
Dauerausstellung im Schloss, der ehemaligen
Wasser-Burg der Grafen von Moers.
Die Silhouette der Stadt Kleve prägt die
Schwanenburg. Sie wurde 1020 erstmals urkundlich
erwähnt. Da die Klever Fürsten ihre Abstammung
vom Schwanenritter Elias (Lohengrin)
herleiteten, krönt heute noch ein Schwan die
Spitze des höchsten Turms. Heute befindet sich
im Schwanenturm ein geologisches Museum.
Außerdem bietet sich hier ein eindrucksvolles
Panorama über die Rheinebene bis in die
Niederlande. Sehenswert sind unter anderem die
beiden Portale im inneren Burghof und das
Stauferklo – eine Toilettenanlage aus dem 12.
Jahrhundert.

Blick über den Spoykanal mit blühenden
Kirschblütenbäumen und der Schwanenburg im
Hintergrund - Foto Stadt Kleve
Nicht weit
von Kleve liegt das Museum Schloss Moyland.
Bekannt ist es vor allem für seine
Beuys-Sammlung. Doch auch das historische
Wasserschloss- und Parkensemble mit einem der
größten Kräutergärten der Region, die
beachtliche Hortensiensammlung sowie der Blick
von der Aussichtsplattform des Nordturms lohnen
einen Ausflug.
In der Burggemeinde Brüggen
steckt das Wahrzeichen schon im Namen.
Mitte des 14. Jahrhunderts baute man die Burg zu
einer Festung mit vier Türmen aus und stockte
die Gebäude zwischen den Türmen im 17.
Jahrhundert auf die heutige Höhe auf. Ab 1494
blieb die Burg Brüggen bis 1794 als Landesburg
nördlichste Grenzfestung des Herzogtums Jülich.
Seit 2000 beheimatet die Burg neben der
Tourist-Information, das Informationszentrum des
Naturparks Schwalm-Nette, das Museum Mensch &
Jagd und bildet das kulturelle Zentrum für
musikalische Veranstaltungen und
Kunstausstellungen.
Ebenfalls im
Kreis Viersen, in Kempen, findet sich die
kurkölnische Landesburg. In der historischen
Altstadt in ihrem Schatten begegnet den
Besuchern Geschichte auf Schritt und Tritt.
Für einen Familien-Ausflug besonders gut
geeignet, ist neben den oben genannten
Ausflugszielen auch die Radtour „Burgen- und
Schlösser-Route“, die gleich mehrere der
imposanten Bauten vereint. Sie führt, mit 50 km
vom Zentrum Kevelaers, über Schloss Haag
(Geldern), Burg Kervenheim (Kevelaer), Schloss
Kalbeck (Weeze), Schloss Hertefeld (Weeze) und
Schloss Wissen (Weeze) zurück zum Ausgangspunkt.
Zur Burgen- und Schlösser-Route:
https://www.niederrhein-tourismus.de/tour/burgen-und-schloesser-route-62fc5224db

Das Moerser Schloss gehört zu den prächtigsten
Bauwerken am Niederrhein. Foto: Stadt Moers

Jedes
6.Todesopfer im Straßenverkehr 2024 war mit dem
Fahrrad unterwegs
• Die Zahl der
getöteten Radfahrenden nimmt gegen den Trend zu,
bei Pedelec-Nutzenden ist der Anstieg besonders
hoch
• Knapp zwei Drittel aller tödlich
verunglückten Radfahrenden sind 65 Jahre oder
älter
• An mehr als zwei Drittel der
Fahrradunfälle mit Personenschaden sind weitere
Verkehrsteilnehmende beteiligt, am häufigsten
sind es Autofahrer/- innen
Nicht erst
seit dem E-Bike-Boom nutzen immer mehr Menschen
das Fahrrad, um von A nach B zu gelangen. Das
zeigt sich auch in den Unfallzahlen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war
im Jahr 2024 nach vorläufigen Ergebnissen jede
oder jeder sechste (16,0 %) im Straßenverkehr
Getötete mit dem Fahrrad unterwegs.
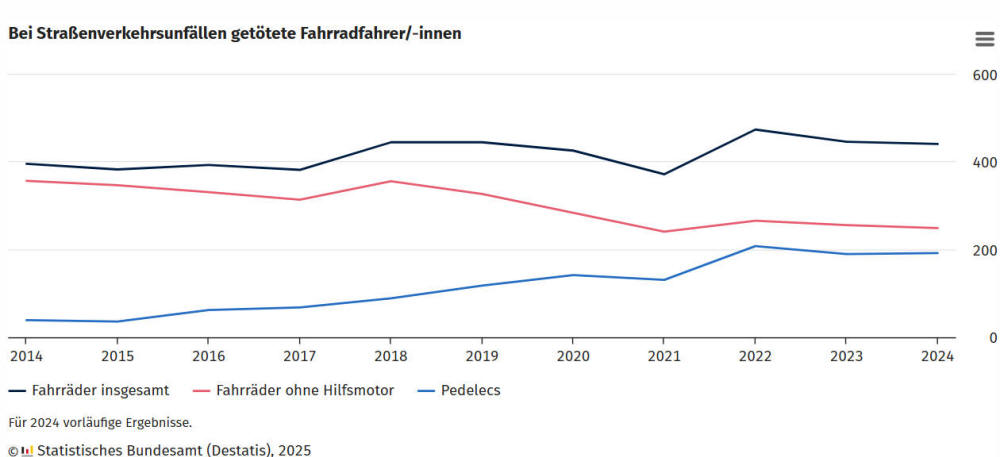
Insgesamt starben im
vergangenen Jahr 441 Radfahrerinnen und -fahrer
bei einem Unfall, darunter 192 mit einem Pedelec
– umgangssprachlich auch als E-Bike bezeichnet.
Die Zahl der getöteten Radfahrenden insgesamt
ist gegenüber 2014 um 11,4 % gestiegen. Der
Anstieg ist vor allem auf die steigende Zahl an
getöteten Pedelec-Nutzenden zurückzuführen
(2014: 39 Getötete). Dagegen lag die Zahl der
Verkehrstoten insgesamt im Jahr 2024 um 18,3 %
niedriger als zehn Jahre zuvor.
Ältere
Radfahrende besonders gefährdet
Ältere
Radfahrende sind im Straßenverkehr besonders
gefährdet. Unter den tödlich verletzten
Fahrradfahrerinnen und -fahrern waren 2024 knapp
zwei Drittel (63,5 %) 65 Jahre oder älter.
Während der entsprechende Anteil von
verunglückten Seniorinnen und Senioren mit
Fahrrädern ohne Hilfsmotor bei 59,4 % lag, waren
68,8 % der getöteten Pedelec-Fahrenden 65 Jahre
oder älter.
Autofahrerinnen und -fahrer
sind häufigste Unfallgegner von Radfahrenden
An einem Großteil (67,7 %) der
92 882 Fahrradunfälle mit Personenschaden war
eine zweite Verkehrsteilnehmerin oder ein
zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt. In 70,7 %
der Fälle war dies eine Autofahrerin oder ein
Autofahrer (44 424 Unfälle).
Radfahrende
bei rund der Hälfte der Fahrradunfälle mit
Personenschaden hauptschuldig Fahrradfahrerinnen
und -fahrer, die in einen Unfall mit
Personenschaden verwickelt waren, trugen
insgesamt an rund der Hälfte der Unfälle die
Schuld (50,7 %). Je nach Unfallgegnerin oder
Unfallgegner zeigen sich allerdings
Unterschiede:
Bei Unfällen mit
Fußgängerinnen und Fußgängern wurde der Person
auf dem Fahrrad häufiger (57,0 %) die
Hauptschuld angelastet.
Kollisionen mit
Krafträdern wurden in der Hälfte (50,2 %) der
Fälle von den Radfahrerinnen und -fahrern
verschuldet. Waren Autofahrerinnen oder -fahrer
beteiligt, trugen die Radfahrenden nur in 24,7 %
der Fälle die Hauptschuld. Bei Fahrradunfällen
mit Güterkraftfahrzeugen lag der Anteil noch
darunter: Nur zu 20,9 % wurde die Hauptschuld
bei der Radlerin oder dem Radler gesehen.
NRW-Baugenehmigungen – sieben
Prozent weniger Wohnungen genehmigt als im Jahr
zuvor
Im Jahr 2024 erteilten die
nordrhein-westfälischen Bauämter insgesamt
25 493 Baugenehmigungen – das waren 3,1 Prozent
bzw. 802 Baugenehmigungen weniger als im Jahr
2023. Wie das Statistische Landesamt anhand
endgültiger Ergebnisse mitteilt, wurden damit im
vergangenen Jahr 29,3 Prozent bzw. 10 565
Baugenehmigungen weniger erteilt als noch vor
zehn Jahren (2015). Z
urückzuführen ist
dieser Rückgang vor allem auf die erteilten
Baugenehmigungen für Wohnneubauten – hier
beträgt der Rückgang 55,8 Prozent: 2024 wurden
8 934 neue Wohngebäude genehmigt – 2015 waren es
noch 20 203. Baugenehmigungen für Wohnungen auf
dem niedrigsten Stand seit 2012 2024 wurden
insgesamt 40 554 Wohnungen genehmigt. Das waren
3 049 bzw. sieben Prozent weniger als im Jahr
2023.
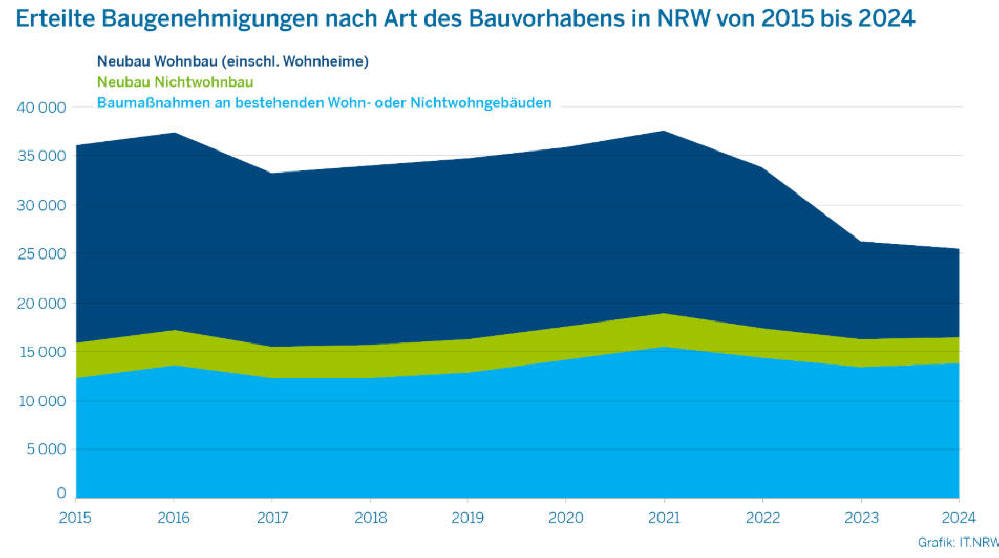
Dabei sank die Zahl der genehmigten
Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden mit
drei und mehr Wohnungen um 5,5 Prozent (−1 366
Wohnungen) auf 23 427 und bei Ein- und
Zweifamilienhäusern um 10,4 Prozent (−816
Wohnungen) auf 7 881 Wohnungen. Durch den Bau
von Wohnheimen sollen 1 414 Wohnungen entstehen
(Vorjahr: 2 077 Wohnungen) und in neuen
Nichtwohngebäuden (gemischt genutzte Gebäude,
die überwiegend nicht Wohnzwecken dienen) wurden
811 Wohnungen genehmigt (2023: 640 Wohnungen).
Die Zahl der genehmigten Wohnungen, die
durch Um- oder Ausbauten an bereits bestehenden
Gebäuden entstehen sollen, liegt bei 7 021
Wohnungen und damit um 5,1 Prozent unter dem
Wert des Vorjahres. Niedriger war die Zahl der
Baugenehmigungen für Wohnungen insgesamt zuletzt
im Jahr 2012 (39 989).
Baugenehmigungsquote differiert deutlich in den
Kreisen und kreisfreien Städten
Für das Jahr
2024 ermittelten die Statistikerinnen und
Statistiker eine Baugenehmigungsquote
(genehmigte Wohnungen je 10 000 Einwohner
bezogen auf die Einwohnerzahlen vom 30.06.2024)
von 22,3 für Nordrhein-Westfalen – im Jahr 2015
lag die Quote noch bei 31,6.
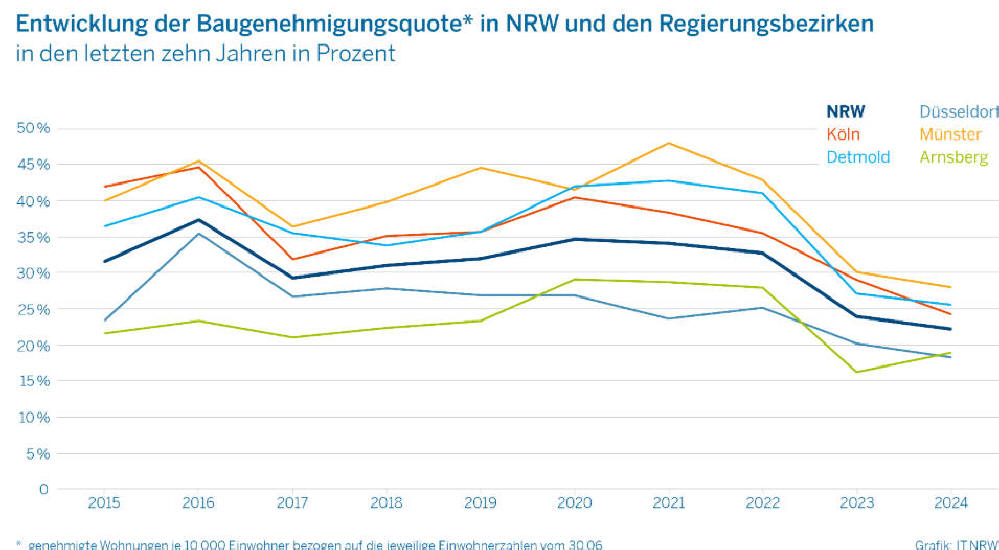
Die höchsten Genehmigungsquoten wiesen 2024
die Städte Münster (46,5) und Düsseldorf (43,2)
sowie der Kreis Paderborn (38,8) auf. Die
niedrigsten Quoten ergaben sich für die
kreisfreien Städte Oberhausen (5,6),
Gelsenkirchen (6,6), Krefeld (6,7) und Herne
(6,9).
Freitag, 25.
April 2025
Kleve:
Eichenprozessionsspinner hat jetzt wieder
„Saison“ - Umweltbetriebe bekämpfen
Eichenprozessionsspinner im Gebiet der Stadt
Kleve
Angesichts der zunehmenden Verbreitung des
Eichenprozessionsspinners werden die
Umweltbetriebe der Stadt Kleve (AöR) an
befallenen Eichen im kommunalen Eigentum die
alljährlichen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser
Schädlinge ergreifen.
Die Raupen sind für
den Menschen aufgrund ihrer Behaarung
gefährlich. Diese Behaarung kann bei Kontakt mit
der Haut Rötungen, Juckreiz, allergische
Reaktionen und Entzündungen auslösen.
DWD: Eichenprozessionsspinner:
Frühwarnsystem online

Mit einer Turbinenspritze besprüht ein Fahrzeug
der USK befallene Eichen im Stadtgebiet.
Die befallenen Eichen werden großflächig
besprüht. Dies erfolgt durch ein USK-eigenes
Fahrzeug, an dem eine sogenannte Turbinenspritze
angebracht ist. Die wässrige Lösung beinhaltet
den Wirkstoff Bazillus Thuringiensis. Diesen
Wirkstoff nehmen die Raupen mit der Nahrung auf.
Ihre Weiterentwicklung wird gestoppt und sie
gehen schließlich ein. Für Menschen, Tiere oder
Pflanzen ist das Mittel nicht schädlich.
Geplant ist die Maßnahme im April/Mai für ca. 2
Wochen in folgenden Gebieten:
Bereich
Zeitraum
Reichswalde 28.04.2025
Materborn
29.04. & 30.04.2025
Rindern, Düffelward,
Keeken 02.05.2025
Griethausen, Wardhausen,
Bimmen, Warbeyen 05.05. & 06.05.2025
Kellen
07.05. bis 09.05.2025
Forstgarten 12.05.2025
Witterungsbedingte Verschiebungen
(Niederschläge und starker Wind) können
Nacharbeiten notwendig werden lassen.
Notdienst immer erreichbar: Enni ist auch am
Maifeiertag im Einsatz
Die Enni-Unternehmensgruppe (Enni) ist auch am
kommenden Maifeiertag im Einsatz. Für besondere
Notfälle in der Energie- und Wasserversorgung
sowie der öffentlichen Kanalisation oder auf den
Moerser Straßen können Kunden am 1. Mai einen
Bereitschaftsdienst rund um die Uhr unter der
Moerser Rufnummer 02841/104-114 erreichen.
Die Kundenzentren bleiben naturgemäß an diesem
Feiertag geschlossen, öffnen ab dem Freitag
danach aber wieder zu gewöhnten Servicezeiten.
Moers: Geänderte Abfallabfuhr
durch Maifeiertag
Durch den
Maifeiertag verschieben sich auch in diesem Jahr
in einigen Bezirken des Moerser Stadtgebiets
wieder die Abfuhrtermine für Restabfall,
Altpapier, die gelben Säcke und Bioabfälle.
„Da die Abfuhr am Donnerstag, 1. Mai,
ausfällt, fahren die Entsorgungsfahrzeuge die
verbleibenden Bezirke dieser Woche jeweils einen
Tag später als üblich an“, so Ulrich Kempken,
dem bei Enni für die Entsorgung von Abfällen
zuständige Abteilungsleiter. Moerser sollten
deswegen darauf achten, dass Tonnen nicht voll
an Straßen stehen bleiben. Die regulären
Donnerstagsabfuhren werden die Müllwerker am
Freitag, 2. Mai, nachholen.
„Die
Freitagsleerungen holen wir dann am Samstag, 3.
Mai, nach und gehen dann ab dem darauffolgenden
Montag wieder in den normalen Turnus über.“
Kempken empfiehlt allen Moerser Bürgern gerade
vor Feiertagen stets in den Abfallkalender zu
blicken, in dem alle Veränderungen abgedruckt
sind. Für Smartphone-Nutzer bietet Enni auch
über die App „Meine Enni“ einen zusätzlichen
Erinnerungsservice.
Moers:
Rohrbrüche im Schmutzwasserkanal -
Schillerstraße wird rund sechs Wochen zur
Sackgasse
Bei einer
Routineuntersuchung mit einer Kamerabefahrung
hatte die ENNI Stadt & Service Niederrhein
(Enni) in der Schillerstraße in Moers-Eick
bereits im Vorjahr mehrere Rohrbrüche im
Schmutzwasserkanal entdeckt und einen Teil des
beschädigten rund 120 Meter langen Teilstücks
bereits ausgetauscht.
Ab Montag, 28.
April, geht Enni nun den zweiten Bauabschnitt an
und tauscht den Rohrstrang dann zwischen den
Hausnummer 68 und 72 aus. Da der beschädigte
Schmutzwasserkanal auch hier in rund drei Metern
Tiefe und in der Fahrbahnmitte liegt, wird die
Straße für die Bauzeit für den Durchgangsverkehr
erneut zur Sackgasse.
Fußgänger können
die Baustelle jederzeit passieren, Anlieger ihre
Häuser während der Arbeiten erreichen. Das
Baufeld können Anlieger in beiden
Fahrtrichtungen über die Lessingsstraße, den
Grillparzerweg und die Hebbelstraße umfahren.
Wie üblich hat Enni die Arbeiten auch hier mit
der Stadt Moers, der Polizei und der Feuerwehr
abgestimmt. Läuft alles nach Plan, soll der
Kanal am 6. Juni saniert sein. Fragen
beantwortet Enni unter der Rufnummer 104-600.
Stadt Wesel führt eigenes
Amtsblatt ein
Die Stadt Wesel geht
einen weiteren Schritt in Richtung moderner und
transparenter Verwaltung. Ab sofort gibt sie ein
eigenes Amtsblatt heraus. Das "Amtsblatt der
Stadt Wesel" dient als offizielles
Bekanntmachungsorgan und wird bei Bedarf
veröffentlicht. Damit stellt die Stadt sicher,
dass wichtige Informationen schnell und
zuverlässig Bürgerinnen und Bürger erreichen.
Das Amtsblatt ist ab sofort online unter
https://abi.wesel.de abrufbar. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, es als Newsletter per
E-Mail zu abonnieren. Dadurch wird ein
zeitgemäßer und komfortabler Zugang zu amtlichen
Bekanntmachungen geschaffen. Für alle, die eine
gedruckte Version bevorzugen, sind Exemplare
während der allgemeinen Öffnungszeiten an der
Information im Rathaus erhältlich.
Darüber hinaus ist das Amtsblatt zu den
jeweiligen Öffnungszeiten in der Bücherei der
Stadt Wesel (Ritterstraße 12-14, Centrum) sowie
in der Citywache (Fußgängerzone, Leyens-Platz)
erhältlich. Links
Amtsblatt & Bekanntmachungen
Kurt-Kräcker-Straße in Wesel bis August
voll gesperrt
Im Rahmen der aktuell
laufenden Bauphase muss die Kurt-Kräcker-Straße
auf Höhe der Eisenbahnüberführung bis
voraussichtlich Sonntag, 24. August 2025, für
alle Verkehrsteilnehmer*innen gesperrt werden.
Der Straßenverkehr wird während der Zeit über
den Kaiserring - Schermbecker Landstraße -
Kurt-Kräcker-Straße umgeleitet.
Die
Eisenbahnüberführung (EÜ) Kurt-Kräcker-Straße
wird im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke
zwischen Emmerich und Oberhausen komplett
erneuert. Für die Arbeiten ist die Errichtung
eines Traggerüstes im Bereich der EÜ
Kurt-Kräcker-Straße notwendig. Dadurch ist die
Durchfahrbarkeit auf eine Höhe von 3,80 Meter
begrenzt.
In den vergangenen Wochen ist
aufgefallen, dass trotz entsprechender
Hinweisschilder Lkw die maximal zulässige
Durchfahrtshöhe missachten. Da ein Anprall mit
dem Traggerüst lebensgefährlich ist, soll ein
Anprallbalken als Schutz an der Kreuzung
Dinslakener Landstraße - Kurt-Kräcker-Stracke
installiert werden.
ES wird alles
darangesetzt, die von den Bauarbeiten
ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu
halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen
und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich
ausschließen. Das Vorgehen ist mit der Stadt
Wesel, der Polizei sowie dem örtlichen
Rettungsdienst abgestimmt.
Wesel: Parkdeck an der Martinistraße am 24. und
25. April 2025 gesperrt – Ersatzparkplätze
vorhanden
Da das Parkdeck an der
Martinistraße gereinigt werden muss, wird es am
24. und 25. April 2025 gesperrt. Dabei werden
die Entwässerungsrinnen saubergemacht. Um einen
sicheren und reibungslosen Ablauf der Arbeiten
zu gewährleisten, ist während dieses Zeitraums
kein Parken auf dem Parkdeck möglich.

Alternativ darf auf dem Schulhof der Ida-Noddack
Gesamtschule (auf der Seite zum Parkdeck)
kostenfrei geparkt werden. Die Stadt Wesel
bittet um Verständnis für die vorübergehende
Sperrung des Parkdecks.
Kleve: Forstgartenkonzert mit den
Moyländer Musikanten am Sonntag, 27. April
Nach der erfolgreichen Eröffnung der
Forstgartenkonzerte 2025, lädt die Stadt Kleve
alle Musikliebhabenden zur nächsten
Veranstaltung der Konzertreihe im Blumenhof des
Forstgartens in Kleve ein.
Am 27. April
2025 um 15:00 Uhr präsentieren die Moyländer
Musikanten ein abwechslungsreiches Programm aus
Polka und traditioneller Volksmusik. Unter
freiem Himmel und inmitten der wunderschönen
Natur des Forstgartens erwartet die
Besucherinnen und Besucher ein ereignisreiches
Musikerlebnis.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist
kostenfrei und für ausreichend Sitzgelegenheiten
ist gesorgt – eine ideale Gelegenheit also, um
hoffentlich bei angenehmer Frühlingssonne einen
entspannten Nachmittag im Freien zu genießen.
Die Moyländer Musikanten werden mit ihren
schwungvollen Melodien garantiert für gute Laune
sorgen.
Eine vollständige
Programmübersicht der Forstgartenkonzerte 2025
samt Veranstaltungsflyer und weiterführenden
Informationen gibt es auf
www.kleve.de/forstgartenkonzerte.
Wissenschaftsforum
diskutiert Wege zu nachhaltiger Mobilität
Wie sich
wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele
auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität in
Einklang bringen lassen, diskutieren rund 400
Experten beim Wissenschaftsforum Mobilität am
15. Mai im Duisburger CityPalais. Auf dem
Programm stehen zwei prominent besetzte
Podiumsdiskussionen und mehr als 60
Fachvorträge.
Mit seinem breiten
Themenspektrum – von modernen
Antriebstechnologien über Mobilitätskonzepte für
Stadt und Land bis hin zu digitalen Services,
Wettbewerbsstrategien und KI-gestützten Lösungen
– will das Forum nicht nur den
wissenschaftlichen Austausch fördern, sondern
auch praxisnahe Impulse setzen. Organsiert wird
die Veranstaltung von der Universität
Duisburg-Essen. idr
nfos:
https://www.wifo-mobilitaet.de
Wasserstoff-Initiative "TransHyDE
2.0"
Mit dem Ziel, die
europäische Wasserstoff-Infrastruktur
voranzubringen, startet am 6. Mai die Initiative
"TransHyDE 2.0" in Berlin. Zu den bundesweit
zwölf Partnern gehören aus dem Ruhrgebiet die
Fraunhofer-Einrichtung für
Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG
in Bochum, das Gas- und Wärme-Institut Essen,
die Mabanaft GmbH & Co. KG in Duisburg sowie das
Duisburger ZBT - Zentrum für
BrennstoffzellenTechnik.
Das Vorhaben
ist die Fortsetzung und Erweiterung des
Nationalen Wasserstoff-Leitprojekts "TransHyDE".
Jetzt ist die Industrie eingeladen, ihren
weiteren konkreten Entwicklungsbedarf
einzubringen und Umsetzungsprojekte koordiniert
auf den Weg zu bringen. Die Initiative versteht
sich als Nukleus neuer
Wasserstoff-Infrastrukturen, Beratungsplattform
für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie
als Vermittler zwischen Industrie und Forschung.
idr - Infos:
https://www.transhyde-2-0.de

Ein Großteil der importierten Seltenen Erden
kamen 2024 aus China
• Deutschland hat mengenmäßig 13 % weniger
Seltene Erden importiert als 2023
• Die
EU-Staaten importieren 46 % aller Seltenen Erden
aus China
Seltene Erden sind wichtige
Rohstoffe für die Herstellung vieler
Hochtechnologieprodukte wie Akkus, Halbleiter
oder Magnete für Elektro- Motoren. Der Abbau der
17 darunter gefassten Elemente erfolgt
allerdings kaum in Deutschland und der
Europäischen Union (EU) – umso größer ist die
Abhängigkeit vom Import.
Deutschland hat
im Jahr 2024 weniger Seltene Erden importiert
als im Jahr zuvor: Die eingeführte Menge der
begehrten Metalle ging von 5 900 Tonnen (Wert:
66,0 Millionen Euro) im Jahr 2023 auf 5 200
Tonnen (Wert: 64,7 Millionen Euro) im Jahr 2024
zurück, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt. Damit sank die Importmenge
um 12,6 %.
Den mengenmäßigen Höchststand
der vergangenen zehn Jahre hatten die Importe
2018 mit 9 700 Tonnen (Wert: 38,3 Millionen
Euro) erreicht. Im Jahr 2024 kam 65,5 % der
importierten Menge direkt aus China (3 400
Tonnen). Der Anteil ging damit leicht zurück:
2023 waren noch 69,1 % der importierten Menge
aus China gekommen.
Zweitwichtigstes
Herkunftsland war 2024 Österreich mit einem
mengenmäßigen Anteil an den Importen von 23,2 %
(1 200 Tonnen). Darauf folgte Estland mit 5,6 %
(300 Tonnen). In diesen beiden Ländern werden
Seltene Erden weiterverarbeitet, die
ursprüngliche Herkunft ist statistisch nicht
nachweisbar.
Einige der wichtigen
Rohstoffe kommen vollständig aus China
Bei
einigen der Seltenen Erden hat China als
Herkunftsstaat einen besonders hohen Anteil. So
kamen nach Deutschland importierte
Lanthanverbindungen 2024 zu 76,3 % aus China.
Diese Verbindungen, die unter anderem für die
Herstellung von Akkus genutzt werden, machten
gut drei Viertel der gesamten Importmenge
Seltener Erden aus.
Neodym, Praseodym
und Samarium, die unter anderem für
Dauermagneten in Elektro-Motoren verwendet
werden, wurden nahezu vollständig aus China
importiert. Die EU importiert 46 % der Seltenen
Erden aus China Wie Deutschland importiert auch
die EU Seltene Erden zu einem großen Teil aus
China.
Im Jahr 2024 wurden nach Angaben
der europäischen Statistikbehörde Eurostat
insgesamt 12 900 Tonnen an Seltenen Erden im
Wert von 101 Millionen Euro in
die EU Importiert. 46,3 % (6 000 Tonnen) dieser
Importe entfielen auf China. Der zweitwichtigste
Partner ist Russland mit einem Anteil von 28,4 %
(3 700 Tonnen), gefolgt von Malaysia mit 19,9 %
(2 600 Tonnen).
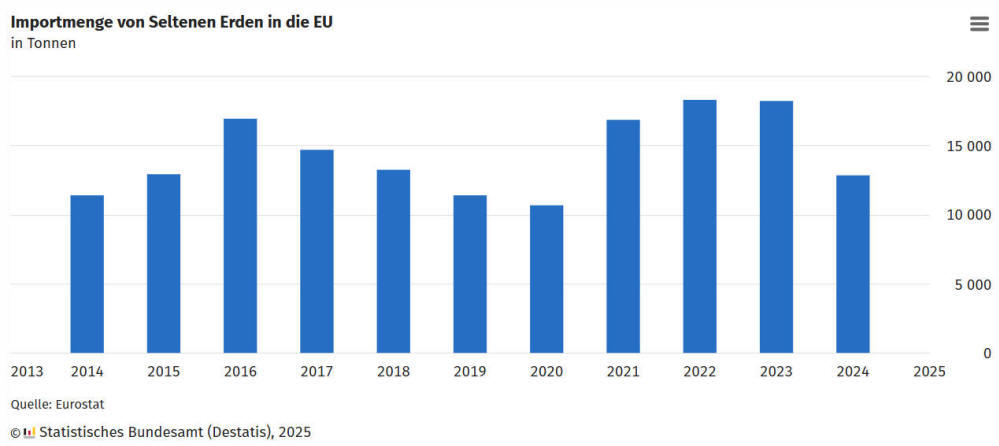
Die EU hat einige Rohstoffe zuletzt als strategisch
wichtig eingestuft. Dazu zählen aufgrund
ihrer Verwendung in Magneten die Seltenen Erden
Neodym, Praseodym, Terbium, Dysprosium,
Gadolinium, Samarium und Cer. Aufgrund der
strategischen Bedeutung sollen bis 2030 maximal
65 % des Bedarfs daran durch den Import aus
einem jeweiligen Staat gedeckt werden.
Dazu sollen unter anderem die Eigenproduktion
und das Recycling der Rohstoffe in
der EU gestärkt sowie die Bezugsquellen
diversifiziert werden. Bei einzelnen Seltenen
Erden liegt der Anteil Chinas an den Importen in
die EU allerdings noch deutlich höher.
So kamen 14,2 Tonnen von insgesamt 14,4 Tonnen
importiertem Neodym, Praseodym und Samarium 2024
aus China: das entsprach 97,7 %. Darüber hinaus
wurden 72,1 Tonnen und damit 99,3 % der
Importmenge an Cer und Lanthan aus China
eingeführt.
Absatzwert der
NRW-Industrieproduktion 2024 um über fünf
Prozent gesunken
Im Jahr 2024 sind in den 9 876 produzierenden
Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie des
Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden
zum Absatz bestimmte Waren im Wert von
317 Milliarden Euro hergestellt worden. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, war der
NRW-Absatzwert damit nominal um 17,2 Milliarden
Euro bzw. 5,1 Prozent niedriger als ein Jahr
zuvor.
Gegenüber dem Jahr 2019 stieg der
Absatzwert nominal um 23,0 Milliarden Euro bzw.
7,8 Prozent und gegenüber 2014 um
28,0 Milliarden Euro (+9,7 Prozent). Alle
Topbranchen in NRW mit rückläufigen Absatzwerten
Innerhalb der 29 Güterabteilungen war 2024 der
Bereich „Maschinen” mit einem nominalen
Absatzwert von 43,3 Milliarden Euro
(−6,7 Prozent gegenüber 2023) die wertmäßig
größte Güterabteilung in NRW.
Es folgten
die Herstellung von „Chemischen
Erzeugnissen&rdqupo; (40,5 Milliarden Euro;
−1,0 Prozent), „Nahrungs- und Futtermittel”
(39,1 Milliarden Euro; −2,2 Prozent) und
„Metalle” (38,4 Milliarden Euro; −7,6 Prozent).
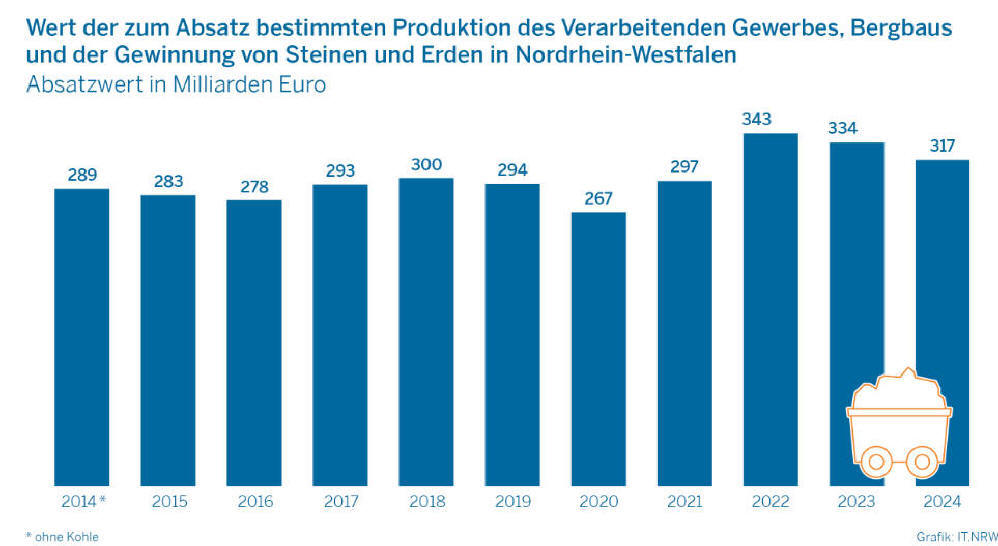
Der Absatzwert von „Metallerzeugnissen” lag
bei 30,2 Milliarden Euro (−7,3 Prozent) und der
von „Kraftwagen und Kraftwagenteilen” bei
17,4 Milliarden Euro (−7,2 Prozent). Höchster
Absatzwert im Kreis Gütersloh – niedrigster in
der kreisfreien Stadt Bonn Die Verteilung der
Industrieproduktion war 2024 in den kreisfreien
Städten und Kreisen unterschiedlich.
Den
höchsten Anteil am NRW-Absatzwert ermittelte das
Statistische Landesamt mit 5,9 Prozent für die
Betriebe im Kreis Gütersloh; 18,7 Milliarden
Euro wurden dort erzielt. Es folgten die
Betriebe im Märkischen Kreis (4,3 Prozent;
13,8 Milliarden Euro) und in der kreisfreien
Stadt Köln (4,2 Prozent; 13,2 Milliarden Euro).
Die geringsten Anteile erzielten mit jeweils
0,3 Prozent die Betriebe in den kreisfreien
Städten Herne (1,1 Milliarden Euro), Bottrop
(1,0 Milliarden Euro) und Bonn (0,8 Milliarden
Euro).
Donnerstag,
24. April 2025
Wesel: Asiatische Hornisse
wird zur etablierten Art herabgestuft – was das
bedeutet
Im Frühjahr 2025 wurde die Asiatische Hornisse
in Deutschland zu den etablierten Arten gemäß
Artikel 19 der EU-Verordnung 1143/2014
herabgestuft. Für diese Arten werden durch
Managementpläne Maßnahmen zur Eindämmung,
Kontrolle oder Beseitigung vorhandener
Populationen vorgegeben.
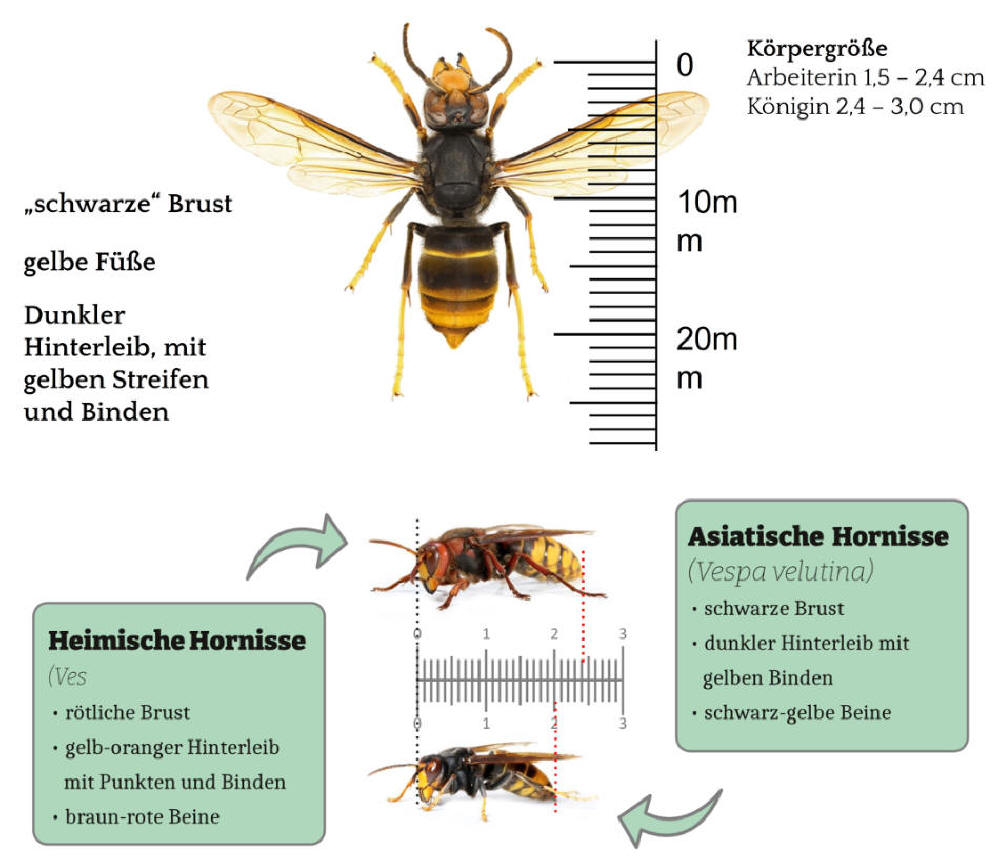
Damit wird eine Beseitigung der Nester der
Asiatischen Hornisse grundsätzlich nicht mehr
durch die Untere Naturschutzbehörde veranlasst.
Um dennoch einer weiteren Ausbreitung der
Asiatischen Hornisse entgegenwirken und eine
Unterscheidung von den heimischen Hornissenarten
sicherstellen zu können, bittet die Untere
Naturschutzbehörde weiterhin darum, die Sichtung
eines Nestes zu melden.
Hierbei sind
Kontaktdaten des Meldenden und der Standort des
Nestes zu nennen sowie ein Foto von Tier und
Nest zur weiteren Verifizierung beizufügen.
Diese Informationen sollen dann an das
Funktionspostfach hornissen-und-co@kreis-wesel.de gesendet
werden.


Jede meldende Person erhält eine Rückmeldung
zur weiteren Vorgehensweise. In den vergangenen
Jahren musste die Untere Naturschutzbehörde des
Kreises Wesel immer häufiger Nester der
Asiatischen Hornisse beseitigen lassen und
hierfür Fachfirmen beauftragen. Zuletzt waren im
Jahr 2024 insgesamt 35 Primärnester von
Bürgerinnen und Bürgern gemeldet worden.
In den nächsten Jahren ist mit einer
weiteren Zunahme zu rechnen. Bei derartig
rasanten Entwicklungen sehen die gesetzlichen
Vorgaben eine Herabstufung einer invasiven zur
etablierten Art vor. Gleichzeitig wird damit das
Vorgehen bei der Bekämpfung geändert und die
Verantwortung für die Beseitigung der Nester auf
mehrere Schultern verteilt.
Vorher fiel
die Asiatische Hornisse (Vespa Velutina) unter
den Geltungsbereich der EU-Verordnung 1143/2014
als prioritäre invasive Art. Dies bedeutete,
dass eine Ausbreitung dieser meldepflichtigen
Art durch eine schnellstmögliche Beseitigung
verhindert werden sollte. Hierfür war die Untere
Naturschutzbehörde verantwortlich.
Wesel: Ausfall des Wochenmarktes anlässlich
des Feiertages am 01.05.2025
Der Wochenmarkt in Wesel - Feldmark fällt am
Donnerstag, 01.05.2025,(Tag der Arbeit)
ersatzlos aus.
Anmeldung für
„Wesel liest“
„Wesel liest“ findet vom 15. bis zum 19.
September 2025 mit verschiedenen Stimmen an
besonderen Orten statt. Kindergärten, Schulen,
Vereine und Privatpersonen können sich bis zum
5. Mai 2025 bei der Stadtbücherei Wesel für
„Wesel liest“ anmelden.
Die Bücherei
verbindet jedes Jahr im September engagierte
Vorlesende, abwechslungsreiche Literatur und
außergewöhnliche Orte für eine lebendige
Lesekultur in der Stadt. Die Bücherei ist
erreichbar, telefonisch unter 0281/203-2355, per
E-Mail unter weselliest@wesel.de oder persönlich
vor Ort.
Führung „Kleve vor
und nach dem Zweiten Weltkrieg“ am 4. Mai
Das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich im
Mai zum 80. Mal. Aus diesem Anlass bietet die
Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve
GmbH (WTM) am Sonntag, den 4. Mai die Führung
„Kleve vor und nach dem Zweiten Weltkrieg“ mit
Stadtführerin Wiltrud Schnütgen an.
Nach dem Krieg war die Innenstadt zu 95 Prozent
zerstört, kulturelle Highlights waren
unwiederbringlich verloren. Auf dem Weg vom Haus
Koekkoek bis zur Schwanenburg wird - auch anhand
von Abbildungen - vermittelt, wie es im Kleve
der Vorkriegszeit aussah, wie danach das
städtische Leben wieder in Gang kam und welche
Bauwerke noch standen.
„Außerdem werden
wir klären, wo die Klever nach dem Krieg
erstmals wieder ins Kino konnten, welche Chancen
die Zerstörungen für den Wiederaufbau boten und
welche Ideen glücklicherweise doch nicht
umgesetzt wurden“, sagt Wiltrud Schnütgen.
Die ca. 90-minütige Führung beginnt um 11
Uhr am Koekkoekplatz. Die Teilnahmegebühr
beträgt 8 € pro Person und die Buchung ist
online auf www.kleve-tourismus.de
oder telefonisch bei der WTM unter 02821 84806
möglich.

Foto: Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg
(ehemaliges Krankenhaus, späteres Rathaus)
© Sammlung Wilms (Hendricks), Klevischer Verein
Kleve: Demokratie ist kein
Nazi - 80 Jahre Kriegsende, Befreiung und
Neuanfang Mi., 07.05.2025 - 19:00 -
Do., 08.05.2025 - 19:00 Uhr
Demokratie ist
kein Nazi! 80 Jahre Kriegsende, Befreiung und
Neuanfang
Eine Schauspieldokumentation von
Schülerinnen und Schülern der
Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kooperation mit dem
Stadtarchiv Kleve.

Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen der
Stadt Kleve zum 80-jährigen Ende des Zweiten
Weltkrieges haben sich Jugendliche intensiv mit
der Zeit des Nationalsozialismus und der
Zerstörung der Stadt auseinandergesetzt und
unter Anleitung des Regisseurs Marco Spohr eine
bewegende Schauspieldokumentation erarbeitet.
Sie geben in Episoden kurze Einblicke in
das damalige Geschehen. Was geschah hier vor Ort
in Kleve? Wie erlebte die Klever Bevölkerung das
Kriegsende?
Und was erleben die Schülerinnen
und Schüler in ihrem heutigen Schulalltag?
Dinslaken: Führung: Rundgang auf
dem Parkfriedhof
Am Donnerstag, 8.
Mai 2025, lädt Gästeführer Ronny Schneider zu
einem außergewöhnlichen Rundgang auf den
Dinslakener Parkfriedhof ein.
Friedhofswanderungen sind erlebte
Stadtgeschichte, Kunstgeschichte,
Personengeschichte, eben Gedächtnisgeschichte.
Ronny Schneider erläutert auf
interessante Art und Weise den Parkfriedhof mit
seiner parkähnlichen Anlage und ganz besonderen
Grabstätten. Die Führung dauert von 17:00 bis
18:30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro
pro Person und ist vor Ort direkt beim
Gästeführer zu entrichten.
Der
Treffpunkt zur Führung ist am Haupteingang des
Parkfriedhofs an der Willy-Brandt-Straße 86.
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und
wird vom Team der Stadtinformation am Rittertor
gerne entgegengenommen – telefonisch unter 02064
- 66 222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de.
Dinslaken: Poetry Slam im
Dachstudio
Am Freitag, 9. Mai 2025,
findet im Dachstudio der Dinslakener
Stadtbibliothek der nächste Poetry Slam statt.
Tobias Reinartz und Anna Conni moderieren die
beliebte Veranstaltung, übrigens die letzte vor
der Sommerpause. Wie immer gilt: Sechs
Künstler*innen erhalten die Gelegenheit, das
Publikum von sich und ihren Texten zu
überzeugen.
Die Regeln sind klar: Nur
selbst verfasste Texte dürfen vorgetragen
werden, Requisiten sind nicht erlaubt und es
gibt 6 Minuten Zeit pro Text. Die Veranstaltung
beginnt um 19.30 Uhr. Tickets sind nur an der
Abendkasse erhältlich, es gibt keinen
Vorverkauf. Der Eintritt beträgt 5 Euro, für
Schüler*innen und Student*innen gibt es einen
ermäßigten Eintritt von 2,50 Euro.
Wasserstoffhochlauf: Pragmatismus statt
Überregulierung– VDI legt Maßnahmenpakete vor
Der VDI ruft die Bundesregierung auf, den im
Koalitionsvertrag fest verankerten
Wasserstoffhochlauf zügig mit konkreten
Maßnahmen anzustoßen. Dazu präsentiert der
Verein zwei Maßnahmenpakete und konkrete
Handlungsempfehlungen.
Stillstand beim
Wasserstoffhochlauf? VDI fordert Kurswechsel mit
klaren Handlungsempfehlungen.
Trotz klar
formulierter Ziele zur Förderung von grünem
Wasserstoff der Bundesregierung sei in der
Praxis bislang zu wenig passiert, so das Fazit
beim heutigen Pressegespräch im Rahmen der
VDI-Initiative „Zukunft Deutschland 2050“. „In
erster Linie liegt das an fehlendem Pragmatismus
und einer Überregulierung beim Einsatz von
Wasserstoff“, so VDI-Direktor Adrian Willig.
„Der Koalitionsvertrag beinhaltet zwar
einige positive Signale – darunter schnellere
Genehmigungsverfahren – dennoch ist vieles noch
zu unkonkret. Zum Beispiel die weitere Förderung
von Wasserstoffnutzung und Erzeugung durch die
Reduktion der Abgabenlast.“
Prof. Michael
Sterner, VDI-Wasserstoffexperte und Professor an
der OTH Regensburg, bekräftigt: „Die
Champagnerdiskussion rund um den Einsatz von
Wasserstoff führt nicht ins Klimaziel. Wenn wir
weiterhin die Hürden so hoch stecken, das keiner
springt, kommen wir nicht voran. Wenn wir das
vor 25 Jahren beim EEG so gehandhabt hätten,
gäbe es die Photovoltaik in dieser Form heute
nicht: es wäre alles im Keim erstickt worden.“
Der VDI liefert mit seinen
Handlungsempfehlungen und Maßnahmenpaketen
fundierte, praxisnahe Vorschläge für einen
beschleunigten Wasserstoffhochlauf. Die
Maßnahmen adressieren sowohl das Mengen- als
auch das Erlösrisiko innerhalb des
Wasserstoffhochlaufs.
Henne-Ei-Problem
beim Hochlauf
Sterner erläutert die Hemmnisse
der Investitionen: „Der Hochlauf einer
Wasserstoffwirtschaft scheitert aktuell am
Henne-Ei-Problem: Sowohl potenzielle Erzeuger
als auch Anwender von grünem Wasserstoff und
seiner Derivate werden mit substanziellen
Abnahme- bzw. Versorgungsrisiken sowie hohen
Erlösrisiken konfrontiert.“ VDI-Direktor Adrian
Willig bekräftigt: „Es braucht jetzt eine
koordinierte politische Unterstützung, die beide
Risiken gezielt adressiert – und das über 2030
hinaus.“
VDI-Maßnahmenpakete für Politik
und Wirtschaft
Im Rahmen der VDI-Initiative
ist ein Zukunftsdialog Wasserstoff mit namhaften
Experten und Expertinnen entstanden.
Vorsitzender des Dialogs ist Prof. Michael
Sterner, Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat
der Bundesregierung. Stakeholder über die
gesamte Wertschöpfungskette hinweg wurden an
einen Tisch gebracht – darunter Vertreter aus
Behörden, Infrastruktur, Anwendung und
Erzeugung.
Das erste Maßnahmenpaket zielt
darauf ab, die Erzeugung von grünem Wasserstoff
zu fördern und ihn wettbewerbsfähig gegenüber
fossilen Energieträgern zu machen. Derzeit
stammen laut Energieversorgungsunternehmen nur
rund 5 % des in Deutschland produzierten
Wasserstoffs aus erneuerbaren Quellen. Das
zweite Paket stärkt die industrielle Nachfrage,
etwa durch den Aufbau eines Handels mit grünem
Wasserstoff.
Zu den weiteren Ergebnissen
zählen 28 Einzelmaßnahmen in Form von
Steckbriefen. Die Empfehlungen reichen von
Steuervergünstigungen über gezielte
Förderinstrumente wie Differenzkostenmodelle bis
hin zu einer Weiterentwicklung der THG-Quote und
Grüngasquote. Die gesamte Publikation kann hier
eingesehen werden.
Grüner Wasserstoff ist
laut dem Expertengremium ein Schlüssel zur
Defossilisierung der Industrie. Zudem benötigten
schwer elektrifizierbare Prozesse – etwa in der
Luft- und Schifffahrt sowie im Schwerlastverkehr
– Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe als
klimaneutrale Alternative. Für die saisonale
Speicherung erneuerbarer Energien – Stichwort
„Dunkelflaute“ – sei Wasserstoff und Power-to-X
ebenfalls unerlässlich.
Planungssicherheit und wettbewerbsfähige Preise
Wettbewerbsfähige Preise und Planungssicherheit
für industrielle Unternehmen bilden nach dem
Energieexperten Sterner die Basis. „Preis- und
Abnahmegarantien helfen dem Hochlauf. Nur wenn
Unternehmen verlässlich mit Wasserstoff planen
können, investieren sie in die nötige
Infrastruktur und Technologien.“
Der VDI
ruft Politik und Wirtschaft auf, die vorgelegten
Empfehlungen zu nutzen und den
Wasserstoffhochlauf systematisch zu gestalten.
„Unsere Empfehlungen stehen bereit. Wir erheben
kein Copyright darauf. Nutzen Sie unser
Know-how, damit aus Visionen endlich
Wirklichkeit wird“, appelliert der VDI-Direktor.

Seit 33
Jahren Exportüberschuss mit den Vereinigten
Staaten

• Zwischen 1950 und 1967 waren die USA
Deutschlands größter Warenlieferant
• 1968
erstmals Exportüberschuss im Handel mit den
Vereinigten Staaten
• 1991 letztmalig
Importüberschuss im Handel mit den Vereinigten
Staaten
Die von den Vereinigten Staaten
angedrohten zusätzlichen Zölle auf Waren aus der
Europäischen Union (EU) entspringen unter
anderem aus der kritischen Haltung der
US-Regierung gegenüber Europas Exportüberschuss.
Tatsächlich exportiert Deutschland als größte
Volkswirtschaft der EU bereits seit 33 Jahren
mehr Waren in die USA, als von dort importiert
werden. Den letzten Importüberschuss gab es im
Jahr 1991.
•
Zwischen 1950 und 1967
waren die USA Deutschlands größter
Warenlieferant
Von 1950 bis einschließlich
1967 hatte Deutschland mit den Vereinigten
Staaten jedes Jahr ein Handelsdefizit. Dieses
schwankte zwischen 1,9 Milliarden Euro und
0,2 Milliarden Euro. In diesem Zeitraum lagen
die USA durchgehend auf Rang 1 der wichtigsten
Lieferländer von deutschen Importen.
In
dieser Zeitspanne hatten die Importe aus den USA
tendenziell zugenommen. Lag ihr Wert in 1950
noch bei 0,9 Milliarden Euro, waren es 1967 rund
4,4 Milliarden Euro (+393,3 %). Der Anteil der
Importe aus den USA an den deutschen
Gesamtimporten schwankte in dieser Phase
zwischen 10,3 % und 18,5 %. Auch die Exporte in
die USA nahmen von 1950 bis 1967 zu.
Lag
ihr Wert in 1950 noch bei 0,2 Milliarden Euro,
waren es 1967 rund 4,0 Milliarden Euro
(+1 727,1 %). Der Anteil der Exporte in die USA
an den Gesamtexporten Deutschlands schwankte in
dieser Phase zwischen 5,1 % und 9,2 %. Dabei
waren die Vereinigten Statten niemals tiefer
platziert als auf Rang 7 der wichtigsten
Abnehmerländer für deutsche Exporte.
•
1968 erstmals
Exportüberschuss im Handel mit den Vereinigten
Staaten
Im Jahr 1968 gab es zum ersten Mal
einen deutschen Exportüberschuss
(+1,0 Milliarden Euro) im Handel mit den
Vereinigten Staaten, die erstmals nur noch auf
Rang 2 der wichtigsten Lieferländer Deutschlands
lagen. Seitdem erreichten die USA nie wieder
Rang 1, fielen aber auch nie tiefer als Rang 6.
Von 1972 bis zum Jahr 2024 lag der Anteil der
Importe aus den USA an den Gesamtimporten stets
unter 10 % und schwankte zwischen 5,4 % und
8,8 %.
Der Anteil der Exporte in die USA
an den Gesamtexporten im Zeitintervall 1968 bis
2024 schwankte zwischen 5,6 % und 10,9 % und
lässt demensprechend wenig Unterschiede zu den
Jahren von 1950 bis 1967 erkennen.
•
1991 letztmalig
Importüberschuss im Handel mit den Vereinigten
Staaten
Betrachtet man den Warenverkehr mit
den USA ab 1968, zeigen die Zahlen Folgendes:
Zuerst kommt die Phase zwischen 1968 und 1991
mit einigermaßen moderaten Salden, die zwischen
-2,1 Milliarden Euro und +14,5 Milliarden Euro
lagen.
1991 gab es zum letzten Mal einen
negativen Saldo (Importüberschuss) von
-0,3 Milliarden Euro. Ab 1992 stiegen wiederum
die Exporte in die USA tendenziell deutlich
schneller als die Importe von dort. Der deutsche
Exportüberschuss wurde immer größer: 2001
überschritt er erstmals die Marke von
20 Milliarden Euro, 2013 lag er zum ersten Mal
über 40 Milliarden Euro und seit 2022 liegt der
Saldo bereits drei Jahre in Folge über
60 Milliarden Euro.
•
2024 erreichte der Saldo
den Rekordwert von +69,8 Milliarden Euro. USA im
Jahr 2024 erstmals seit 2015 wichtigster
Handelspartner Deutschlands Im Jahr 2024 waren
die USA nicht nur wie bereits seit 2015 das
bedeutendste Abnehmerland deutscher Exporte,
sondern nach neun Jahren auch erstmals wieder
der wichtigste Handelspartner Deutschlands
insgesamt.
Damit lösten die USA die
Volksrepublik China ab, die von 2016 bis 2023
auf Rang 1 der wichtigsten Handelspartner
gelegen hatte (siehe dazu Pressemitteilung
Nr. 063 vom 19. Februar 2025). Für viele
Exportgüter aus Branchen wie der Pharmaindustrie
und Medizintechnik, dem Fahrzeug- sowie
Maschinenbau waren die Vereinigten Staaten 2024
ein besonders bedeutender Absatzmarkt. Insgesamt
gingen 10,4 % aller deutschen Exporte in die
USA, das war der höchste Anteil seit 2002 (siehe
dazu Pressemitteilug
Nr. N018 vom 14. April 2025).
•
Februar 2025: Anteil der
Exporte in die USA an den Gesamtexporten bei
10,7 %
Im Februar 2025 wurden aus
Deutschland Waren im Wert von 14,0 Milliarden
Euro in die USA exportiert (+0,9 % gegenüber
Februar 2024), was einen Anteil von 10,7 % an
den Gesamtexporten ausmachte.
Damit
waren die Vereinigten Staaten auch in diesem
Monat das wichtigste Abnehmerland für deutsche
Exporte. Gleichzeitig wurden Waren im Wert von
7,1 Milliarden Euro aus den USA importiert
(-6,1 % gegenüber Februar 2024), was 6,3 % der
deutschen Gesamtimporte entsprach. Damit
erreichten die Vereinigten Staaten in dem
Berichtsmonat Rang 3 unter den wichtigsten
Lieferländern für deutsche Importe.
Erzeugerpreise März 2025: -0,2 % gegenüber
März 2024
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
(Inlandsabsatz), März 2025 -0,2 % zum
Vorjahresmonat -0,7 % zum Vormonat
Die
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im
März 2025 um 0,2 % niedriger als im März 2024.
Im Februar 2025 hatte die Veränderungsrate
gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,7 % gelegen.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im März 2025
gegenüber dem Vormonat um 0,7 %.
Großhandelspreise im März 2025: +1,3 % gegenüber
März 2024 Großhandelsverkaufspreise,
März 2025 +1,3 % zum Vorjahresmonat -0,2 % zum
Vormonat WIESBADEN – Die Verkaufspreise im
Großhandel waren im März 2025 um 1,3 % höher als
im März 2024. Im Februar 2025 hatte die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
bei +1,6 % gelegen, im Januar 2025 bei +0,9 %.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, fielen die Großhandelspreise im März
2025 gegenüber dem Vormonat Februar 2025 um 0,2
%.
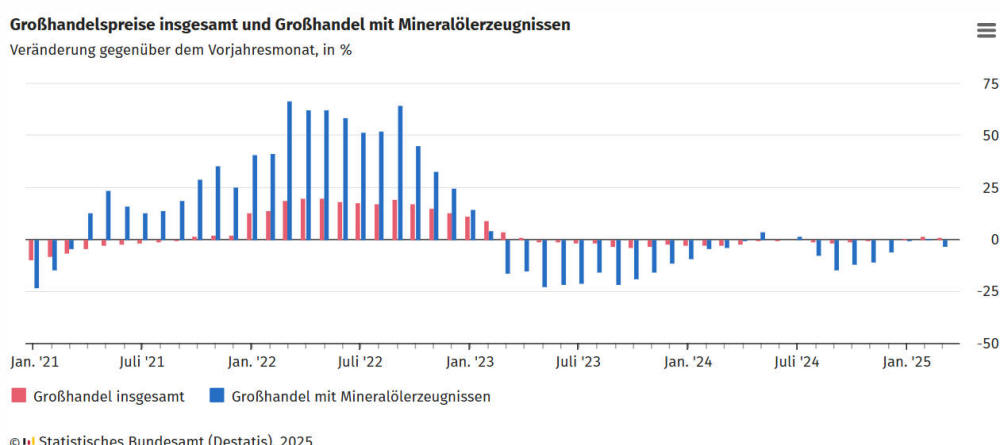
Gestiegene Preise für Nahrungs- und
Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie für
Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und
Nicht-Eisen-Metallhalbzeug Hauptursächlich für
den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt
gegenüber dem Vorjahresmonat war im März 2025
der Preisanstieg im Großhandel mit Nahrungs- und
Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren.
Die Preise lagen hier im Durchschnitt um
4,4 % über denen von März 2024. Insbesondere
Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf
Großhandelsebene erheblich teurer als ein Jahr
zuvor (+43,5 %), ebenso Zucker, Süßwaren und
Backwaren (+16,3 %). Auch für Milch,
Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und
Nahrungsfette (+9,3 %) musste merklich mehr
bezahlt werden als im Vorjahresmonat.
Die Großhandelsverkaufspreise für
Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und
Halbzeug daraus stiegen ebenfalls deutlich
gegenüber dem Vorjahresmonat (+27,3 %). Dagegen
waren die Preise im Großhandel mit
Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten 5,6 %
niedriger als im März 2024.
Im
Großhandel mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus
musste im Schnitt 5,4 % weniger bezahlt werden
als im Vorjahresmonat. Ebenfalls günstiger im
Vorjahresvergleich waren die Preise im
Großhandel mit lebenden Tieren (-3,2 %) sowie
mit Mineralölerzeugnissen (-3,0 %).
Mittwoch,
23. April 2025 - Welttag des Buches und Tag des
deutschen Bieres
Welttag des Buches – ein Tag, der uns jedes
Jahr daran erinnert, wie wichtig Lesen ist.
Das Lesen von Geschichten eröffnet
Welten, fördert Kreativität und stärkt Bildung –
und macht einfach Freude. Die zentrale Rolle
spielt die bundesweite Buch-Gutschein-Aktion
„Ich schenk dir eine Geschichte“ von
Stiftung Lesen, Stiftung Buchkultur und
Leseförderung des Börsenvereins, cbj Verlag,
Deutsche Post und DHL sowie dem ZDF. Die Aktion
steht unter der Schirmherrschaft der
Kultusminister*innen der Länder.
Jedes
Jahr wird ein Buch eigens für den Welttag des
Buches geschrieben, um Kinder für das Lesen zu
begeistern. Über 1,1 Millionen Schulkinder der
4. und 5. Klassen sowie aus Förderschul- und
Willkommensklassen bekommen in diesem Jahr den
spannenden Comicroman „Cool wie Bolle“ von Autor
Thomas Winkler und Illustrator Timo Grubing von
ihren Buchhandlungen geschenkt – ein Abenteuer,
das garantiert Lust aufs Weiterlesen macht!
Zum Welttag des Buches finden zahlreiche
weitere Aktionen rund ums Lesen statt, von
denen wir Ihnen ein paar in diesem Newsletter
und auf unseren
Social Media-Kanälen näher vorstellen. Für
viele Kinder ist das Welttagsbuch das erste
eigene Buch – auch das zeigt, wie wichtig die
Aktion ist. Denn ohne Lesestoff haben Kinder
keine Chance, die Lust am Lesen zu entdecken.
Das Ergebnis: Jedes vierte Kind in
Deutschland verlässt die Grundschule, ohne
richtig lesen zu können. Diese Kinder verstehen
am Ende eines Satzes nicht mehr, was am Anfang
stand. Dazu kommt, dass viele Grundschulen weder
die Mittel noch die Ressourcen haben, um Kinder
mit spannenden Büchern auszustatten. Wir finden:
Lesen darf kein Privileg sein. Deshalb verbinden
wir den Welttag des Buches mit einer weiteren,
besonderen Aktion – und laden Sie ein, Teil
davon zu werden.
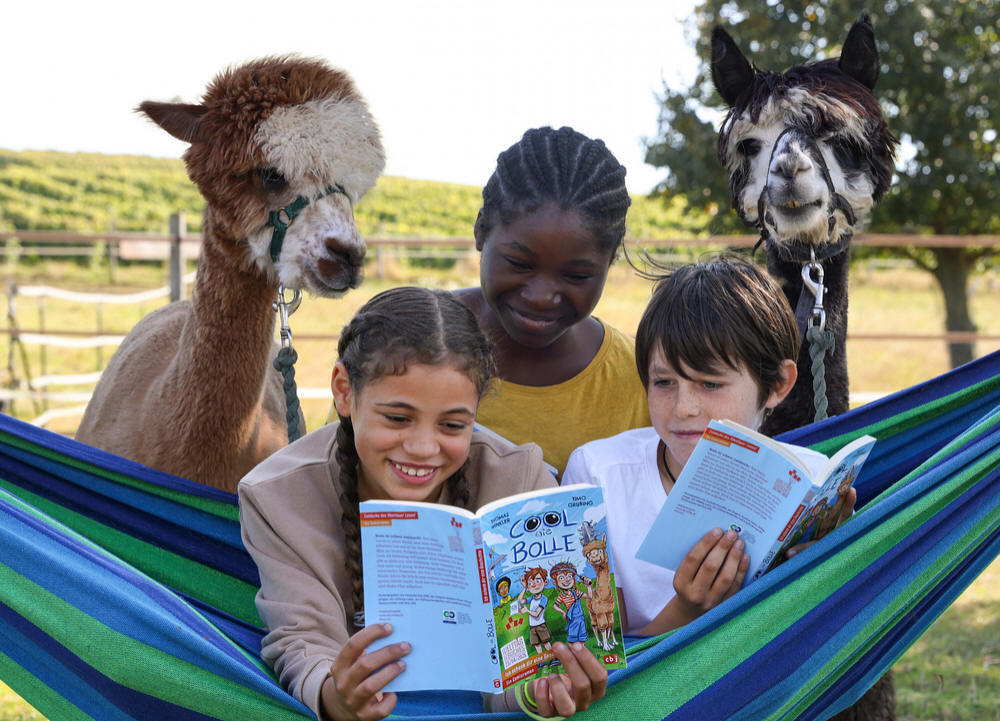
Stiftung Lesen
EU-Haushalt für
verteidigungsbezogene Aufstockung im Rahmen
einer neuen Verordnung festgelegt
Die Europäische Kommission hat Vorschläge
vorgelegt, wie bestehende
EU-Finanzierungsprogramme flexiblere,
koordiniertere und schnellere Investitionen im
Verteidigungsbereich unterstützen können.
Der für Verteidigung und Raumfahrt zuständige
EU-Kommissar Andrius Kubilius sagte: „Durch
Anreize für verteidigungsbezogene Investitionen
und die Förderung von Innovationen in
Verteidigungstechnologien stellen wir sicher,
dass die europäische Verteidigungsindustrie
wettbewerbsfähig und agil bleibt und bereit ist,
auf sich verändernde
Sicherheitsherausforderungen zu reagieren.“
Zugang zu EU-Mitteln straffen,
Verteidigungsbereitschaft stärken
Die
vorgeschlagenen Änderungen im Rahmen einer neuen
Verordnung werden die Fähigkeit der EU und der
Mitgliedstaaten verbessern, wichtige
Verteidigungsfähigkeiten zu entwickeln,
auszubauen und innovativ zu sein. Zugleich
werden sie den Zugang zu EU-Mitteln für
verteidigungsbezogene Projekte straffen.
Insgesamt wird die EU ihre
Verteidigungsbereitschaft 2030 stärken und den
ReArm Europe-Plan umsetzen. Kernpunkte Mit dem
Vorschlag wird der Anwendungsbereich der
Plattform „Strategische Technologien für Europa“
(STEP) auf verteidigungsbezogene Technologien
und Produkte ausgeweitet, insbesondere auf
diejenigen, die im jüngsten Weißbuch für die
europäische Verteidigung als vorrangige
Fähigkeiten genannt wurden.
Durch die
Verordnung über „Horizont Europa“ wird der
Europäische Innovationsrat (EIC) auch Start-ups
erreichen, die an Innovationen mit doppeltem
Verwendungszweck und im Verteidigungsbereich
arbeiten. Das Programm „Digitales Europa“ (DEP)
sollte auch auf Anwendungen mit doppeltem
Verwendungszweck ausgeweitet werden. Dies wird
entscheidende Unterstützung für
Verteidigungstechnologien bieten, insbesondere
bei der Entwicklung und dem Betrieb von
KI-Gigafactories.
Die Verordnung enthält
eine „Anlandungsklausel“ sowohl innerhalb des
Europäischen Verteidigungsfonds (EEF) als auch
des Gesetzes zur Unterstützung der
Munitionsproduktion (ASAP). Diese Bestimmung
ermöglicht es den Mitgliedstaaten, auf
freiwilliger Basis Mittel, die ihnen aus den
Fonds der Kohäsionspolitik zugewiesen wurden,
auf diese beiden Programme zu übertragen.
Schließlich wird die Unterstützung der
militärischen Mobilität und der digitalen
Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck
durch Änderungen an der Fazilität „Connecting
Europe“ (CEF) verstärkt. Nächste Schritte Dieses
Änderungspaket wird das
Omnibus-Verteidigungsvereinfachungspaket
ergänzen, das die Kommission voraussichtlich im
Juni 2025 vorlegen wird.
Sie wird die
EU-Vorschriften und -Prozesse weiter straffen,
um schnellere und effizientere
Verteidigungsinvestitionen und eine schnellere
und effizientere Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten zu ermöglichen.
Hintergrund
Diese Initiative steht im
Einklang mit den Zielen des gemeinsamen
Weißbuchs für die europäische Verteidigung –
Bereitschaft 2030. Sie gibt der EU einen klaren
Weg vor, um die Entwicklung der
Verteidigungsfähigkeiten zu unterstützen, die
zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger, zum
Schutz ihrer Werte und zur Reaktion auf ein sich
rasch wandelndes geopolitisches Umfeld
erforderlich sind.
Schädling schon im April
bekämpfen: Enni setzt natürliche Mittel gegen
den Eichenprozessionsspinner ein
DWD: Eichenprozessionsspinner:
Frühwarnsystem online
So schön die Frühlingsboten für Menschen derzeit
auch sind, durch die warmen Temperaturen macht
sich bereits jetzt der ungeliebte
Eichenprozessionsspinner am Niederrhein breit.
So rückt Harry Schneider ab dieser Woche gegen
die Raupe des Eindringlings aus.
Gemeinsam mit einem zertifizierten
Fachunternehmen geht der zuständige Teamleiter
der ENNI Stadt & Service Niederrhein (Enni) im
Moerser Stadtgebiet gegen den Schädling vor, der
landesweit seit Jahren eine Plage ist und für
Menschen durchaus gefährlich sein kann. Der
Kontakt verursacht dabei meist heftige
Juckreizungen und auch Hautentzündungen.
Vorbeugend wird ein durch Enni beauftragter,
hierauf spezialisierter Schädlingsbekämpfer
daher in der Grafenstadt in diesem Jahr rund
2.500 Eichen mit einem mikrobiologischen Biozid
behandeln. Das natürliche Mittel ist dabei für
Menschen und Tiere vollkommen ungefährlich.
„Es greift aber das Verdauungssystem der
Raupe an und stoppt so deren Entwicklung“, sei
dies laut Schneider ein seit Jahren bewährtes
Bekämpfungsmittel. „Für den Einsatz sollte es
aber warm und trocken sein. Andersfalls müssen
wir die mehrtägige Aktion verschieben oder
unterbrechen“, bittet der Enni-Experte Bürger
die gekennzeichneten Einsatzgebiete während der
Aktion zu meiden.
Der Kampf gegen den
Schädling ist für Schneider in Moers
mittlerweile Routine und folgt einem festen
Plan. Erneut beginnen die Maßnahmen dabei im
Schloss- und Freizeitpark, in der Innenstadt und
in Hülsdonk. Danach sind die Eichen in den
Stadtteilen Vinn, Utfort und Repelen an der
Reihe, bevor die Spezialisten in Kapellen,
Vennikel, Holderberg, Schwafheim, Asberg,
Meerbeck und letztendlich Lohmannsheide aktiv
werden.
„Die Einsätze dauern jeweils nur
wenige Minuten“, erklärt Schneider. „Die
Fachleute sprühen das Mittel mit Hilfe eines
Gebläses bis zu 30 Meter hoch in die befallenen
Baumkronen. Dann werden die Raupen die frischen
Blätter fressen, das Mittel dadurch aufnehmen
und innerhalb weniger Tage absterben.“
Neben dem Besprühen setzt die Enni im Kampf
gegen den Eichenprozessionsspinner weiter auch
auf die Natur. So hat das Unternehmen
beispielsweise auf dem Friedhof Lohmannsheide
Nistkästen für Meisen aufgehängt, die natürliche
Fressfeinde des Schädlings sind. Sollten sich
trotz der vorbeugenden Maßnahmen Nester
entwickeln, wird die Enni diese außerdem
absaugen.
Oftmals verunsicherte Bürger
weist Schneider darauf hin, dass sich
Eichenprozessionsspinner nur an Eichen
aufhalten. „Bei gespenstig aussehenden Nestern
an Sträuchern handelt es sich meist um
sogenannte Gespinnstmotten. Da die für Pflanzen
und Umwelt harmlos sind, werden sie von uns auch
nicht bekämpft.“
Moers: enni.comedy Salon
Moderator Don Clarke freut sich auf den nächsten
enni.comedy Salon. Wie immer, lädt er sich dafür
drei Top-Comedians aus ganz Deutschland ein, mit
denen er das Bollwerk 107 für zwei Stunden in
einen Humortempel verwandeln wird.
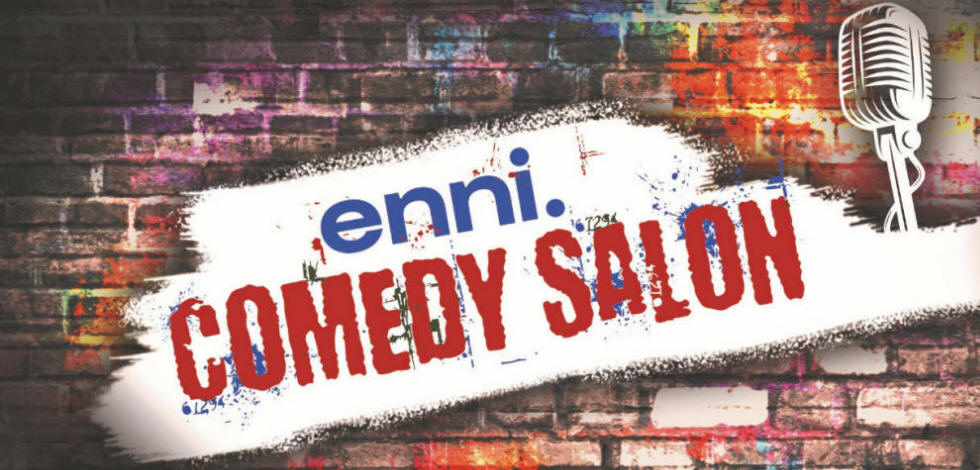
Veranstaltungsdatum 23.04.2025 - 20:00
Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers.
Moers:
Zeichenschule „Minion meets spring“ für Kinder
ab 8 Jahren
Male und gestalte
Deinen eigenen frühlingshaften Comic - mit einem
der lustigen gelben Minions in der Hauptrolle.
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, für
das Material wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro
erhoben.
Nähere Infos und Anmeldung unter Telefon: 0 28
41 / 201-751, unter E-Mail jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek. Veranstaltungsdatum
24.04.2025 - 14:30 Uhr - 16:00 Uhr.
Veranstaltungsort Wilhelm-Schroeder-Straße 10
47441 Moers Veranstaltungsort Multifunktionsraum
(1. Etage)
Moers: Musical Starlights – Best of
Musicals 2025
Das Musical-Herz schlägt höher, sobald die
ersten Töne von Klassikern wie „Tanz der
Vampire“, „Die Eiskönigin“ oder „Wicked“
erklingen. Vereint unter dem Programm „Best of
Musicals“, präsentiert Musical Starlights die
spektakulärsten Highlights der beliebtesten
Musicals unserer Zeit. Kinderaugen erstrahlen
und Erwachsene werden zu Tränen gerührt, sobald
die unterschiedlichen Musical-Highlights auf
einer Bühne präsentiert werden.

Mit viel Liebe zur Programmzusammenstellung
begeistert Musical Starlights alle Musicalfans
gleichermaßen. Dabei bereiten die gefühlvollen
Stimmen der Sänger dem Publikum regelmäßig
Gänsehaut.
Musicalfans müssen sich nicht für
eine der erfolgreichen Produktionen entscheiden,
sondern erleben die Höhepunkte der
erfolgreichsten Musicals wie … Die Eiskönigin,
Tanz der Vampire, Phantom der Oper, Grease,
Elisabeth, Mama Mia und viele weitere
unvergessliche Highlights aus der Welt der
Musicals.
Veranstaltungsdatum 25.04.2025
- 19:30 Uhr. Veranstaltungsort Filder Straße
142, 47447 Moers. Veranstalter ENNI Eventhalle
Moers: Flügge – das lokale
Newcomerformat
“Flügge” steht für musikalische Vielfalt und die
Chance, neue Talente zu entdecken. Unterstützt
eure Lieblingsbands aus der Region und lasst
euch von Gitarrenriffs und eingängigen Melodien
mitreißen – bei “Flügge” ist für alle
Musikbegeisterten etwas dabei.
Mit
dabei: Leaves in Flames und Angelic in Jeans.
Veranstaltungsdatum 25.04.2025 - 20:00
Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers .
Moers:
Wildkräuter sammeln und verkosten
Im Freizeitpark können wir gemeinsam essbare
Wildkräuter entdecken, sammeln und später bei
einer Einkehr in gemütlicher Runde verkosten.
Zugleich ergibt sich ein „Gesundheitsbad“ am
fließenden Moersbach unter besonderen Bäumen.

Moersbach
Geführt von Anne-Rose
Fusenig Treffpunkt: Sportplatz Solimare
Kosten: 13 Euro
Weitere Infos zu den Stadtführungen.
Veranstaltungsdatum 24.04.2025 - 17:00
Uhr - 19:00 Uhr. Veranstaltungsort Sportplatz
Solimare
Neue Studie belegt: Ehrenamtliches
Engagement im Zivil- und Katastrophenschutz
ungebrochen hoch
Für das wachsende Einsatzaufkommen melden
Organisationen weiterhin großen
Personal-Mehrbedarf. 1,76 Millionen
Ehrenamtliche ab 18 Jahren sind in Deutschland
im Zivil- und Katastrophenschutz engagiert – mit
insgesamt rund drei Prozent der deutschen
Wohnbevölkerung ist die Engagementquote somit
seit 1999 konstant.
Dennoch geben nur
knapp ein Drittel aller befragten operativ
tätigen Organisationen, wie die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft oder der
Malteser-Hilfsdienst, an, ausreichend Mitglieder
zu haben, um gestiegene Anforderungen zu
bewältigen. Das belegt eine Studie von
Zivilgesellschaft in Zahlen (kurz: ZiviZ) im
Stifterverband im Auftrag des Bundesamtes für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (kurz:
BBK).

Ein Grund für den Mehrbedarf: Der
Klimawandel begünstigt die Entstehung von
Extremwettereignissen wie Stürmen, Starkregen
oder Dürreperioden. Um die Folgen zu bewältigen,
müssen ehrenamtliche Einsatzkräfte immer
häufiger ausrücken und immer längere Einsätze
bestreiten.
Zudem falle gerade die Besetzung von
ehrenamtlichen Leitungspositionen schwer. Auf
diese sind die operativ tätigen Organisationen
im Zivil- und Katastrophenschutz aber
angewiesen, da nur 11 Prozent von ihnen über
bezahlte Beschäftigte verfügen.
BBK-Präsident Ralph Tiesler: „Wir in Deutschland
dürfen zurecht stolz sein auf unser ehrenamtlich
getragenes Hilfeleistungssystem und die
zahlreichen Helfenden, die sich Tag für Tag für
uns alle einsetzen. Damit der Zivil- und
Katastrophenschutz die wachsenden Anforderungen
auch künftig gut bewältigen kann, müssen aber
die Rahmenbedingungen stimmen.
Als Teil
einer Kultur der Wertschätzung des
ehrenamtlichen Engagements, müssen wir die
Helfendengleichstellung voranbringen, in die
Nachwuchsgewinnung investieren und moderne
Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen ohne
feste Zugehörigkeit zu einer Einsatzorganisation
anbieten. Dies ist eine wichtige Aufgabe für die
jetzt beginnende Legislaturperiode.“
ZiviZ-Studienleiter Peter Schubert: „Die
Bereitschaft zum freiwilligen Engagement im
Bevölkerungsschutz ist in Deutschland nach wie
vor hoch. Dennoch geraten viele Organisationen
zunehmend unter Druck. Es braucht dringend
gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Strukturen –
sei es durch bessere Vereinbarkeit von Ehrenamt
und Beruf, den Abbau von Bürokratie oder die
Öffnung für bislang unterrepräsentierte Gruppen,
insbesondere Frauen oder Menschen mit
Migrationsgeschichte.“
Bessere
Rahmenbedingungen für das Ehrenamt
Zu den am
häufigsten von den Befragten genannten
Verbesserungsvorschlägen zählen neben der
besseren Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf
oder der besseren Information über Gelegenheiten
zum ehrenamtlichen Engagement auch Punkte, die
dem Bereich der Helfendengleichstellung
zugeordnet sind. Dazu gehören die steuerliche
Freistellung von Aufwandsentschädigungen und
Unkosten, die aus der ehrenamtlichen Tätigkeit
anfallen oder die versicherungsrechtliche
Absicherung.
Auch die öffentliche
Förderung der privaten Hilfsorganisationen wird
in der Studie thematisiert. Öffentliche
Fördermittel stellen im Haushaltsjahr 2021 nur
acht Prozent der Einnahmen der operativ tätigen
Organisationen dar. Wichtigste Einnahmequelle
sind Mitgliedsbeiträge. Als Erbringerinnen
wichtiger Leistungen für die Gesellschaft
wünschen sich 85 Prozent der im
Bevölkerungsschutz operativ tätigen
Organisationen, dass ihre Aktivitäten in
Eigenregie durchgeführt, aber vom Staat
finanziert werden.
Die Mitgliedzahlen
ließen sich zudem über eine stärkere
Mobilisierung unterrepräsentierter Gruppen
steigern. Frauen beispielsweise machen bislang
über alle Hilfs- und Einsatzorganisationen
hinweg durchschnittlich nur 20 Prozent der
Mitglieder aus. Große Potentiale sieht die
Studie auch bei der Einbindung von Menschen mit
Migrationsbiografie oder von Menschen mit
Behinderung.
Ein sicheres Fundament für
den Zivil- und Katastrophenschutz der Zukunft
Als zentrale Stelle für die bundesweite
Förderung des Ehrenamts arbeitet das BBK
intensiv daran, unterrepräsentierte Gruppen für
das Ehrenamt zu gewinnen, beispielsweise durch
die BBK-Kampagne „Egal was du kannst, du kannst
helfen“ (https://mit-dir-fuer-uns-alle.de/).
Auf der interaktiven Kampagnen-Karte finden
Interessierte zudem schnell und einfach heraus,
welche Engagement-Möglichkeiten es am eigenen
Wohnort gibt. Mittlerweile sind dort über 10.000
Standorte der anerkannten Hilfs- und
Einsatzorganisationen in Deutschland
eingetragen.
Im Rahmen des Förderpreises
„Helfende Hand“
(https://www.helfende-hand-foerderpreis.de/),
welcher vom Bundesministerium des Innern und für
Heimat vergeben wird, wird zudem 2025 ein
Sonderpreis für inklusive Konzepte und Projekte
ausgelobt, die die gleichberechtigte Teilhabe
aller Menschen im Zivil- und Katastrophenschutz
fördern.
Stadtradeln: Moers radelt
ab 4. Mai - Abschlusstour mit dem Bürgermeister
Moers tritt auch in diesem Jahr wieder in die
Pedale für ein gutes Klima. Ab 4. Mai nimmt die
Stadt an der internationalen Kampagne
‚Stadtradeln‘ des Klima-Bündnis teil.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer (4. v. l.)
lädt in diesem Jahr wieder zu einer kleinen
Radtour ein. (Foto: pst)
Ziel ist, bis
zum 24. Mai möglichst viele Kilometer auf dem
Rad zu sammeln, dadurch viele Tonnen CO2
einzusparen und so für das Radfahren sowie den
Klimaschutz zu werben. Teilnehmen können im
Aktionszeitraum alle, die in Moers wohnen,
arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein
sind.
Ein Team muss immer aus mindestens
zwei Personen bestehen. Wer alleine radeln will,
kann dem ‚Offenen Team‘ beitreten. Die letzten
Kilometer können Radlerinnen und Radler
gemeinsam mit Bürgermeister Christoph
Fleischhauer machen.
Er lädt am Samstag,
24. Mai, zu einer kleinen Radtour. Sie beginnt
um 10 Uhr am Parkplatz Filder Straße 147
(gegenüber Solimare am Tennisclub Moers). Nach
circa 17 Kilometern endet die Route an der
Feuerwehr Hülsdonk - mit Currywurst und
Getränken. Eine E-Mail zur Anmeldung bis
spätestens 14. Mai an buergermeister@moers.de reicht.
Preise für Schulen
Die Stadt hofft
auch in diesem Jahr wieder auf viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Stadtradeln,
damit das Ergebnis aus dem letzten Jahr noch
einmal gesteigert werden kann. 2024 waren in
Moers 2.303 Personen dabei. Sie haben in 83
Teams insgesamt 324.900 Kilometer erradelt.
Hierdurch konnten insgesamt 53 Tonnen CO2
vermieden werden. Jeder Fahrrad-Kilometer zählt
und kann online im Login-Bereich eingetragen
oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt
werden.
Für registrierte Teilnehmende
gibt es nach dem Aktionszeitraum eine
siebentägige Nachtragefrist. Schulen können
Preise für die meisten geradelten Kilometer pro
gemeldete Schüler/innen gewinnen. Die Sparkasse
am Niederrhein, die Knappschaft und Enni stellen
sie zur Verfügung.
Eine Registrierung
für die diesjährige Teilnahme möglich.
Fragen zur Aktion werden auch telefonisch (0 28
41 / 201-582) oder per
E-Mail beantwortet. Weitere
Information zur Stadtradeln-App.

Zum Tag des deutschen Bieres: Bierexport 2024 um
6,0 % gegenüber 2014 zurückgegangen
Zahl der Brauereien nimmt seit einigen Jahren ab
WIESBADEN – Nicht allein im Inland geht der
Bierabsatz seit Jahren zurück, auch im Ausland
ist deutsches Bier nicht mehr so gefragt wie
noch vor zehn Jahren. 1,45 Milliarden Liter Bier
wurden 2024 ins Ausland exportiert, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag des
deutschen Bieres am 23. April mitteilt.
Das waren 6,0 % weniger als zehn Jahre zuvor.
2014 waren noch 1,54 Milliarden Liter
hierzulande gebrautes Bier ins Ausland verkauft
worden. Vergangenes Jahr ging gut die Hälfte
(55,7 %) des ausgeführten deutschen Bieres in
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 44,3 %
wurden in Drittstaaten exportiert.
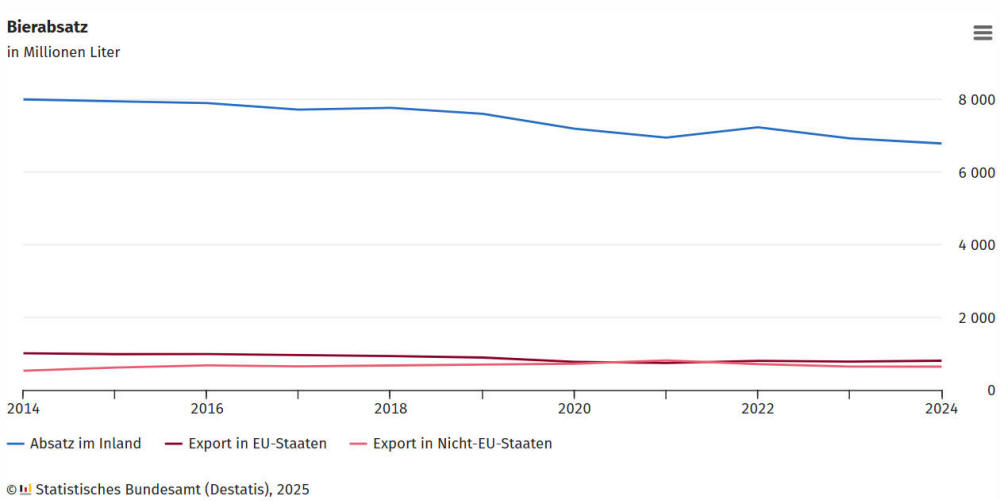
Zahl der Brauereien gegenüber 2023 um 3,4 %
zurückgegangen
Mit dem sinkenden Bierabsatz
ging zuletzt auch die Zahl der Brauereien in
Deutschland zurück. Zwar gab es im Jahr 2024 mit
bundesweit 1 459 Brauereien 7,4 % mehr als 2014
(1 359). Seit dem Höchststand im Vor-Corona-Jahr
2019 mit 1 552 Brauereien geht deren Zahl jedoch
nahezu kontinuierlich zurück. Allein gegenüber
dem Vorjahr nahm die Zahl der Brauereien im Jahr
2024 um 3,4 % ab (2023: 1 511 Brauereien).
NRW-Brauereien produzierten 2024 weniger
Bier
In den 31 Brauereien
Nordrhein-Westfalens (mit mindestens 20
Beschäftigten) wurden im Jahr 2024 insgesamt
15,6 Millionen zum Absatz bestimmte Hektoliter
alkoholhaltiges Bier aus Malz (ohne
Biermischgetränke) gebraut. Das waren
3,7 Prozent bzw. 602 000 Hektoliter
alkoholhaltiges Bier weniger als 2023. Der
Absatzwert des im Jahr 2024 gebrauten
alkoholhaltigen Bieres lag nominal bei
1,64 Milliarden Euro und war damit nahezu
unverändert (−0,1 Prozent).
Gegenüber
dem Jahr 2019 sank die Menge um 2,1 Millionen
Hektoliter bzw. 12,0 Prozent, während der
Absatzwert nominal um 107 Millionen Euro
(+7,0 Prozent) stieg. 104 Liter alkoholhaltiges
und acht Liter alkoholfreies Bier hätte 2024
jede volljährige Person in NRW konsumieren
können Auch die Absatzproduktion von
alkoholfreiem Bier und alkoholfreien
Biermischgetränken ist im Jahr 2024 gesunken.
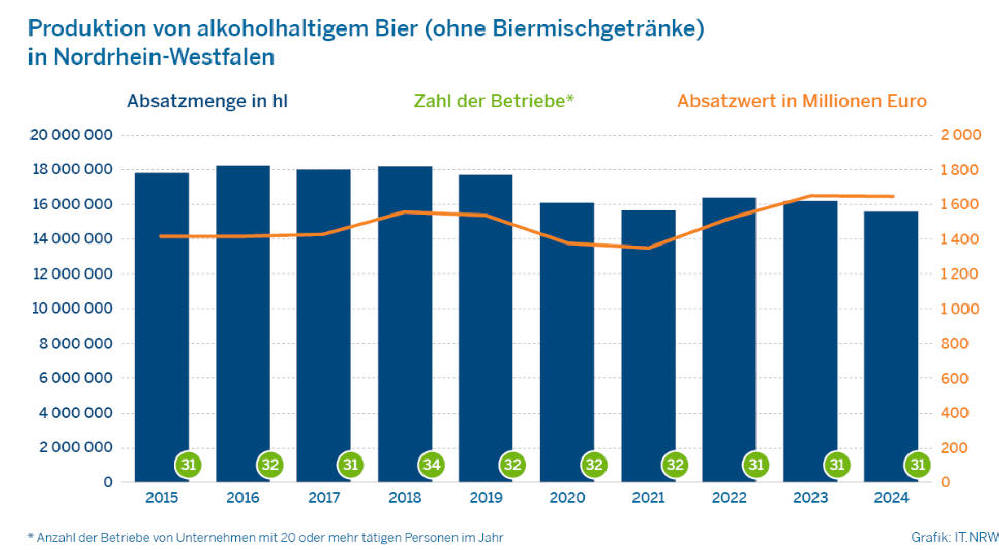
In 22 NRW-Brauereien wurden mit
1,2 Millionen Hektoliter gut 13 000 Hektoliter
(−1,1 Prozent) weniger gebraut als im Vorjahr.
Der Absatzwert stieg dagegen nominal um
13 Millionen Euro (+9,5 Prozent) auf
146 Millionen Euro. Gegenüber dem Jahr 2019
stieg die Menge um 160 000 Hektoliter bzw.
15,3 Prozent und der Absatzwert nominal um
51 Millionen Euro (+53,1 Prozent).
Rein
rechnerisch entfielen damit im Jahr 2024 auf
jede volljährige Person Nordrhein-Westfalens
etwa 104 Liter alkoholhaltiges und acht Liter
alkoholfreies Bier (Bevölkerungsstand:
31.12.2023). Durchschnittlicher Absatzwert der
Bierproduktion gestiegen Die
nordrhein-westfälischen Brauereien erzielten
2024 einen durchschnittlichen Absatzwert von
1,05 Euro je Liter alkoholhaltiges Bier aus
Malz. Dieser war um 3,7 Prozent höher als 2023
(damals: 1,01 Euro) und um 21,5 Prozent höher
als 2019 mit damals 86 Cent je Liter.
Der durchschnittliche Absatzwert von
alkoholfreiem Bier und alkoholfreien
Biermischgetränken stieg von 1,10 Euro im Jahr
2023 auf 1,21 Euro je Liter im letzten Jahr; ein
Plus von 10,7 Prozent. Verglichen mit 2019
(damals: 91 Cent) stieg er um 32,7 Prozent.
Anteil an der gesamtdeutschen Bierproduktion
leicht gesunken
Deutschlandweit wurden im
Jahr 2024 nach vorläufigen Ergebnissen, wie
schon im Vorjahr, 72,4 Millionen Hektoliter
(−0,0 Prozent) alkoholhaltiges Bier mit einem
nominalen Absatzwert von 6,6 Milliarden Euro
(+3,3 Prozent) und 5,8 Millionen Hektoliter
(+4,1 Prozent) alkoholfreies Bier und
alkoholfreie Biermischgetränke mit einem
nominalen Absatzwert von 607 Millionen Euro
(+10,7 Prozent) zum Absatz bestimmt gebraut.
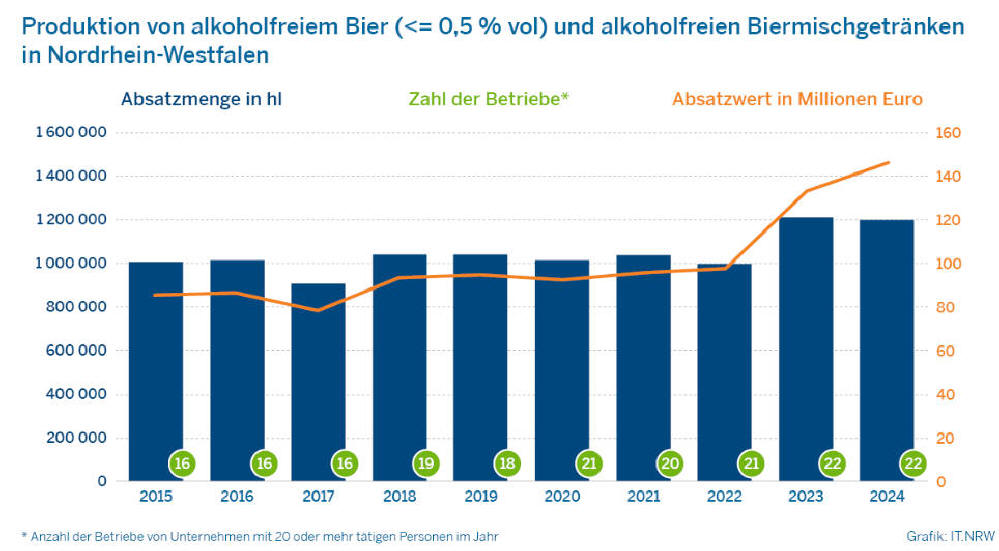
Der Anteil von Nordrhein-Westfalen an der
bundesdeutschen Produktion von alkoholhaltigem
und alkoholfreiem Bier ist mit 21,6 und
20,8 Prozent (2023 waren es 22,4 und
21,8 Prozent) leicht gesunken. Der
Regierungsbezirk Arnsberg hatte den größten
Anteil an der NRW Bierproduktion Mehr als die
Hälfte (61,1 Prozent) des in NRW produzierten
alkoholhaltigen und 85,0 Prozent des
alkoholfreien Bieres wurde in Betrieben des
Regierungsbezirks Arnsberg zum Absatz gebraut.
Baugenehmigungen für Wohnungen im
Februar 2025: -2,3 % zum Vorjahresmonat
Baugenehmigungen von Januar bis Februar 2025 zum
Vorjahreszeitraum: +2,1 %
Baugenehmigungen in
Neubauten von Januar bis Februar 2025 zum
Vorjahreszeitraum:
+12,4 % bei
Einfamilienhäusern
-14,5 % bei
Zweifamilienhäusern
-1,3 % bei
Mehrfamilienhäusern
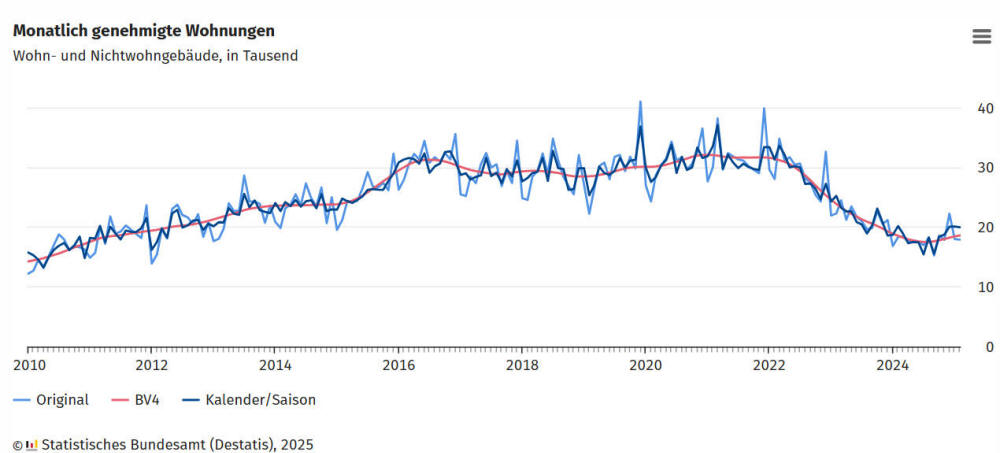
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden
im Februar 2025 insgesamt 14 200 Wohnungen
genehmigt. Das waren 3,8 % oder 600 Wohnungen
weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis
Februar 2025 wurden 29 800 Neubauwohnungen
genehmigt und damit 2,2 % oder 600 mehr als im
Vorjahreszeitraum.
Dabei stieg die Zahl
der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um
12,4 % (+800) auf 6 800. Bei den
Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter
Wohnungen dagegen um 14,5 % (-300) auf 1 900.
Bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den
Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl
der genehmigten Wohnungen um 1,3 % (-200) auf
18 500.
Dienstag, 22.
April 2025
Moers: „Pankreastumore
verstehen: Fakten, Mythen und moderne Medizin"
-
Hybridveranstaltung des Pankreaszentrums am
Krankenhaus Bethanien am 30.04.2025
-
Experten-Vorträge und Austausch rund ums Thema
Bauchspeicheldrüsentumore online und vor Ort
Am 30. April 2025 lädt das Pankreaszentrum am
Krankenhaus Bethanien Moers alle interessierten
Bürger:innen sowie niedergelassene Ärzt:innen
zur Hybridveranstaltung „Pankreastumore
verstehen: Fakten, Mythen und moderne Medizin"
ein. Die Veranstaltung findet wahlweise online
oder vor Ort in der Bethanien Akademie
(Bethanienstraße 15, 47441 Moers, Seminarraum 1
und 2) von 17 bis 19.30 Uhr statt.
Nach
einer kurzen Begrüßung dreht sich in den
Experten-Vorträgen, die um 17 Uhr starten,
zunächst alles um die Bereiche „Endoskopische
Diagnostik und Therapie“ und „Chirurgische
Therapie“ von Pankreastumoren und ihren
Vorstufen. Nach einer Pause mit kleinem Imbiss
und der Möglichkeit zum Austausch gehen die
Vorträge mit den Schwerpunkten „Medikamentöse
Therapie“ und „Diabetes und Ernährung bei
Tumoren der Bauchspeicheldrüse“ weiter.
Durch die Veranstaltung sollen Betroffenen sowie
niedergelassenen Ärzt:innen aus der Region die
vielfältigen neuen Möglichkeiten bei der
Diagnostik und Therapie von Tumoren der
Bauchspeicheldrüse und ihren Vorstufen durch die
Expert:innen des interdisziplinären Teams am
Krankenhaus Bethanien Moers vorgestellt werden.
Für die Online-Teilnahme an der
Veranstaltung wird um eine vorherige Anmeldung
per E-Mail an
gastroenterologie@bethanienmoers.de gebeten,
damit der entsprechende Zugangslink versendet
werden kann. Bei einer Teilnahme vor Ort ist
keine Anmeldung
erforderlich.
Die
Verantwortlichen des Pankreaszentrums am
Krankenhaus Bethanien Moers laden zu einer
Hybridveranstaltung rund um
Bauchspeicheldrüsentumore ein.

Kubitz - Bausch
vhs-Kurs
‚Abnehmen ohne Schlankheitskur‘ startet am 30.
April
Ohne Verzicht oder Einhaltung
von Essenzeiten sein Wunschgewicht erreichen –
das verspricht ein Kurs der vhs Moers –
Kamp-Lintfort. Er startet am Mittwoch, 30.
April, um 18 Uhr.

(Foto: pixabay)
‚Abnehmen ohne
Schlankheitskur‘ vermittelt den Teilnehmenden
die KinKout-Methode (Kalorien in – Kalorien
out), die der Ernährungswissenschaftler Patrick
Paaßen entwickelt hat. Die Teilnehmenden treffen
sich insgesamt sechsmal jeweils mittwochs im
Alten Landratsamt, Kastell 5b.
Eine Anmeldung
ist erforderlich und telefonisch unter 0 28
41/201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de
möglich.
Dinslaken: Mit dem
Planwagen durch das Rotbachtal
Nach
der Winterpause starten wieder die beliebten
Planwagenfahrten durch das Rotbachtal, bei der
die Teilnehmenden zahlreiche Informationen über
Flora, Fauna und Geographie erhalten. Am
Mittwoch, 23. April 2025 von 14 bis 17 Uhr
verläuft die Planwagenfahrt von der Wassermühle
in Hiesfeld parallel zum Bachlauf des Rotbachs
bis zum Zusammenfluss von Rot- und Schwarzbach.
Von dort geht es durch die Kirchheller
Heide zum Weihnachtssee und zum Heidesee, bevor
es am „Kompetenzzentrum Wald“ auf dem Heidhof
die Möglichkeit zum kostenlosen Besuch einer
naturwissenschaftlichen Ausstellung und dem
Besuch des Kiosks gibt. Nach diesem 30-minütigen
Aufenthalt verläuft die Fahrt weiter über
Oberlohberg zurück zur Wassermühle nach
Hiesfeld.
Die Teilnahmegebühr
beträgt 20 Euro pro Person und wird vor Ort beim
Gästeführer entrichtet. Der Treffpunkt befindet
sich an der Wassermühle in Hiesfeld.
Eine
vorherige Anmeldung für die Planwagenfahrt ist
erforderlich und nimmt das Team der
Stadtinformation unter Tel. 02064 – 66 222 oder
per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de
entgegen.
Moers:
Pflanzentauschbörse am 25. April
Für alle, die einheimische Pflanzen benötigen
oder überzählige Gewächse zu verschenken haben,
gibt es am Freitag, 25. April, wieder eine
Pflanzentauschbörse. Die vhs Moers –
Kamp-Lintfort lädt Interessierte dazu ab 16.30
Uhr zum Bio-Garten an der Vinner Straße, rechts
vom Friedhof, ein.
Das Frühjahr eignet
sich besonders zum Tauschen und Abgeben von
Stauden und Samen. Wer keine Pflanzen abzugeben
hat, kann trotzdem vorbeikommen und sich Ableger
mitnehmen. Praktische Tipps zur naturnahen
Gartengestaltung gibt es in jedem Fall.
Eine
vorherige Anmeldung für die kostenlose
Pflanzentauschbörse ist notwendig und
telefonisch unter 0 28 41/201 - 565 und online
unter www.vhs-moers.de möglich.
Laufmannschaft der Stiftung Bethanien Moers
geht wieder an den Start
Bethanien-Team
tritt erneut beim Moerser Schlossparklauf an
Nur noch wenige Tage, dann fällt der Startschuss
für den 48. ENNI Schlossparklauf in Moers. Zum
wiederholten Mal tritt auch die Stiftung
Bethanien Moers am Samstag, dem 26. April 2025
an. Die Laufmannschaft nahm bereits in der
Vergangenheit mehrfach und erfolgreich am
Sportereignis teil.
Für die
Bethanier:innen bietet die gemeinsame sportliche
Betätigung gleich mehrere Vorteile, so die
beiden Organisatoren auf Seiten der Stiftung
Bethanien Moers Dr. Christoph Chylarecki und Dr.
Kato Kambartel. Einerseits fördere man die
eigene Gesundheit, andererseits stärke man so
den Teamgeist und sporne sich gegenseitig an.
Für Dr. Christoph Chylarecki, selbst ein
begeisterter Läufer und Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie & Orthopädie, ist der
Schlossparklauf bereits seit mehr als zehn
Jahren eine echte Herzensangelegenheit: „Wir als
Bethanien-Team möchten die Gelegenheit ebenso
nutzen, um auch andere Firmen dazu zu
motivieren, mit einer Mannschaft beim ENNI
Schlossparklauf anzutreten.“
„Es geht
bei allem Sportsgeist nicht um Bestzeiten oder
darum, Rekorde zu brechen. Der Fokus liegt vor
allem darauf, körperliche Bewegung attraktiv zu
machen und für sie zu werben“, erklärt Dr. Kato
Kambartel, Lungenfacharzt im Krankenhaus
Bethanien Moers und Vorstand beim Moerser
Turnverein (MTV). Denn es sei kein Geheimnis,
dass Sport gesund halte und zu einer besseren
sowie schnelleren Regeneration – beispielsweise
nach Operationen – beitrage.
Sein
Kollege Dr. Christoph Chylarecki hat noch einen
weiteren Tipp: „Es ist nicht von Bedeutung,
welche Sportart man ausübt und in welcher
Intensität. Wichtig ist, dass man etwas tut, um
sich fit zu halten. Bereits regelmäßiges
Spazierengehen stärkt den Körper und die
Gesundheit.“
Kleve: Radhaus live mit
Squeaky Wheels + Destinova
Sa., 26.04.2025 -
20:00 - Sa., 26.04.2025 - 23:30
Radhaus
live mit „Squeaky Wheels" (Punk/Indie Rock aus
Xanten/Alpen) und "Destinova" (Rock, Metal und
Stoner aus Leverkusen). Der Einlass ist um 20
Uhr, der Beginn um 21 Uhr. Der Besuch zu den
Konzerten ist ab 14 Jahren möglich. Der Eintritt
frei.
Weitere Infos: www.radhaus-kleve.de
Kleve: Konzert mit dem PABLO HELD
TRIO
Fr., 25.04.2025 - 20:30 - Fr.,
25.04.2025 - 22:30 Uhr
Die Klever Jazzfreunde
laden zum Konzert mit "Pablo Held Trio" in die
kleine evangelische Kirche ein.

„One of the great groups in music today“ John
Scofield
„The trio gel together as well as
any jazz unit could hope to aspire and even
exude something of the near-supernatural
compatibility of the legendary Keith
Jarrett/Gary Peacock/Jack DeJohnette line-up.
[…] the group really needs to be recognised as a
world class trio of exceptional talent.”
Kleve: Radhaus live mit Squeaky Wheels +
Destinova
Sa., 26.04.2025 - 20:00 -
Sa., 26.04.2025 - 23:30

Radhaus live mit „Squeaky Wheels" (Punk/Indie
Rock aus Xanten/Alpen) und "Destinova" (Rock,
Metal und Stoner aus Leverkusen). Der Einlass
ist um 20 Uhr, der Beginn um 21 Uhr. Der Besuch
zu den Konzerten ist ab 14 Jahren möglich. Der
Eintritt frei. Weitere Infos:
www.radhaus-kleve.de
Cello und Harfe sind das duo51saiten: Konzert
mit jungen Stipendiaten im Museum Kurhaus Kleve
Ein Viertel des 2CitiesCelloquartett, das im
März in der Versöhnungskirche begeisterte, kommt
erneut zu einem Gastspiel nach Kleve! Der
vielfach ausgezeichnete Cellist Michael
Wehrmeyer bringt diesmal eine Harfenistin mit.
Johanna Dorothea Görißen ist wie der Cellist
Preisträgerin des Deutschen Musikwettbewerbs.
Die beiden haben zum duo51saiten
zusammengefunden und begeistern das Publikum im
Konzertprogramm „Aquarell“ mit faszinierenden
Klangfarben ihrer Saiteninstrumente – so auch am
Sonntag, 27. April, 18 Uhr, im Museum Kurhaus
Kleve.

Das duo51saiten. (c) Foto: Taewook Ahn
„Wehmütige Impressionen, zarte Melodien,
melancholische Stimmungen und verspielte Läufe –
daraus entstehen Farben und Schattierungen, die
ein Bild erschaffen wie ein Aquarell“ – so
beschreibt das junge Duo aus der Konzertauswahl
des Deutschen Musikrats sein malerisches
Programm auf den 47 + 4 = 51 Saiten von Harfe
und Cello.
Solistisch und im Duo setzen
Johann Görißen aus Berlin und Michael Wehrmeyer
aus Weimar ihre bunten und kontrastreichen
Farbtupfer in Charakterstücke und Sonaten von
Franz Strauss, Olivier Messiaen, und Franz
Schubert: „Wir kombinieren bekannte Werke der
Cello-Literatur mit eher selten gespielten
Stücken. Da es wenige originale Literatur für
die Kombination Cello-Harfe gibt, haben wir
Werke arrangiert und ermöglichen damit einen
neuen Blick auch auf bekannte Kompositionen,
erzeugen eine besondere Atmosphäre und
Stimmung.“
Im Zentrum steht Schuberts
berührende Apreggione-Sonate, flankiert von
einem Nocturno von Franz Strauss und einem
„Lobgesang auf die Ewigkeit Jesu‘“aus dem
berühmten „Quartett auf das Ende der Zeit“ von
Olivier Messiaen. Die zweite Konzerthälfte
prägen walisische Musik und Werke englischer
Komponisten: Werke von Grace Williams und
Granville Batnock, Benjamin Brittens Sonate für
Harfe solo und drei Sätze des überschwänglichen
Tonmalers Edward Elgar.
„Zwei
Saiteninstrumente, das eine gezupft, das andere
gestrichen, schaffen ganz besondere
Klangkombinationen“ versprechen Johanna Görißen
und Michael Wehrmeyer - und beantworten die
Frage, warum man dieses Konzert besuchen sollte:
„Weil wir mit Sicherheit ein unvergessliches
Konzert hinzaubern!!“
Konzertkarten (12
€/ Schüler + Studenten 5 €) gibt es unter
www.kleve.reservix.de, an allen
Reservix-VVK-Stellen (Buchhandlung Hintzen,
Niederrhein Nachrichten, Klever Rathaus-Info),
Einlass: 17.30 Uhr, Konzert mit Pause.m Elaya
Hotel Kleve, in der Neuen Mitte sowie per Mail
an gig@klever-jazzfreunde.de erhältlich. Der
Einlass zum Konzert ist bereits um 19:30 Uhr.
Tanz in den Mai in & an der
Gerichtskantine Kleve
Mi.,
30.04.2025 - 19:00 - Do., 01.05.2025 - 02:00 Uhr
KLE Event und CG Gastro organisieren in der
Gerichtskantine das Event für Kleve zum Tanz in
den Mai. Am 30. April 2025 wird in der
Gerichtskantine Kleve ein unvergesslicher Abend
voller Musik, Tanz und Genuss veranstaltet.
Das Highlight des Abends: Schlagerstar
Normen Langen, der mit seinen Hits das Publikum
begeistern wird. Doch damit nicht genug - für
den perfekten Mix aus Party-Sounds und
mitreißenden Beats sorgen DJ Carlos und das Team
von Magic Sound, die gemeinsam die Tanzfläche
zum Beben bringen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt:
Verschiedene Grillstationen bieten eine Auswahl
von vegetarischen Gerichten und saftigem
Grillfleisch. Frisch Gezapftes und viele Drinks
stehen in unserer Cocktailbar für Euch bereit.
Und wer clever feiert, nutzt die Happy Hour von
20 bis 21 Uhr!
Tickets gibt es bei
unserem Ticketpartner: Klever Festzelt unter
https://www.kleverfestzelt.de/
Für alle
Unentschlossenen gibt es eine Abendkasse.

NRW-Wirtschaft importierte 2024 fast 50
Prozent weniger Orchideen, Hyazinthen, Narzissen
und Tulpen als im Vorjahr
Im Jahr 2024 importierte die NRW Wirtschaft nach
vorläufigen Ergebnissen über 2 000 Tonnen
Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen mit
einem Warenwert von 22,4 Millionen Euro. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, waren dies
47,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Damals
wurden rund 4 000 Tonnen Orchideen, Hyazinthen,
Narzissen und Tulpen im Wachstum oder in der
Blüte importiert.
Gemessen an der
Importmenge waren 2024 die Niederlande mit einem
Anteil von fast 93 Prozent das bedeutendste
Herkunftsland, gefolgt von Dänemark mit
6,2 Prozent und Polen mit 0,38 Prozent. Außerdem
importierte die NRW-Wirtschaft über 3 500 Tonnen
Knollen, Kronen und Rhizome (z. B. Ingwer) im
Wachstum oder in der Blüte im Wert von
15,5 Millionen Euro. Damit war die Importmenge
ähnlich zum Vorjahr. Auch hier waren die
Niederlande mit fast 99,0 Prozent (3 477 Tonnen)
das wichtigste Herkunftsland.
Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im
Februar 2025: +0,3 % zum Vormonat
Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe,
Februar 2025
+0,3 % real zum Vormonat
(kalender- und saisonbereinigt)
+1,3 % real
zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Reichweite des Auftragsbestands
7,7 Monate'
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand
im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) im Februar 2025 gegenüber Januar 2025
saison- und kalenderbereinigt um 0,3 %
gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat
Februar 2024 stieg der Auftragsbestand
kalenderbereinigt um 1,3 %.
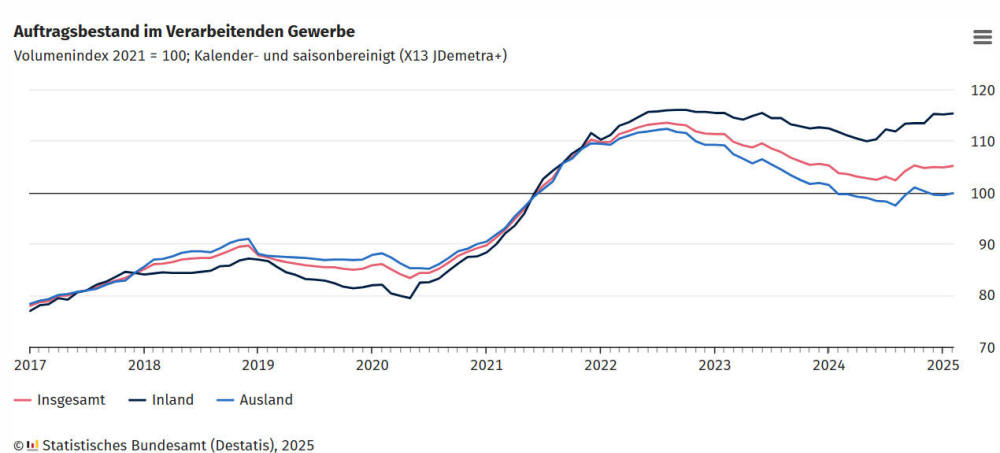
Die leicht positive Entwicklung des
Auftragsbestands im Februar 2025 ist auf
Anstiege in der Automobilindustrie (saison- und
kalenderbereinigt +0,8 % zum Vormonat) und im
Maschinenbau (+0,4 %) zurückzuführen. Negativ
beeinflusste das Gesamtergebnis der Rückgang in
der Metallerzeugung und -bearbeitung (-1,1 %).
Die offenen Aufträge aus dem Inland
stiegen im Februar 2025 gegenüber Januar 2025 um
0,2 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland
erhöhte sich um 0,4 %. Bei den Herstellern von
Vorleistungsgütern sank der Auftragsbestand um
0,1 % und im Bereich der Konsumgüter um 0,3 %.
Bei den Herstellern von
Investitionsgütern nahm der Auftragsbestand um
0,5 % zu. Reichweite des Auftragsbestands auf
7,7 Monate gestiegen Im Februar 2025 stieg die
Reichweite des Auftragsbestands im
Vormonatsvergleich auf 7,7 Monate (Januar 2025:
7,6 Monate).
Bei den Herstellern von
Investitionsgütern stieg die Reichweite auf
10,5 Monate (Januar 2025: 10,3 Monate), bei den
Herstellern von Konsumgütern stieg die
Reichweite auf 3,7 Monate (Januar 2025: 3,6) und
bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb
die Reichweite unverändert bei 4,3 Monaten.
Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die
Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue
Auftragseingänge theoretisch produzieren
müssten, um die vorhandenen Aufträge
abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus
aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz
der vergangenen zwölf Monate im betreffenden
Wirtschaftszweig berechnet.
Ostermontag, 21. April
2025
Moers: Abendlicher Spaziergang
mit Einkehr zum Feierabend
Feierabend! Zu einem gemütlichen abendlichen
Bummel von A wie ‚Altmarkt‘ bis Z wie
‚Zwergengasse‘ lädt Renate Brings-Otremba am
Freitag, 26. April, um 18.30 Uhr ein. Treffpunkt
ist am Denkmal für König Friedrich I. auf dem
Neumarkt.
Die Teilnehmenden hören
allerlei Interessantes über die facettenreiche
Moerser Stadtgeschichte. Zum geselligen
Abschluss lässt die Gruppe den Abend mit
leckeren Häppchen im Café und Feinkosthandlung
‚Gourmoers‘ ausklingen. Die Teilnahme kostet
26,20 Euro für Führung inklusive einem Getränk
und etwas ‚zum Picken‘.
Wanderung durch Meerbeck-Hochstraß
Zu einer Erkundung der Bergmannssiedlung
Meerbeck-Hochstraß geht es am Sonntag, 27.
April. Start ist um 10.30 Uhr auf dem Markplatz
in Meerbeck (Johann-Esser-Platz/Lindenstraße).
Das von 1904 bis 1913 entstandene Quartier für
Mitarbeitende der ehemaligen Zeche Rheinpreußen
liegt zwischen Schacht IV und V an der
Gemeindegrenze von Moers zu Baerl.
Nach
umfangreicher Sanierung in den Jahren 1981 bis
1996 zählt es zu den wenigen gut erhaltenen und
typischen Zechensiedlungen, die nach der
Jahrhundertwende erbaut wurden. Die
geschichtlichen Hintergründe erläutert der
Buchautor und Gästeführer Dr. Wilfried Scholten.
Die Teilnahme kostet pro Person 8 Euro.
Verbindliche Anmeldungen zu den Führungen sind
in der Stadt- und Touristinformation von Moers
Marketing möglich: Kirchstraße 27a/b, Telefon 0
28 41 / 88 22 6-0.
Dinslaken: Auftakt des STADTRADELNs –
Jetzt noch schnell anmelden!
Bald
geht es wieder los: Am Sonntag, den 4. Mai
beginnt die Aktion STADTRADELN mit einer
Auftakt-Fahrradtour quer durch Dinslaken.

STADTRADELN durch Dinslaken - bei jedem Wetter
schön!
Interessierte treffen sich am
10:00 Uhr im Burginnenhof, von hier aus geht es
unter anderem an der neuen Emschermündung
vorbei, durch den Volkspark, zum Bergpark und zu
den Erinnerungsbäumen. Die Tour dauert rund zwei
Stunden und es wird in einem gemütlichen Tempo
gefahren. Anschließend besteht im Burginnenhof
die Möglichkeit, sich über die gefahrenen Wege
auszutauschen, zu diskutieren und Fragen zu
stellen.
Eine Anmeldung für die Tour ist
nicht erforderlich, wer aber generell beim
STADTRADELN, als Einzelperson oder als Team,
mitmachen möchte, kann sich auf der
STADTRADELN-Seite der Stadt Dinslaken (www.stadtradeln.de/dinslaken)
anmelden. Für Fragen steht der Stadtkoordinator
Stephan Dinn unter stadtradeln@dinslaken.de bzw.
unter 02064/66-374 zur Verfügung.
Am
bundesweiten Wettbewerb STADTRADELN beteiligt
sich Dinslaken gemeinsam mit den anderen Städten
des Kreises Wesel. Dieser wird durchgeführt vom
Klima-Bündnis e.V., dem größten kommunalen
Netzwerk für Klimaschutz. Bei dem Wettbewerb
nutzen die Teilnehmenden drei Wochen lang – bis
einschließlich dem 24. Mai - für ihre Wege so
oft wie möglich das Fahrrad oder Pedelec.
Die gefahrenen Kilometer werden entweder auf
der Internetplattform eingetragen oder per
STADTRADELN-App direkt erfasst. „Wir in
Dinslaken nutzen das Fahrrad als
klimafreundliches und gesundes Verkehrsmittel
häufig. In den letzten Jahren sind die
Teilnehmerzahlen bei uns stetig angestiegen. Ich
vertraue darauf, dass wir auch 2025 gemeinsam
viel CO₂ einzusparen und mit dem Fahrrad
unterwegs sind“, sagt Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel.
Im letzten Jahr konnten die
Menschen aus Dinslaken erneut einen Rekord
aufstellen. Die 1.303 Teilnehmenden sind
insgesamt über 215.000 km geradelt. Die Stadt
Dinslaken freut sich auch in diesem Jahr auf
eine rege Teilnahme. Es gibt in diesem Jahr
wieder etwas zu gewinnen. Unter allen aktiv
Teilnehmenden werden Dinslakener
Einkaufsgutscheine verlost.
Für die
besten Schulklassen gibt es erneut einen
Zuschuss zur Klassenkasse zu gewinnen. Hierbei
treten die Grundschulklassen, die fünften und
sechsten, die siebten und achten, die neunten
und zehnten Klassen und die Oberstufen aller
teilnehmenden Dinslakener Schulen jeweils
gegeneinander an. Die Preise werden von den
Stadtwerken Dinslaken, der Niederrheinischen
Sparkasse Rhein-Lippe und der Volksbank
Rhein-Lippe zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich findet am Dienstag, 10. Mai von 10
bis etwa 13 Uhr eine spannende Fahrradtour mit
dem Schwerpunkt Fairtrade und Nachhaltigkeit und
am 14. Mai von 16 bis etwa 19 Uhr eine
Fahrradtour zu den Themen Klima- und
Umweltschutz statt. Auf den Touren werden durch
Verwaltungsmitarbeitende viele Informationen zu
den jeweiligen Themen vermittelt.
Im
Anschluss besteht jeweils noch die Möglichkeit
zu einem gemeinsamen, nachhaltigen Picknick, zu
dem jede*r Teilnehmende etwas mitbringen kann.
Der Treffpunkt zu den Führungen ist die
Stadtinformation am Rittertor. Ein eigenes
Fahrrad ist mitzubringen.
Die
Teilnahmegebühr beträgt hier 5 Euro pro Person.
Eine vorherige Anmeldung ist hier erforderlich
und wird von der Stadtinformation am Rittertor
unter Tel. 02064 – 66 222 oder per E-Mail an
stadtinformation@dinslaken.de entgegengenommen.
Kleve: Führung durch die
Schwanenburg am 03. Mai 2025

Blick über den Spoykanal mit blühenden
Kirschblütenbäumen und der Schwanenburg im
Hintergrund
Schwanenburgfans mussten
lange warten, aber nun ist der Schwanenturm
wieder geöffnet und entsprechend erfreuen sich
die Führungen durch die Klever Burg größter
Beliebtheit. Um der Nachfrage gerecht zu werden,
bietet die Wirtschaft, Tourismus und Marketing
Stadt Kleve GmbH (WTM) eine Zusatzführung am
Samstag, den 03. Mai 2025 um 14.30 Uhr an, zu
der man sich ab sofort online auf
www.kleve-tourismus.de oder telefonisch unter
02821 84806 anmelden kann.
Stadtführerin
Wiltrud Schnütgen führt in ca. 90 Minuten durch
die Burg und bis in den Speicher des
Schwanenturms, wo auch die Glocken bewundert
werden können. „Der Blick vom Schwanenturm über
Kleve ist einfach einmalig und ein Muss für
jeden Besucher unserer schönen Stadt“, findet
Martina Gellert, Teamleiterin Tourismus bei der
WTM. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 € pro Person,
für Familien gibt es einen Sonderpreis von 17 €.
Gruppen können die Führung durch das Klever
Wahrzeichen übrigens auch zum Wunschtermin
buchen.
Top Secret und
plötzlich wieder aktuell: Der Regierungsbunker
im Ahrtal
Das Ahrtal gilt vielen als
eine malerische Genuss- und Wanderregion – doch
unter den Rebhängen bei Ahrweiler verbirgt sich
ein Ort, der aktueller kaum sein könnte: der
ehemalige Regierungsbunker der Bundesrepublik
Deutschland. In Zeiten internationaler Krisen
und globaler Unsicherheiten rückt das einst
streng geheime Bauwerk des Kalten Krieges wieder
ins öffentliche Bewusstsein – als Mahnmal, als
Museum und als eindrucksvolles Zeugnis deutscher
Zeitgeschichte.

2000 Jahre Geschichte in 2000 Schritten - Foto:
Dominik Ketz
In der Rotweinmetropole
Ahrweiler erleben Besucher auf engstem Raum eine
Zeitreise durch zwei Jahrtausende: Die Römer
hinterließen hier eine riesige Villa Rustica,
deren Erhaltungszustand jenseits der Alpen
ihresgleichen sucht. Im Museum Roemervilla
begleiten die Besucher eine römische
Adelsfamilie in ihrem Heim mit Küche, eigenem
Badetrakt und Wohnräumen, die mit einer
innovativen Fußboden- und Wand-Heizungsanlage
ausgestattet war.
Nur wenige Gehminuten
entfernt beginnt inmitten des Ahrweiler
Stadtmauerrings aus dem 13. Jahrhundert die
Reise in mittelalterliche Zeiten. Wer durch eine
der vier mächtigen Stadttore die Ahrweiler
Altstadt betritt, fühlt sich zwischen engen
Gassen und Fachwerkhäusern, Wehrgängen,
Marktschänken, alt ehrwürdigen Adelshöfen und
der imposanten Pfarrkirche zurückversetzt in die
Zeit der Ritter und Lehnsleute, Mönche und
Kaufleute. Bei der Nachtwächter-Führung tauchen
die Gäste im Schein der abendlichen Laternen ein
in Geschichten und Anekdoten.
Die
Bunkeranlage: Ein Besuch, der unter die
Oberfläche geht
Versteckt in zwei
stillgelegten Eisenbahntunneln oberhalb von
Ahrweiler liegt ein einzigartiges historisches
Zeitzeugnis. Ab den 1960er Jahren entstand ein
20 Kilometer langes unterirdisches Schutzsystem
– ausgestattet mit Kommandozentrale,
Zahnarztpraxis, Friseursalon, eigenem
Fernsehstudio und dem Zimmer des Bundeskanzlers.
Für bis zu 3.000 Personen konzipiert, sollte der
Bunker im Ernstfall den Fortbestand der
Bundesregierung sichern.

Dokumentationsstätte Regierungsbunker - Foto:
Dominik Ketz
Heute ist die
Dokumentationsstätte Regierungsbunker mehr als
ein Ort der Erinnerung: Es ist ein Spiegelbild
historischer Ängste und aktueller Debatten.
Gerade jetzt, wo geopolitische Spannungen
weltweit zunehmen, gewinnt der Ort neue
Bedeutung – nicht nur als technisches
Meisterwerk, sondern als mahnendes Symbol für
Frieden und Demokratie.
Die massiven
Rolltore öffnen sich heute nicht mehr für
Regierungsmitglieder, sondern für Menschen mit
Interesse an Geschichte, Sicherheitspolitik –
und der Frage, wie nah Vergangenheit und
Gegenwart beieinanderliegen können. Der
ehemalige Regierungsbunker erinnert daran, wie
kostbar Frieden ist – und wie wichtig es ist,
aus der Geschichte zu lernen.
www.ahrtal.de/regierungsbunker
Licht und Schatten im Bereich Technik
und Innovation im Koalitionsvertrag von Union
und SPD
CSU-Chef Markus Söder
verspricht mit dem Ministerium Forschung,
Technologie und Raumfahrt eine Technik-Attacke
der neuen Bundesregierung. Dazu erklärt
VDI-Direktor Adrian Willig:

VDI-Direktor Adrian Willig: "Wir schlagen eine
unabhängige Beratung der neuen Bundesregierung
durch ein externes Gremium vor."
„Der
Aufbau eines zentralen Ministeriums für
Zukunftstechnologien mit dem Ministerium für
Forschung, Technologie und Raumfahrt ist ein
starkes Signal und ein überfälliger Schritt.
Jetzt darf der Aufbauprozess des neuen
Ministeriums nicht zu einer monatelangen
Selbstbeschäftigung führen, sondern den großen
Worten müssen auch große Taten folgen.
Erste Amtshandlung der neuen Leitung des
Technologie- und Forschungsministeriums muss die
Einberufung eines Innovationsgipfels sein. Wir
brauchen eine langfristige Innovationsstrategie
des Bundes, die gezielt Schlüsseltechnologien
der Zukunft stärkt. Das reicht von KI über
Quantentechnologien bis zur klimaneutralen
Produktion. Der Fokus auf Schlüsseltechnologien
der neuen Bundesregierung im Bereich der
Forschungs- und Innovationsförderung ist daher
begrüßenswert.
Und auch wenn die
Finanzierung noch nicht geklärt ist, ist eine
angestrebte Erhöhung der Aufwendungen für
Forschung und Entwicklung auf mindestens 3,5
Prozent des BIP der richtige Weg. Klar ist
jedoch für all diese Vorhaben: Dazu braucht es
ausreichend hochqualifizierte Fachkräfte im
Ingenieur- und IT-Wesen. Ingenieurinnen und
Ingenieure werden für all diese Pläne eine
zentrale Rolle spielen und daher ist es umso
bedauerlicher, dass im Koalitionsvertrag das
Wort „Ingenieur“ überhaupt nicht vorkommt.
Wichtig für den Wirtschaftsstandort ist aber
nicht nur, wie wir Technologien fördern, sondern
vor allem, wie wir in die Umsetzung kommen. Die
angekündigte Investitionsoffensive mit zehn
Milliarden Euro wird alleine ohne die
Innovationskraft der Unternehmen nicht reichen.
Wir schlagen daher eine unabhängige Beratung
der neuen Bundesregierung durch ein externes
Gremium vor, um die angekündigte Technik-Attacke
von Markus Söder mit wissenschaftlicher
Expertise und technologischer Weitsicht
strategisch zu untermauern.“
Koalitionsvertrag greift im Bereich der
psychischen Gesundheit zu kurz – BDP sieht hier
deutlichen Nachbesserungsbedarf
Wir
brauchen eine neue Kultur der Wertschätzung und
des Vertrauens – und mit der Psychologie einen
Motor für politische und gesellschaftliche
Veränderungsprozesse
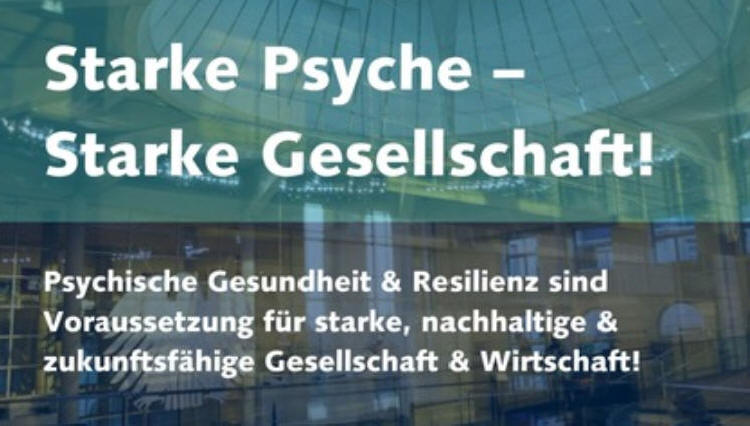
Deutschland steht vor großen und vielfältigen
Herausforderungen, die bei einem Großteil der
Bevölkerung zu starker Verunsicherung führen.
Die globalen politischen Entwicklungen, der
Klimawandel sowie Umweltkatastrophen, globale
Krisenherde und Kriege, eine deutlich spürbare
Inflation, aber auch Themen wie Migration,
soziale Ungleichheit und eine zunehmende
gesellschaftliche Spaltung belasten viele
Menschen in Deutschland. Gleichzeitig scheint
das Vertrauen in eine lösungsorientierte
Handlungsfähigkeit der Politik immer weiter zu
schwinden.
Mit dem nun unterzeichneten
Koalitionsvertrag setzt die neue Bundesregierung
auf mehr staatliche Kontrolle, eine Verschärfung
von Sanktionen und Einschränkung von Rechten,
auch bei Menschen mit psychischen Erkrankungen,
um damit für ein mehr an (gefühlter) Sicherheit
in Deutschland zu sorgen.
Der Wunsch nach
einfachen und schnellen Lösungen ist stark, doch
für ein neues Vertrauen in die Politik und
Zusammenhalt in der Gesellschaft braucht es
einen partizipativen, lösungsorientierten Ansatz
und Politiker*innen, die die Verunsicherung und
Bedürfnisse der Menschen in Deutschland
glaubwürdig ernst nehmen.
Der
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP) sendet einen deutlichen Appell
in Richtung Politik, die psychische Gesundheit
und Resilienz der Bevölkerung als Voraussetzung
und grundlegende Ressourcen für eine starke,
nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft und
auch Wirtschaft zu verstehen.
Immerhin
berücksichtigt der Koalitionsvertrag die
Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung der
psychotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung
sowie auch der Finanzierung der
psychotherapeutischen Weiterbildung. Mit der
Strategie „Mentale Gesundheit für junge
Menschen“ setzt die neue Regierung verstärkt auf
Prävention von psychischen Erkrankungen, was der
BDP begrüßt und ausdrücklich unterstützt.
Insgesamt ermuntert der Verband, bei der
Umsetzung des Koalitionsvertrags das Verständnis
psychologischer Intervention deutlich über die
Psychotherapie hinaus auszuweiten bzw. überhaupt
erst vorzusehen. Die Psychologie steuert ganz
grundlegend zur Prävention im Bereich
psychischer Gesundheit bei. Psycholog*innen
leisten einen essenziellen Beitrag zur
frühzeitigen Erkennung von Belastungen, zur
Entwicklung von Bewältigungsstrategien und zur
Förderung von Resilienz und damit zum Erhalt der
psychischen Gesundheit in allen relevanten
gesellschaftlichen Bereichen wie der
Arbeitswelt, dem Bildungs- und Gesundheitswesen
oder der öffentlichen Verwaltung.
Globale, nationale und lokale Krisen erfordern
eine kontinuierliche Bewertung und entsprechende
Verhaltensanpassung auf politischer wie auch
gesellschaftlicher Ebene. Was es dazu braucht,
ist eine umfassende strukturelle Verankerung
psychologischer Kompetenzen im Netzwerk
gesundheitspolitischer Maßnahmen, um das volle
Potenzial psychologischer Expertise zum Wohl der
Gesellschaft nutzbar machen zu können.
Als Berufsverband der Psycholog*innenschaft in
Deutschland appellieren wir an die Politik,
wichtige Reformvorhaben mutig anzustoßen. Die
Initiativen und Positionspapiere des BDP haben
dabei ein breites Themenspektrum im Blick:
In
Zeiten multipler Dauer-Krisen braucht es eine
nachhaltige psychologisch-psychotherapeutische
Versorgungssicherung für die gesamte Bevölkerung
– die fängt schon mit der Ausbildung an.
Mit Blick auf die aktuelle Weltlage fordern wir
die Verankerung der Psychosozialen
Notfallversorgung im Zivilschutz- und
Katastrophenhilfegesetz.
Die Folgen des
Klimawandels erfordern eine Strategie, die die
Gesellschaft in ihrer Resilienz und
Anpassungsfähigkeit stärkt, nachhaltige
Verhaltensveränderungen fördert und sichere
Zukunftsperspektiven schafft.
Bei den
Herausforderungen der modernen Arbeitswelt
braucht es spezifisches Fachwissen zur
effektiven Prävention und Gesundheitsförderung.
Die Lösung sehen wir in der Aufnahme der
Profession in das Arbeitssicherheitsgesetz
(ASiG). Und bei der zunehmenden Komplexität im
Bereich der Digitalisierung kann die
psychologische Expertise Risiken managen,
Kompetenzen vermitteln und Vertrauen schaffen.
Ein besonderes Augenmerk verdienen die
jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Um
Mut, Zuversicht und persönliche Perspektiven
entwickeln zu können, brauchen Kinder und
Jugendliche verlässliche und niederschwellige
Unterstützungsangebote sowie auch eine
nachhaltige Bildungspolitik.
Für alle
Bereiche der Gesellschaft gilt: Psychologie
hilft. Deshalb fordern wir dringend ein
Psycholog*innengesetz, das Orientierung bietet,
Sicherheit schafft und damit für einen besseren
Verbraucherschutz sorgt.
Die psychische
Gesundheit ist Grundlage für alle positiven
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse. Als
Verband setzen wir uns auch 2025 weiterhin dafür
ein. Denn es gilt: Starke Psyche – starke
Gesellschaft!
Teuerung für 8
von 9 Haushaltstypen leicht unter Zielinflation
Die Inflationsrate in Deutschland ist im März
gegenüber Februar von 2,3 auf 2,2 Prozent
gesunken und liegt damit sehr nahe beim
Inflationsziel der Europäischen Zentralbank
(EZB) von zwei Prozent. Verschiedene
Haushaltstypen, die sich nach Einkommen und
Personenzahl unterscheiden, weisen aktuell kaum
Unterschiede bei ihren haushaltsspezifischen
Teuerungsraten auf: Diese reichten im März von
1,7 bis 2,0 Prozent, zeigt der neue
Inflationsmonitor des Instituts für
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Zum Vergleich:
Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst
2022 betrug die Spanne 3,1 Prozentpunkte.
Während Haushalte mit niedrigen Einkommen
während des akuten Teuerungsschubs der Jahre
2022 und 2023 eine deutlich höhere Inflation
schultern mussten als Haushalte mit mehr
Einkommen, war ihre Inflationsrate im März 2025
wie in den Vormonaten leicht
unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren
mit Kindern sowie der von Alleinlebenden mit
jeweils niedrigen Einkommen verteuerte sich um
1,7 Prozent bzw. 1,8 Prozent.
Auf 1,7
Prozent Inflationsrate kamen auch
Alleinerziehende mit mittlerem Einkommen. 1,8
Prozent Teuerungsrate verzeichneten ebenfalls
Paarfamilien mit mittleren Einkommen und Paare
ohne Kinder mit mittleren Einkommen sowie
Alleinlebende mit mittleren und mit höheren
Einkommen (siehe auch die Abbildung in der
pdf-Version dieser PM; Link unten).
Auch
die Kernrate, also die Inflation ohne die
schwankungsanfälligen Posten Nahrungsmittel (im
weiten Sinne) und Energie, sank zwischen Februar
und März leicht. Im Jahresverlauf 2025 dürfte
sich die Inflationsrate weiter normalisieren und
bei gesamtwirtschaftlich zwei Prozent
einpendeln, so die Prognose des IMK. Allerdings
steigt durch den von US-Präsident Donald Trump
provozierten Zollkonflikt das Risiko, dass sie
sogar deutlich unter die Zielinflation fällt,
warnt Dr. Silke Tober, IMK-Expertin für
Geldpolitik und Autorin des Inflationsmonitors.
Denn die handelspolitische Auseinandersetzung
treibt die Gefahr einer weltweiten Rezession
hoch, die die Preisentwicklung zusätzlich
dämpfen würde.
Tober hält weitere
Zinsschritte der EZB für dringend erforderlich,
denn bereits vor den Erschütterungen durch die
erratische Politik der US-Regierung sei die
Geldpolitik im Euroraum zu restriktiv für die
schwache wirtschaftliche Dynamik gewesen. Eine
Zinssenkung auf der heutigen EZB-Ratssitzung
werde „von den Märkten bereits erwartet“. Die
Zentralbank sollte heute darüber hinaus „weitere
Lockerungen der geldpolitischen Zügel
ankündigen“, empfiehlt Tober.
Das würde
auch die Wirkung der von Union und SPD
vorgesehenen Investitionsoffensive in
Deutschland angemessen flankieren, betont die
Ökonomin. „In der aktuellen Situation sollten
Geld- und Fiskalpolitik gemeinsam ein günstiges
Umfeld für staatliche und private Investitionen
schaffen, um durch eine starke Binnennachfrage
die dämpfenden außenwirtschaftlichen Einflüsse
abzufedern.“
Das IMK berechnet seit
Anfang 2022 monatlich spezifische Teuerungsraten
für neun repräsentative Haushaltstypen, die sich
nach Zahl und Alter der Mitglieder sowie nach
dem Einkommen unterscheiden (mehr zu den Typen
und zur Methode unten). In einer Datenbank
liefert der Inflationsmonitor zudem ein
erweitertes Datenangebot: Online lassen sich
Trends der Inflation für alle sowie für
ausgewählte einzelne Haushalte im Zeitverlauf in
interaktiven Grafiken abrufen.
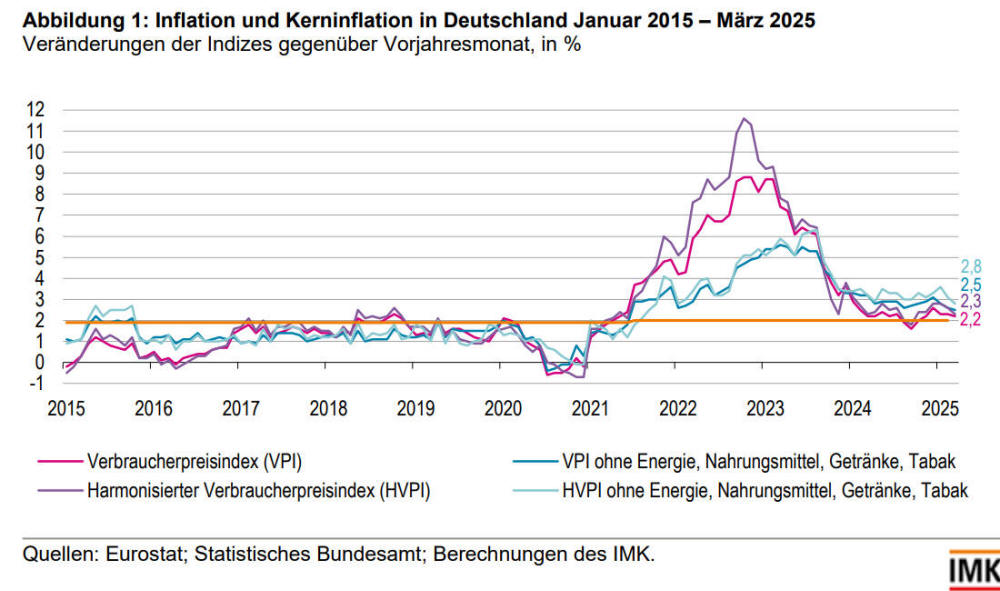
Die längerfristige Betrachtung illustriert,
dass Haushalte mit niedrigem bis mittlerem
Einkommen von der starken Teuerung nach dem
russischen Überfall auf die Ukraine besonders
stark betroffen waren, weil Güter des
Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in
ihrem Budget eine größere Rolle spielen als bei
Haushalten mit hohen Einkommen.
Diese
wirkten lange als die stärksten Preistreiber,
zeigt ein längerfristiger Vergleich, den Tober
in ihrem neuen Bericht ebenfalls anstellt: Die
Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie
Getränke lagen im März 2025 um 39,8 Prozent
höher als im März 2019, also vor Pandemie und
Ukrainekrieg. Damit war die Teuerung für diese
unverzichtbaren Basisprodukte mehr als dreimal
so stark wie mit der EZB-Zielinflation von
kumuliert 12,6 Prozent in diesem Zeitraum
vereinbar. Energie war trotz der Preisrückgänge
in letzter Zeit um 39,2 Prozent teurer als im
März 2019. Deutlich weniger stark, um 19,5
Prozent, stiegen über die sechs Jahre die Preise
für Dienstleistungen.
Auf dem Höhepunkt
der Inflationswelle im Oktober 2022 betrug die
Teuerungsrate für Familien mit niedrigen
Einkommen 11 Prozent, die für ärmere
Alleinlebende 10,5 Prozent. Alleinlebende mit
sehr hohen Einkommen hatten damals mit 7,9
Prozent die mit Abstand niedrigste
Inflationsrate.
Im März 2025 verteuerten
sich die spezifischen Warenkörbe von Haushalten
mit niedrigen bis mittleren Einkommen hingegen
etwas weniger stark als die von Haushalten mit
hohen Einkommen, weil zuletzt vor allem die
Preise für Dienstleistungen anzogen, die mit
steigendem Einkommen stärker nachgefragt werden.
Daher wiesen im Vergleich der neun
Haushaltstypen Alleinlebende mit sehr hohen
Einkommen und Familien mit hohen Einkommen mit
2,0 bzw. 1,9 Prozent geringfügig höhere Werte
aus.
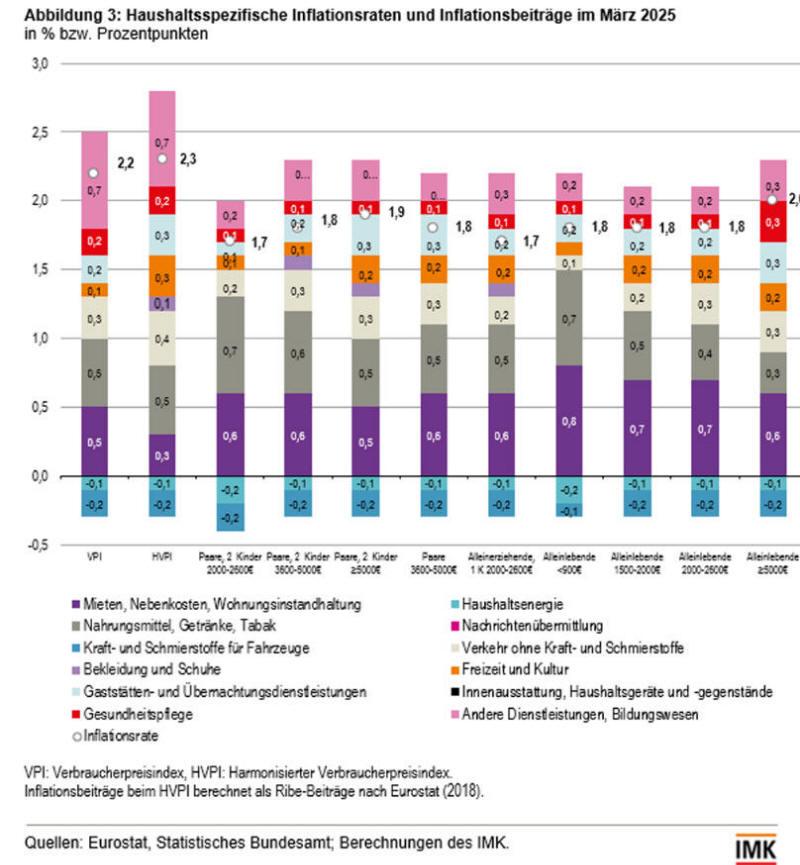
Dass aktuell alle vom IMK ausgewiesenen
haushaltsspezifischen Inflationsraten leicht
unter der Gesamtinflation liegen, wie sie das
Statistische Bundesamt berechnet, liegt an
unterschiedlichen Gewichtungen: Das IMK nutzt
für seine Berechnungen weiterhin die
repräsentative Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe, während Destatis seit
Anfang 2023 die Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung heranzieht.
Informationen
zum Inflationsmonitor
Für den IMK
Inflationsmonitor werden auf Basis der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des
Statistischen Bundesamts die für
unterschiedliche Haushalte typischen
Konsummuster ermittelt. So lässt sich gewichten,
wer für zahlreiche verschiedene Güter und
Dienstleistungen – von Lebensmitteln über
Mieten, Energie und Kleidung bis hin zu
Kulturveranstaltungen und Pauschalreisen – wie
viel ausgibt und daraus die haushaltsspezifische
Preisentwicklung errechnen. Die Daten zu den
Haushaltseinkommen stammen ebenfalls aus der
EVS.
Im Inflationsmonitor werden neun
repräsentative Haushaltstypen betrachtet:
Paarhaushalte mit zwei Kindern und niedrigem
(2000-2600 Euro), mittlerem (3600-5000 Euro),
höherem (mehr als 5000 Euro) monatlichem
Haushaltsnettoeinkommen; Haushalte von
Alleinerziehenden mit einem Kind und mittlerem
(2000-2600 Euro) Nettoeinkommen; Singlehaushalte
mit niedrigem (unter 900 Euro), mittlerem
(1500-2000 Euro), höherem (2000-2600 Euro) und
hohem (mehr als 5000 Euro)
Haushaltsnettoeinkommen sowie Paarhaushalte ohne
Kinder mit mittlerem Haushaltsnettoeinkommen
zwischen 3600 und 5000 Euro monatlich. Der IMK
Inflationsmonitor wird monatlich aktualisiert.

NRW: Höchststand an
Schwangerschaftsabbrüchen seit 2008
Für das Jahr 2024 haben Arztpraxen und
Krankenhäuser 23 445 Schwangerschaftsabbrüche
von Frauen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen
gemeldet. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, ist dies die höchste Zahl seit 2008
(damals 24 120 Schwangerschafts-abbrüche).
Nach einem Rückgang in den Jahren 2020 und
2021 stieg die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche
seit 2022 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr.
Am stärksten war der Anstieg von 2021 auf 2022
mit 13,4 Prozent. In den Folgejahren fiel er mit
3,0 Prozent in 2023 und 0,9 Prozent in 2024
schwächer aus.
Neun von zehn Frauen
waren zwischen 18 und 39 Jahre alt – drei
Prozent waren minderjährig Unter den Frauen, die
2024 einen Abbruch vornehmen ließen, waren 695
Minderjährige, das entspricht einem Anteil von
3,0 Prozent an allen Abbrüchen (2008:
4,8 Prozent).
70 Mädchen waren jünger
als 15 Jahre. Neun von zehn Frauen
(89,5 Prozent) waren zum Zeitpunkt des Abbruchs
18 bis 39 Jahre alt; die übrigen 7,6 Prozent
waren 40 Jahre oder älter. Gut die Hälfte der
Frauen (54,8 Prozent) hatte vor dem Abbruch
bereits mindestens ein Kind geboren. Von diesen
12 840 Frauen hatten 3 025 bereits drei oder
vier Kinder. Weitere 455 Frauen hatten vor dem
Schwangerschaftsabbruch fünf oder mehr Kinder.
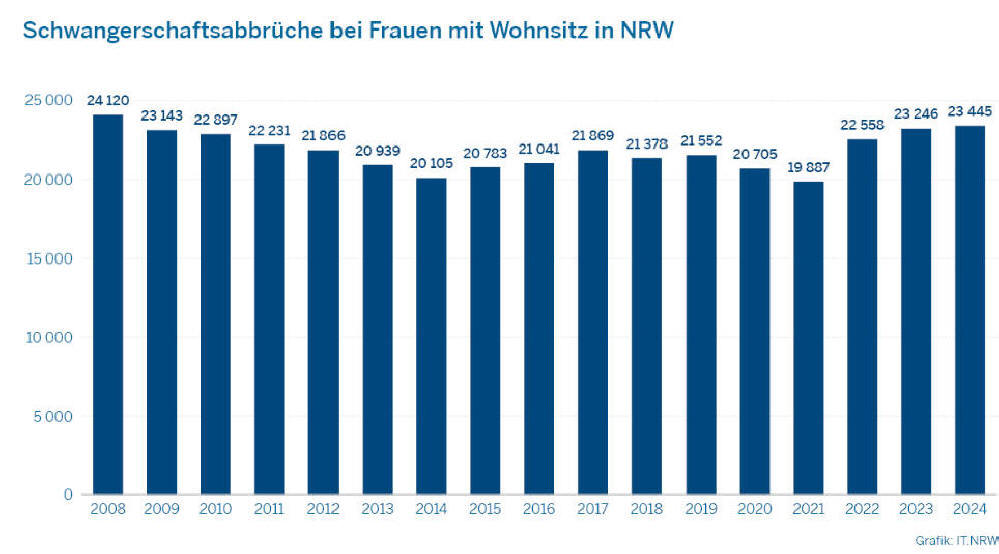
Bei rund der Hälfte der Fälle erfolgte der
Eingriff vor der siebten Schwangerschaftswoche
In 50,1 Prozent der Fälle erfolgte der
Schwangerschaftsabbruch vor der siebten
Schwangerschaftswoche; etwa 80,3 Prozent aller
Schwangerschaften wurden vor der neunten und
96,7 Prozent vor der zwölften Woche abgebrochen.
94,9 Prozent der Abbrüche erfolgten im Anschluss
an die gesetzlich vorgeschriebene Beratung.
Indikationen aus medizinischen Gründen oder
aufgrund von Sexualdelikten waren in 5,1 Prozent
der Fälle die Begründung für den Abbruch. Mit
97,3 Prozent wurden die meisten
Schwangerschaftsabbrüche ambulant in Arztpraxen
und Krankenhäusern durchgeführt; 2,8 Prozent der
Eingriffe erfolgten stationär in Krankenhäusern.
(IT.NRW)
NRW: Im Jahr 2024
verdienten Vollzeitbeschäftigte 62 119 Euro
brutto
Im Jahr 2024 betrugen die
durchschnittlichen Bruttojahresverdienste (inkl.
Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Nordrhein-Westfalen 62 119 Euro. Mit einem
durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von
105 975 Euro lagen vollzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer/-innen im Bereich der „Kokerei und
Mineralölverarbeitung” an der Spitze der
Verdienste in Nordrhein-Westfalen.
Wie
das Statistische Landesamt weiter mitteilt,
waren ihre Bruttojahresverdienste damit fast
44 000 Euro höher als der Durchschnittswert
aller Wirtschaftszweige. Platz zwei und drei im
Verdienstranking belegten die Beschäftigten der
Wirtschaftsabteilungen „Kohlenbergbau“ und
„Erbringung von Finanzdienstleistungen“.
Zu den weiteren Spitzenverdienern gehörten die
Vollzeitbeschäftigten der Wirtschaftsabteilungen
„Kohlenbergbau” (97 576 Euro), „Erbringung von
Finanzdienstleistungen” (93 446 Euro),
„Verwaltung und Führung von Unternehmen und
Betrieben” (93 015 Euro), „Energieversorgung”
(92 185 Euro) sowie „Telekommunikation”
(85 356 Euro).
Die Bruttoverdienste im
Bereich der Gastronomie lagen am Ende der
Verdienstskala Am unteren Ende der
Verdienstskala befanden sich die
Vollzeitbeschäftigen in den Bereichen
„Gastronomie” (36 732 Euro), „Erbringung von
sonstigen überwiegend persönlichen
Dienstleistungen” (37 773 Euro),
„Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene
Tätigkeiten” (37 942 Euro), „Beherbergung”
(39 635 Euro), „Gebäudebetreuung, Garten- und
Landschaftsbau” (43 003 Euro) und „Spiel-, Wett-
und Lotteriewesen” (43 861 Euro).
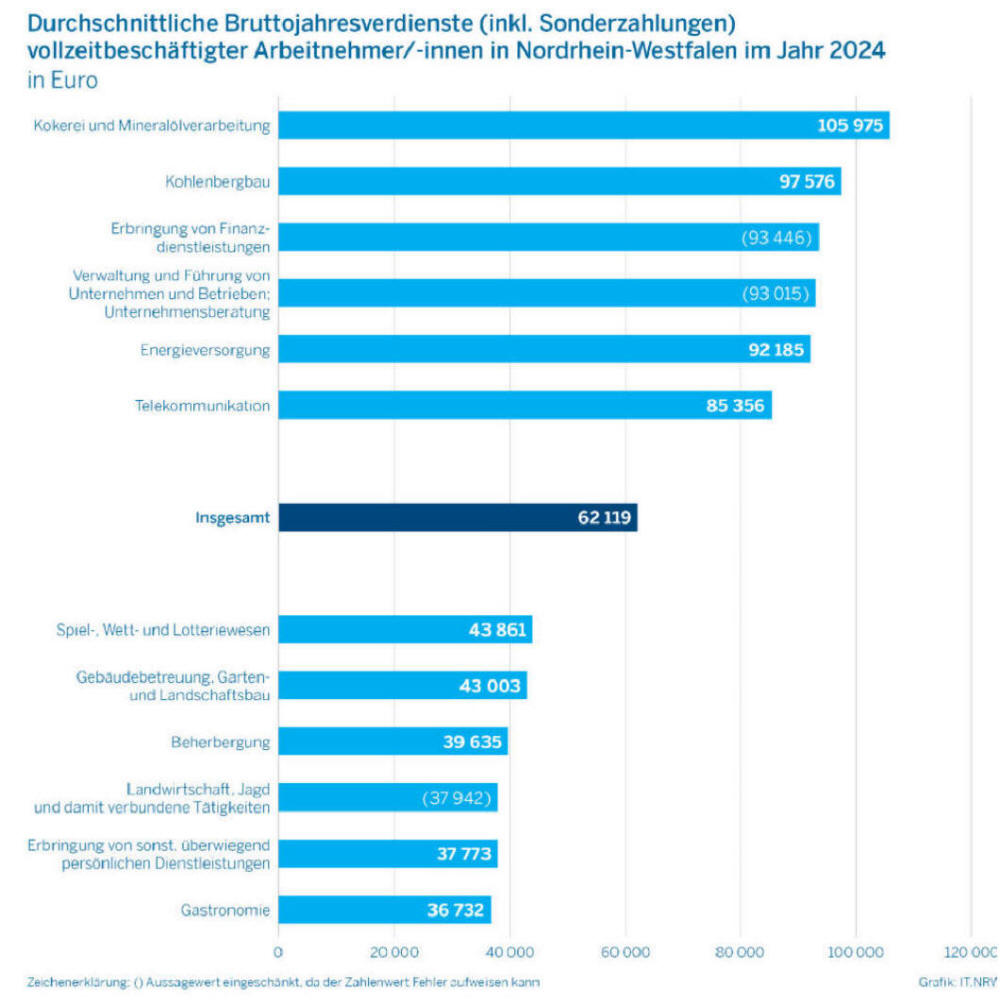
|