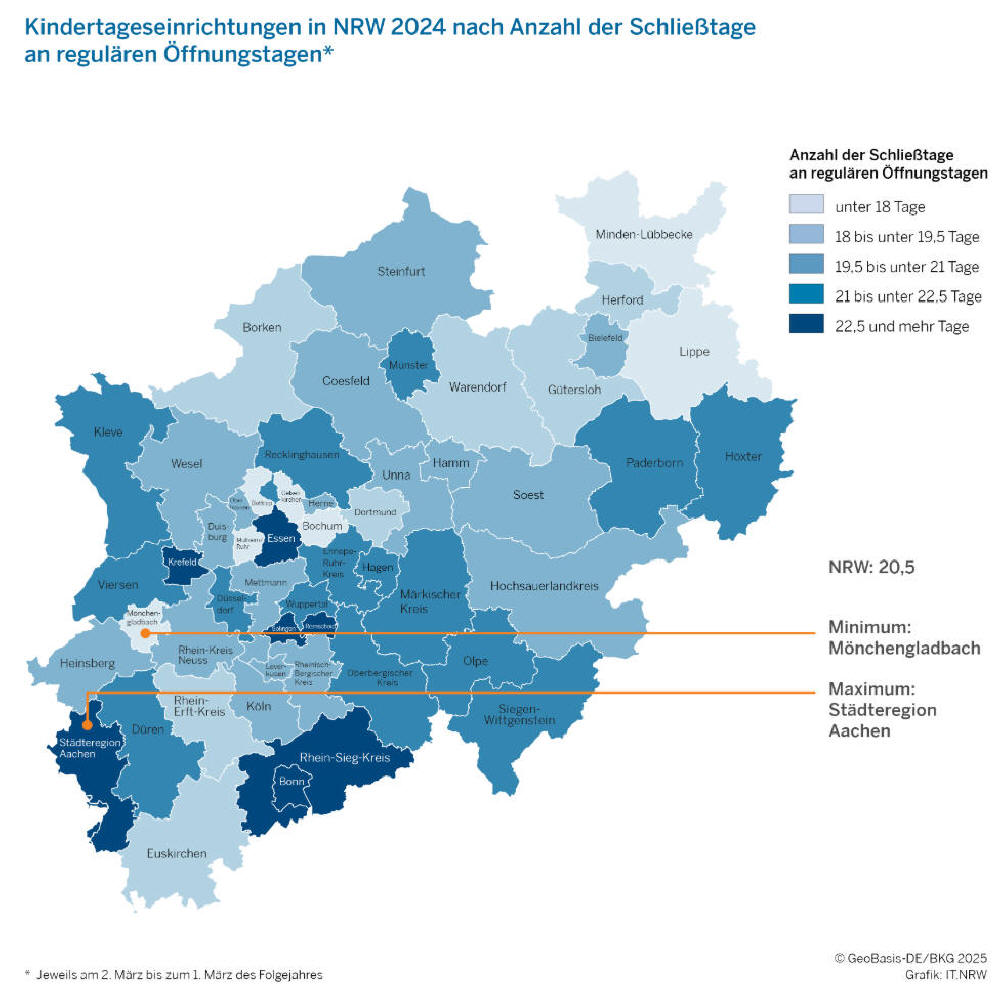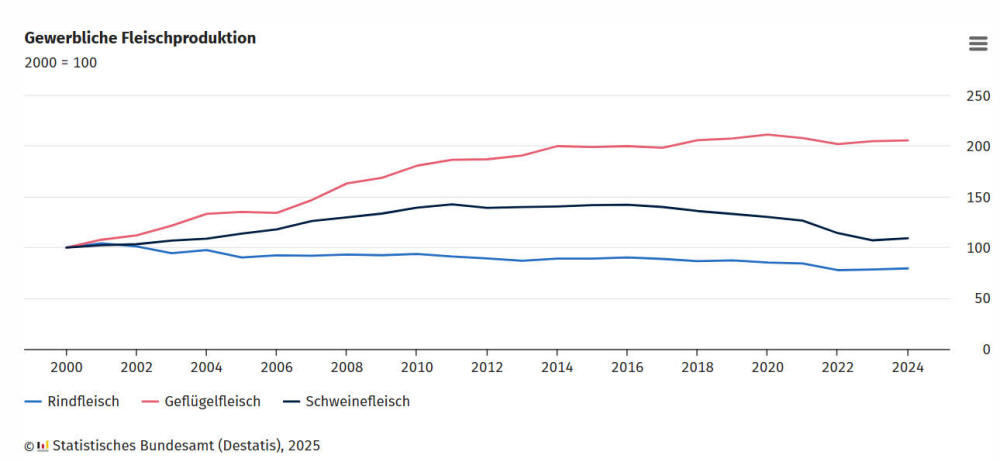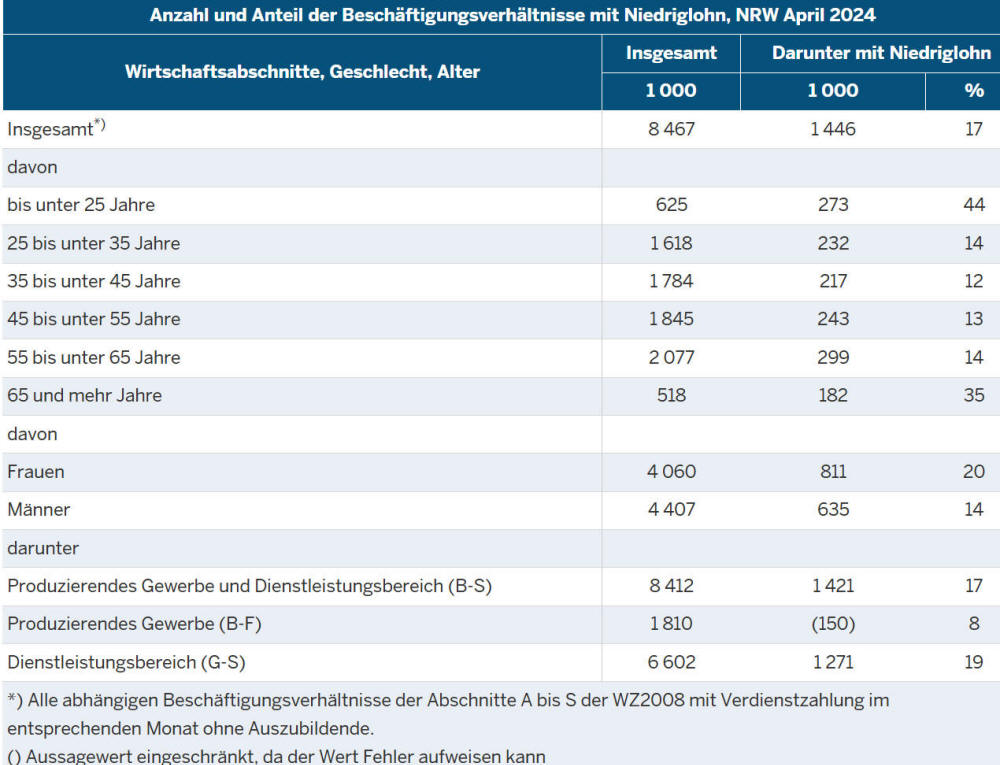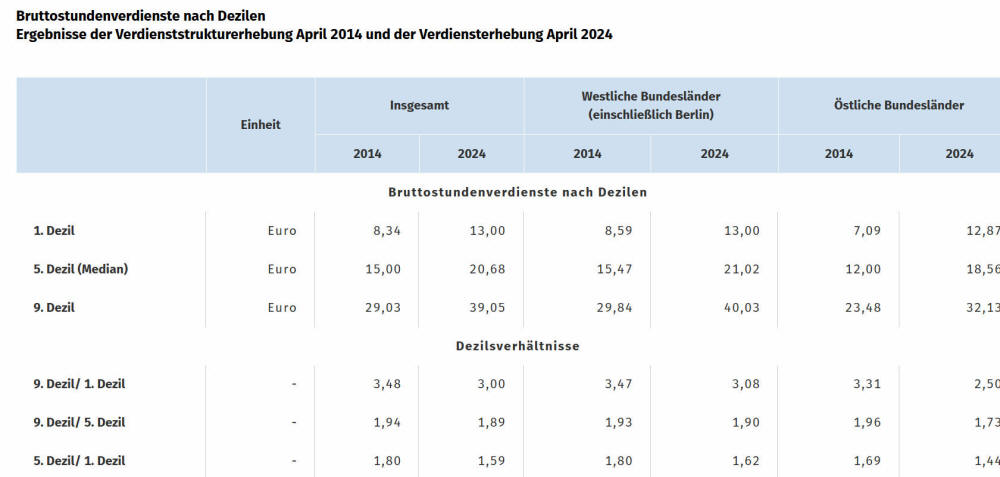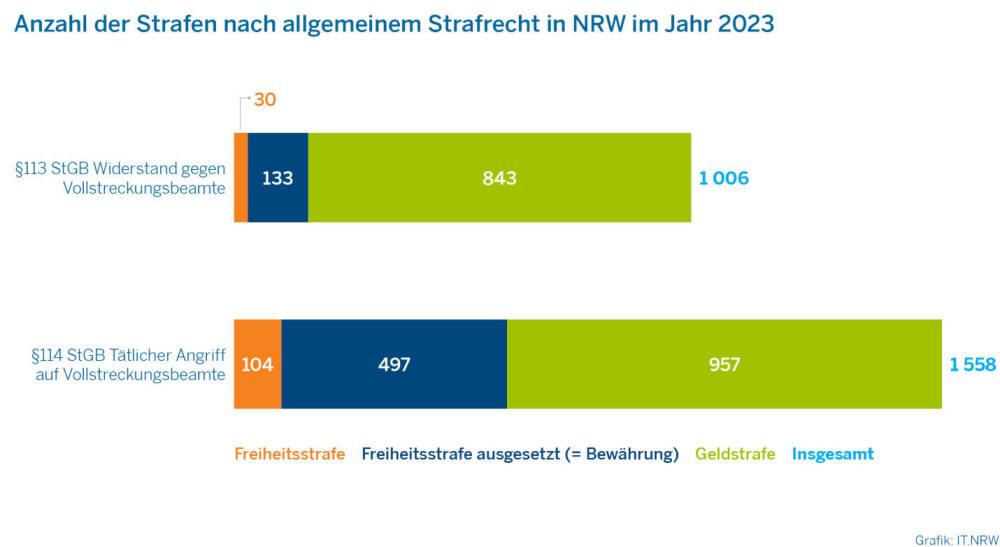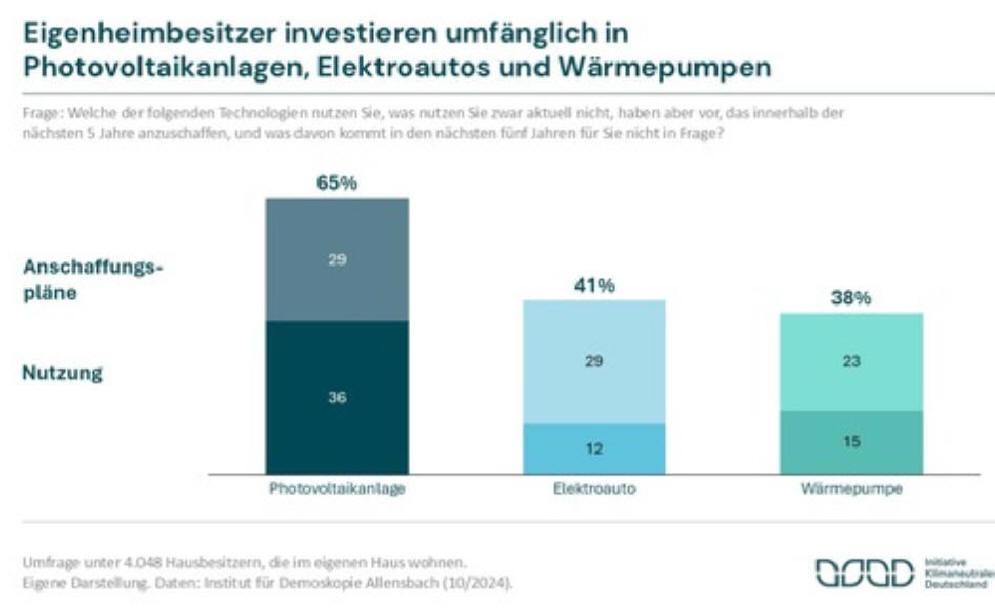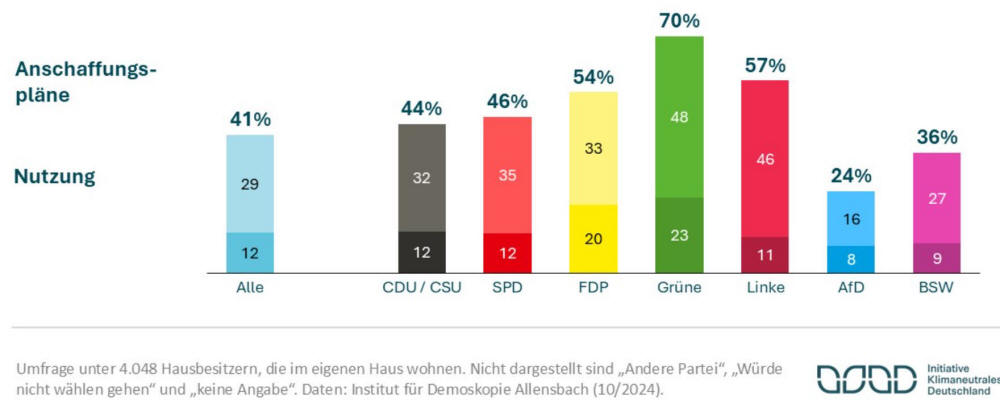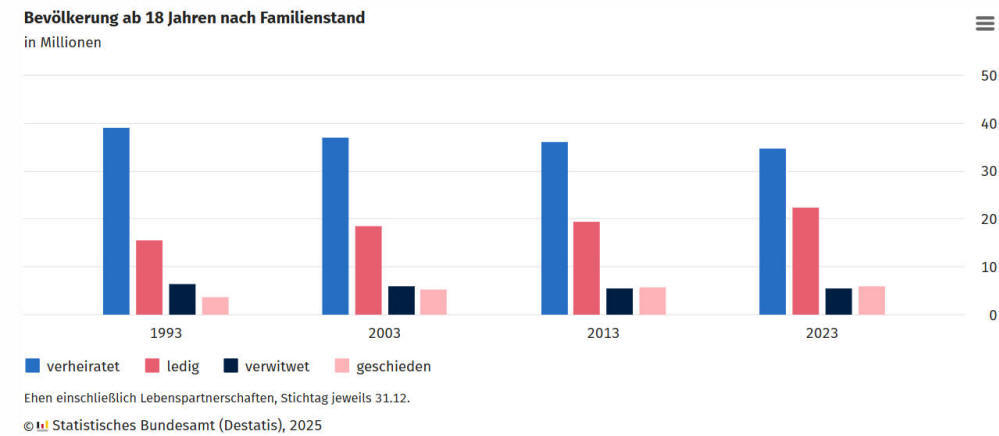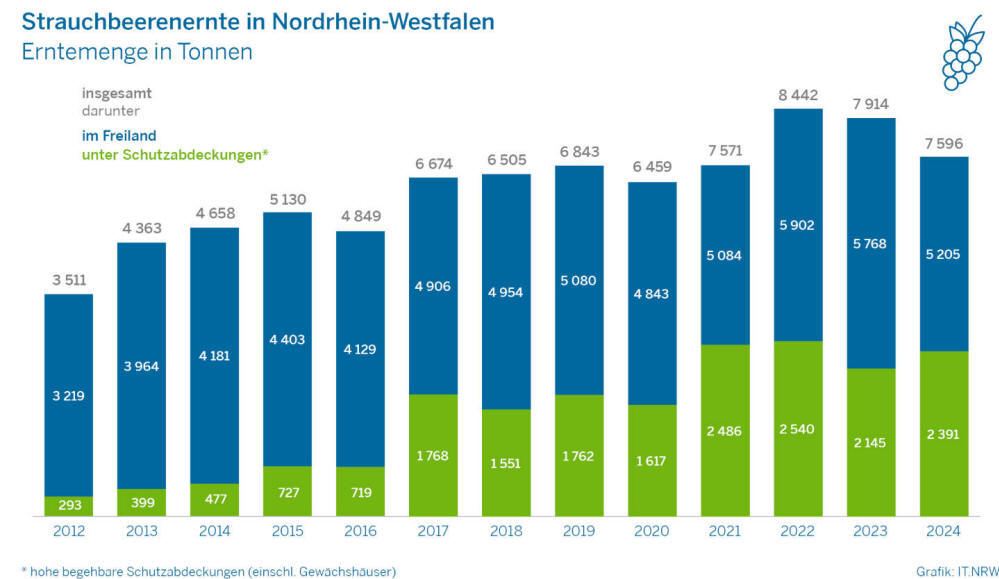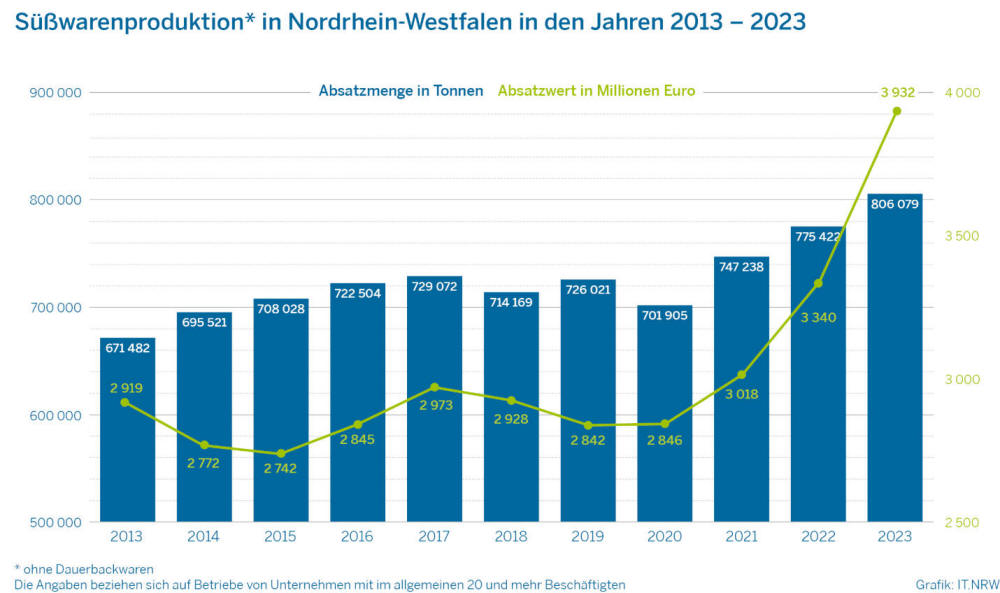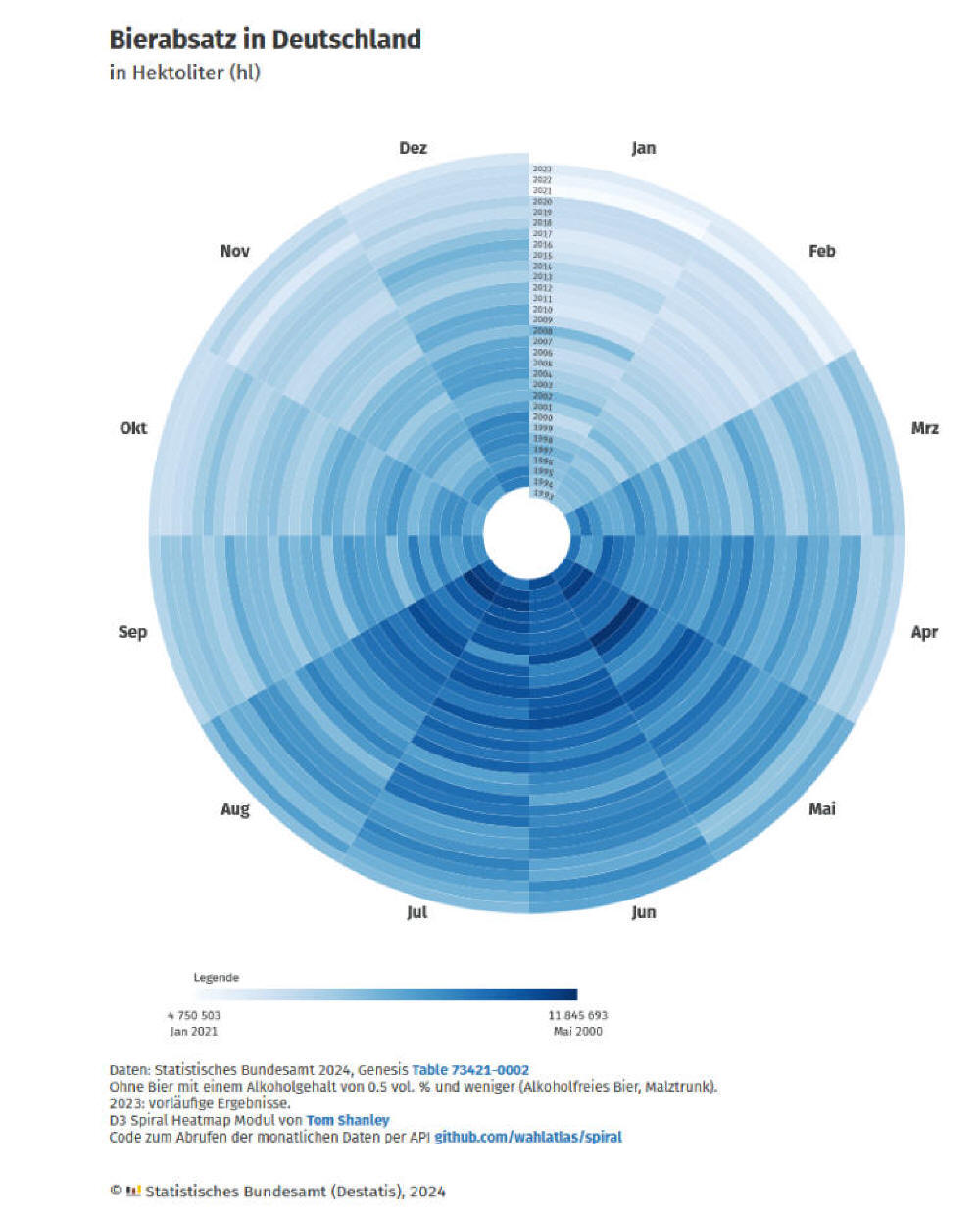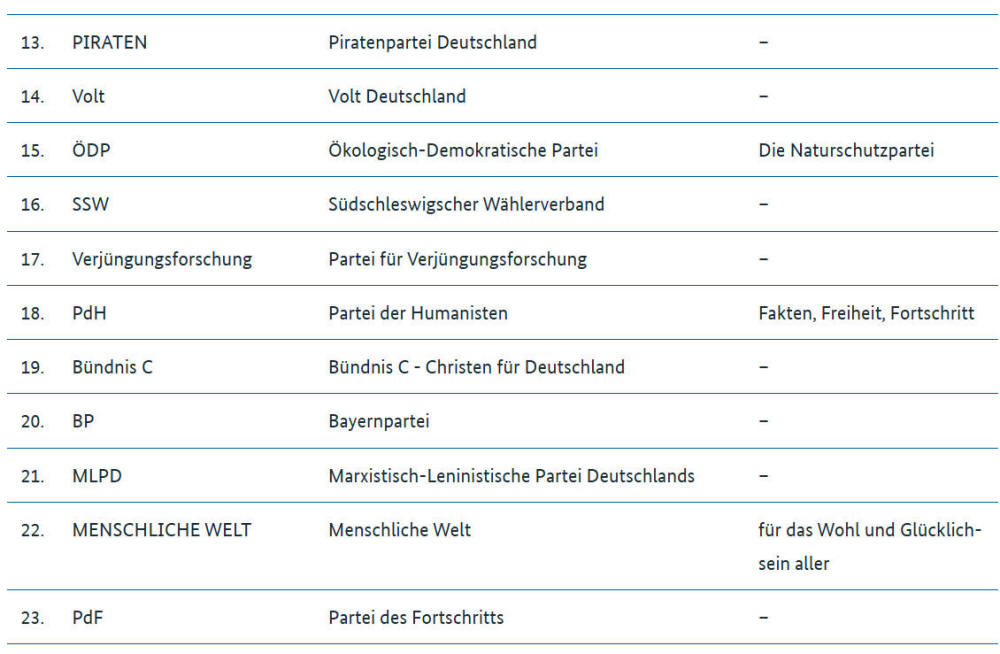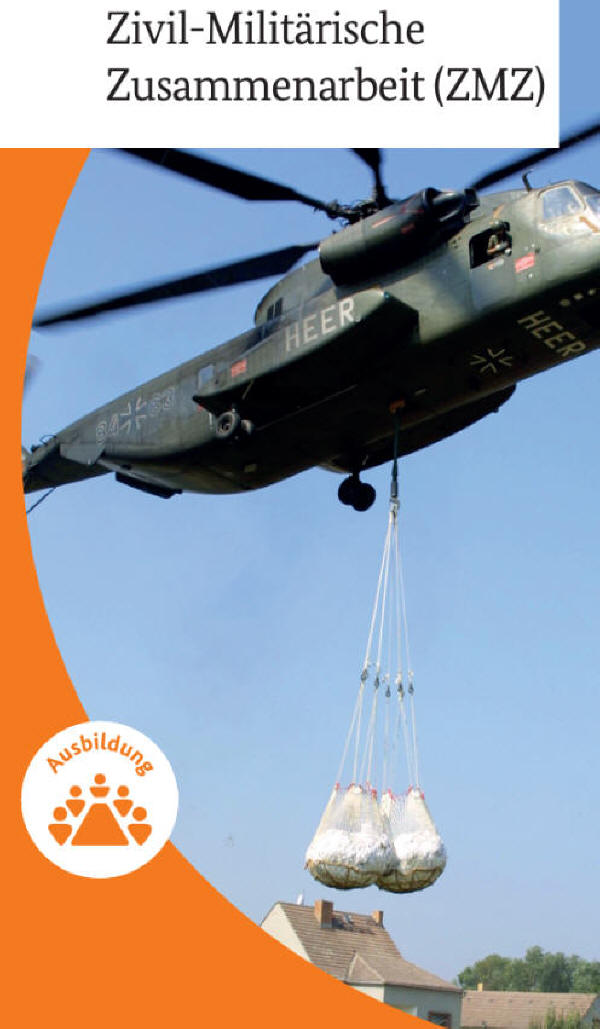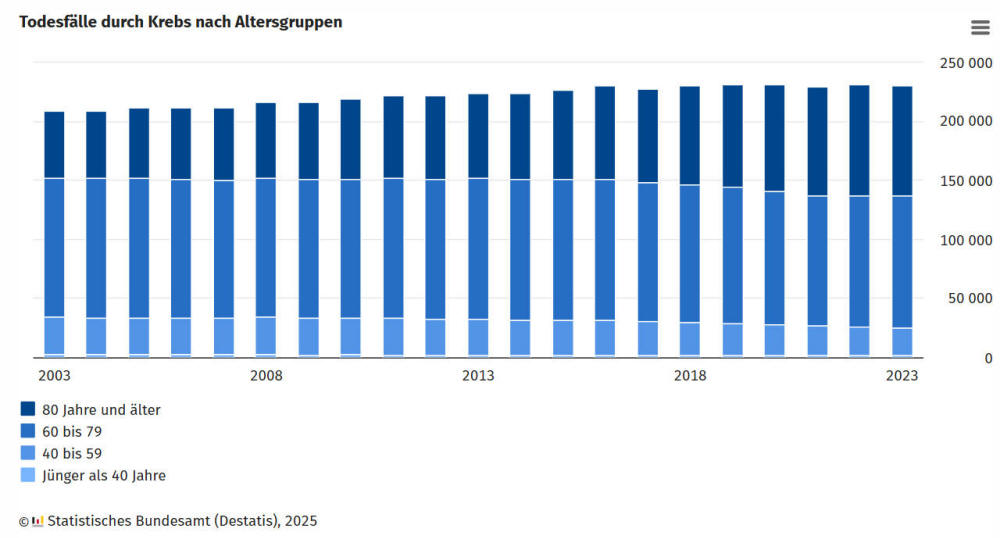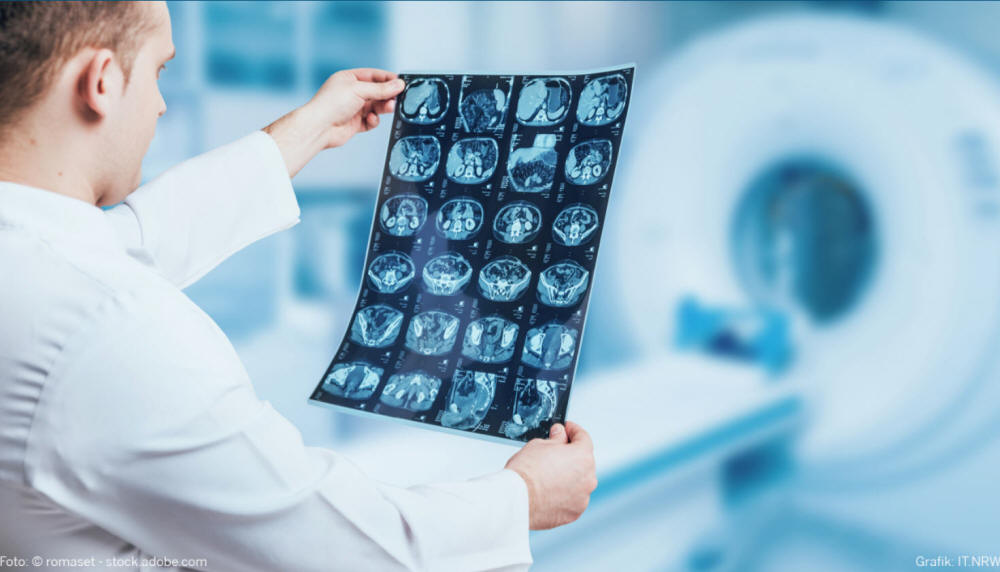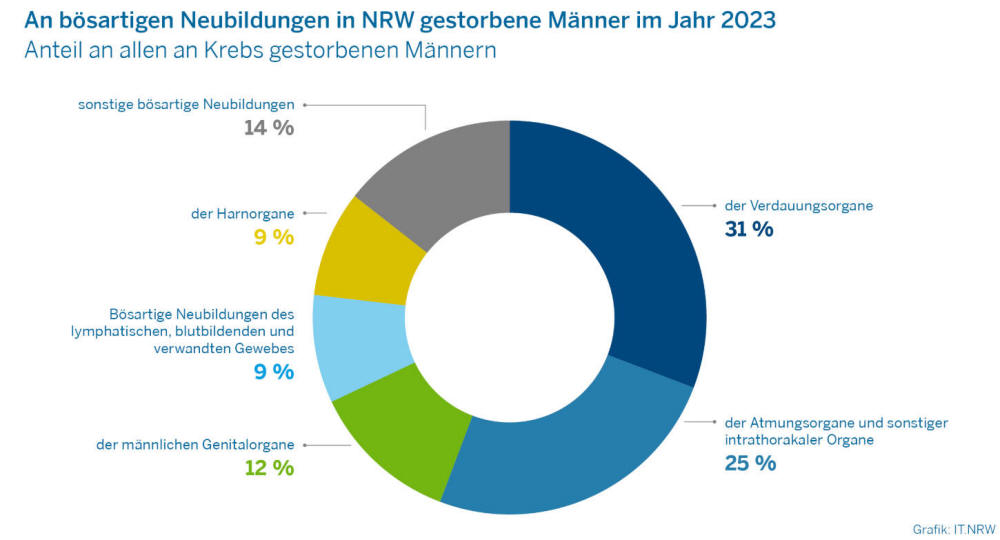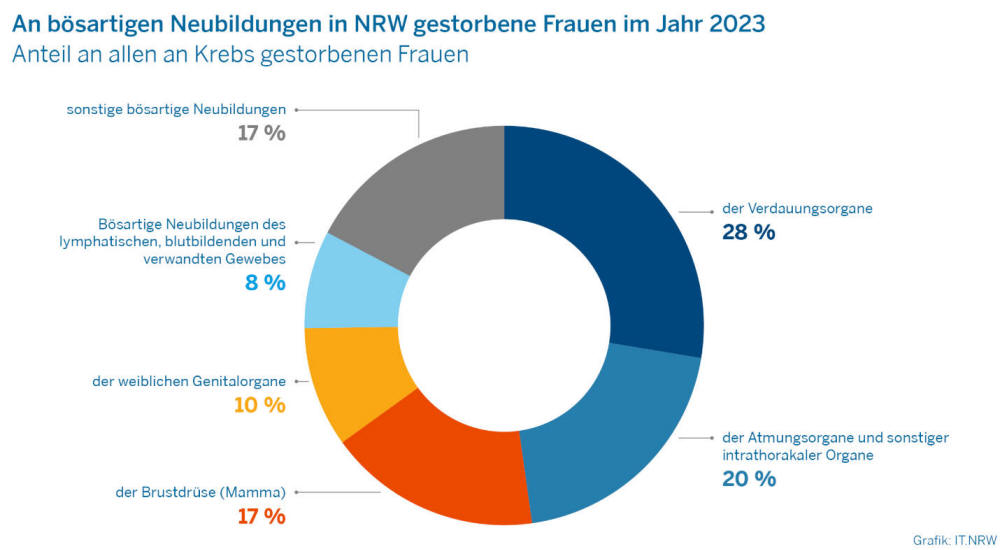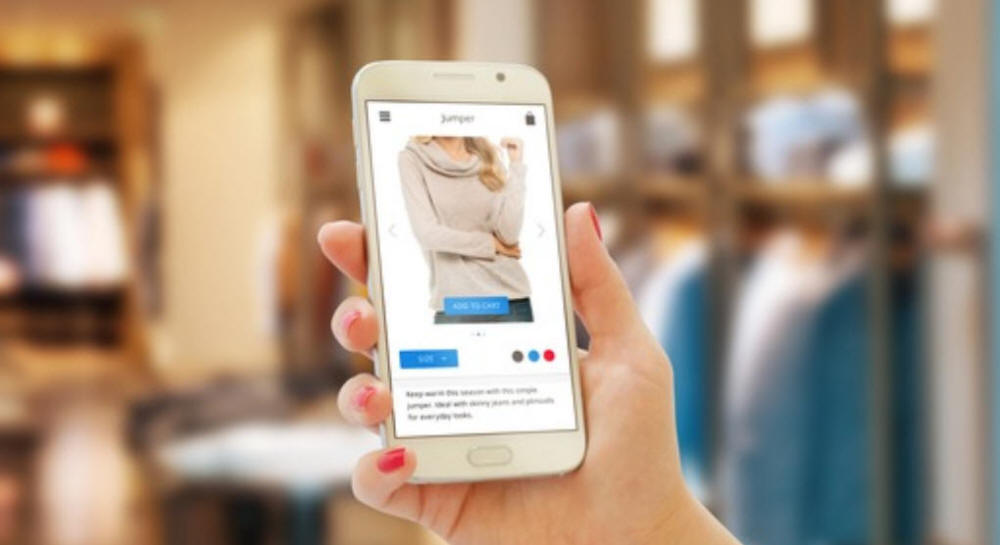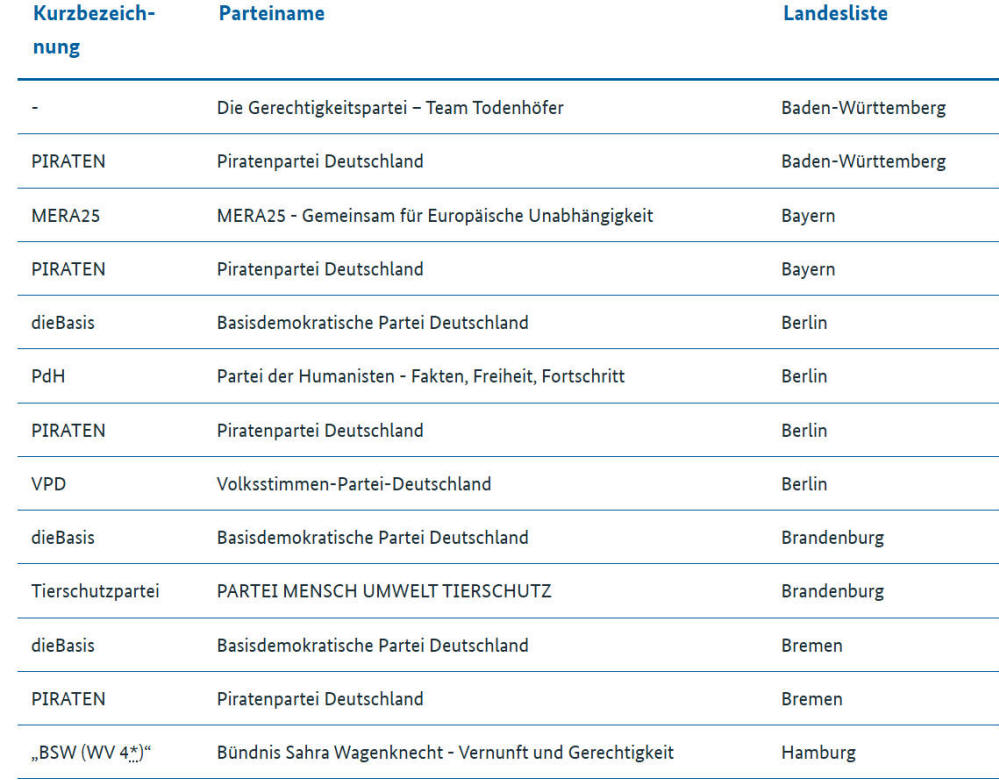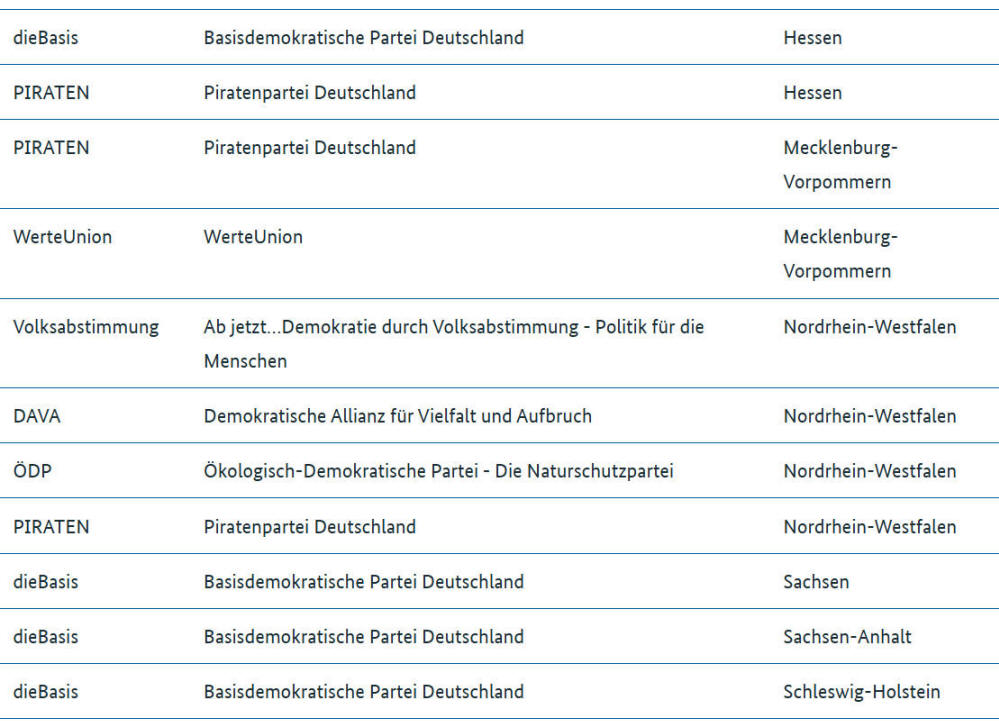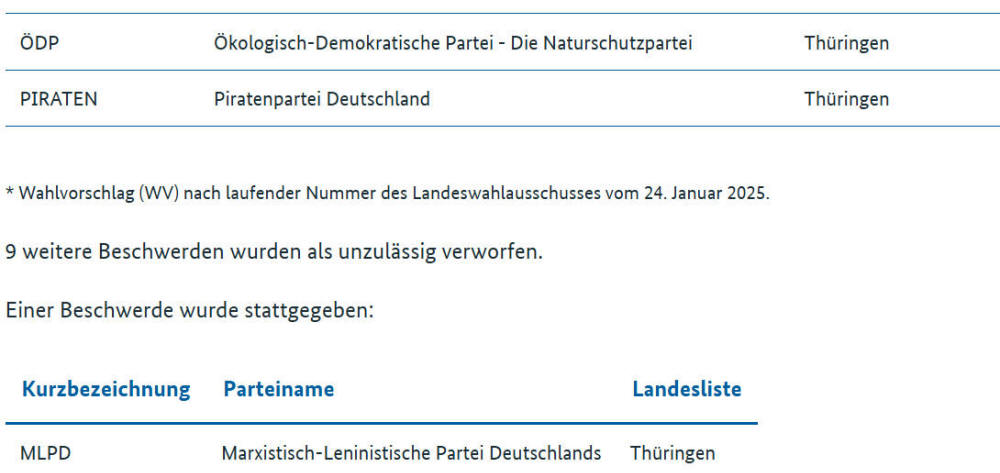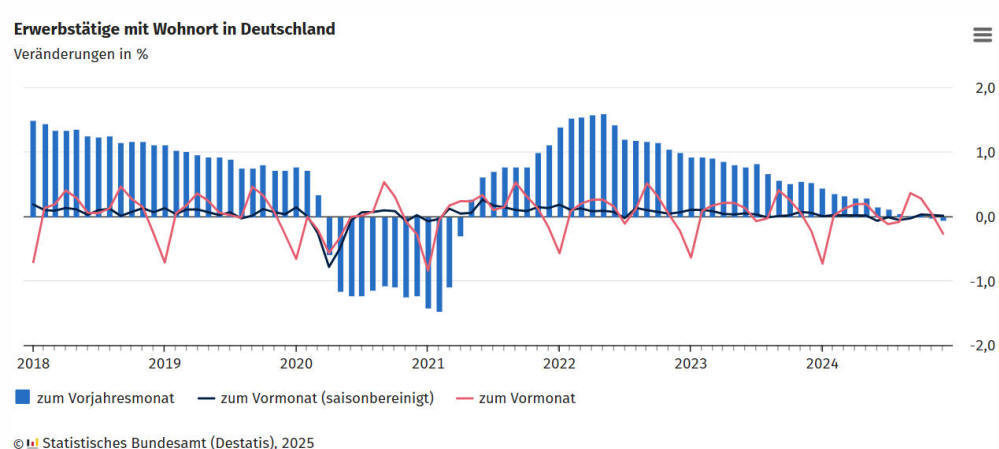|
Samstag, 8., Sonntag, 9. Februar 2025
Fehlerhafte Stimmzettel im Wahlkreis 112
(Wesel I)
Im Zuge der Auslieferung der Stimmzettel für das
Brief- und Direktwahlgeschäft an die Städte und
Gemeinden des Wahlkreises 112 (dazu gehören
Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort,
Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, Wesel,
Xanten) ist aufgefallen, dass sich auf den
Stimmzetteln ein Fehler eingeschlichen hat.
Die Kreiswahlleitung hat unverzüglich
reagiert, die Auslieferung weiterer Stimmzettel
gestoppt und die Korrektur beim
Druckdienstleister veranlasst, der zugesagt hat,
noch am Wochenende eine erste Charge korrekter
Stimmzettel zu liefern, damit das Wahlgeschäft
zeitnah weiterlaufen kann. Einzelne Kommunen
des Kreises (Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort,
Rheinberg und Wesel) haben bereits direkt nach
der Auslieferung der ersten Stimmzettel mit dem
Versand der Briefwahlunterlagen begonnen.
Nach aktuellem Stand betrifft das rund
2.200 Briefwahlanträge, davon 40 Direktwahlen.
Nach Rücksprache mit der Landeswahlleitung in
Düsseldorf werden diese Unterlagen dann mit den
korrekten Stimmzetteln erneut versandt werden.
Wer Briefwahlunterlagen beantragt
oder bereits eine Direktwahl vorgenommen hat,
erhält aktualisierte Wahlunterlagen per Post.
Bereits getätigte Wahlen im Wahlkreis 112 sind
ungültig. Wichtig ist, die fehlerhaften
Unterlagen keinesfalls für die Briefwahl zu
verwenden. Hintergrund: Bei einem Namen auf der
Landesliste der Partei „MERA25“ hat sich ein
Druckfehler eingeschlichen.
Beim
Stimmzetteldruck ist ein Sonderzeichen im Namen
eines Listenkandidaten nicht ordnungsgemäß
verarbeitet worden. Stattdessen wurde ein „?“
gedruckt. Konsequenz: jeder noch so kleine
Fehler, der im Vorfeld auffällt, ist zu
korrigieren, denn unrichtige Stimmzettel dürfen
nicht verwendet werden. Evtl. bereits
ausgefüllte Stimmzettel sind demzufolge
ungültig.
„Es tut uns leid, dass
hierdurch für alle Beteiligten ein nicht
unerheblicher Mehraufwand entsteht. Wir danken
allen Wählerinnen und Wählern für ihr
Verständnis und ihre Geduld. Die korrekten
Unterlagen werden schnellstmöglich verschickt.
Jeder Fehler, egal wie klein, muss korrigiert
werden, damit die Wahlen ordnungsgemäß und fair
ablaufen“, so Kreiswahlleiter Dr. Lars
Rentmeister. Insgesamt wurden knapp 70.000
fehlerhafte Stimmzettel gedruckt.
Moers: Verdi bestreikte auch Einrichtungen
der Enni Bäder blieben offen, Dienstleistungen
waren nur wenig eingeschränkt
Die Streiks im Öffentlichen Dienst der
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben gestern
auch am Niederrhein zu Einschränkungen geführt.
Erstmal in der aktuellen Tarifrunde traf es
dabei auch Bereiche der Enni-Unternehmensgruppe.
An den Sport- und Freizeiteinrichtungen ging die
Streikwelle am Freitag aber weitgehend vorbei.
So konnte Enni den Betrieb in den
Moerser und Neukirchen-Vluyner Bädern und der
Moerser Eishalle laut Vorstand Lutz Hormes
nahezu uneingeschränkt aufrechthalten.
„Auch
die gerade beim jungen Publikum sehr beliebte
Eisdisco fand am Freitagabend statt.“
Insgesamt waren von den Streikaktionen somit nur
wenige kommunale Services betroffen. Die
Friedhöfe waren nicht betroffen. Hier konnten
geplante Bestattungen stattfinden. Auch die
Leerung der öffentlichen Papierkörbe lief
störungsfrei, die Straßenreinigung war indes
eingeschränkt. Hier konnte Enni nur eine
Kehrmaschine in der Innenstadt einsetzen.
Anders als bei vergangenen Tarifrunden
gab es auch in der Moerser Abfallabfuhr gestern
nur sehr wenige Einschränkungen. So war der
Kreislaufwirtschaftshof durchweg geöffnet. Auch
die Restabfall- und Altpapiertonnen konnte Enni
leeren und den Großteil der an diesem Tag
angemeldeten gut 100 Sperrgutabfuhren erledigen.
Gelbe Tonnen und Säcke blieben in den
Freitagsbezirken aber stehen.
Laut
Hormes will Enni diese Abfuhren genau wie die
Abfuhr des teilweise stehengebliebenen Sperrguts
und Elektroschrotts bereits am heutigen Samstag
nachholen. „Leider haben wir auf Streikmaßnahmen
keinen Einfluss, uns sind hier die Hände
gebunden“, bat Lutz Hormes für die
Einschränkungen um Verständnis.
Bundestagswahl: Etwa 675.000
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz
Bei der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.
Februar 2025 werden rund 675.000 Wahlhelferinnen
und -helfer maßgeblich zum ordnungsgemäßen
Ablauf beitragen. Die Bundeswahlleiterin dankt
allen herzlich, die in den Wahlvorständen als
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ehrenamtlich für
unsere Demokratie im Einsatz sind.
Einen anschaulichen Einblick in die Tätigkeiten
der Wahlvorstände bieten die Videos „Der
Wahlvorstand“, „Ablauf des Wahltages“ sowie
„Ablauf der Stimmauszählung und Dokumentation“,
die im Internetangebot der Bundeswahlleiterin
abrufbar sind.
Dinslaken: Sofortwahl ab Samstag
(08.02.) möglich
Am Samstag (08.02.) öffnet das Wahlbüro die
Sofortwahlstelle im Rathaus, bei der
wahlberechtigte Dinslakener*innen ihre Stimme
bereits vor dem Wahlsonntag (23.02.) abgeben
können. Der Empfang befindet sich im Saal
D‘Agen im Erdgeschoss.
Der Zugang
befindet sich am Haupteingang des Rathauses (vom
Stadtpark kommend). Alle Öffnungszeiten sind auf
der Webseite der Stadt unter dem Stichwort „Sofortwahl“ aufgeführt
Überdurchschnittlich nasser Start ins neue Jahr
- Niederschlagsauswertung von
Emschergenossenschaft und Lippeverband für den
Januar 2025
Persönlich empfunden
haben es vermutlich alle – und die
Niederschlagsbilanz der
Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft
und Lippeverband belegt es: Der Januar 2025 war
überdurchschnittlich nass. Im Emscher-Gebiet
schaffte es der vergangene Monat sogar in die
Top 10 der nassesten Januarmonate seit 1931.
Der Niederschlag im Januar ließ sich
grundsätzlich in drei Phasen einteilen. Der
Januar startete zunächst mit einer sehr nassen
Phase (1. Januar bis 9. Januar). Darauf folgte
eine längere Trockenphase mit keinem oder kaum
Niederschlag (10. Januar bis 21. Januar). Das
letzte Monatsdrittel war dann wiederum erneut
sehr nass: In der Zeit vom 22. Januar bis zum
30. Januar regnete es an jedem Tag.
Im
Einzugsgebiet der Emschergenossenschaft, also
dem zentralen Ruhrgebiet, lag das Gebietsmittel
im vergangenen Monat bei 121,1 mm (langjähriges
Mittel = 69 mm, ein Millimeter entspricht einem
Liter pro Quadratmeter). Damit liegt der Januar
2025 auf Platz 9 der Top 10 der nassesten
Januarmonate ab 1931. Die Monatssummen im
Emscher-Gebiet lagen zwischen minimal 107,0 mm
an der Station Dortmund-Kruckel und maximal
135,4 mm an der Station Pumpwerk
Gelsenkirchen-Altstadt. Den größten
Tagesniederschlag erreichte im Januar die
Mess-Station am Pumpwerk der
Emschergenossenschaft am Nattbach in Gladbeck:
Dort fielen am 5. Januar 2025 insgesamt 28,9 mm.
Das Gebietsmittel im Einzugsgebiet des
Lippeverbandes lag im Januar 2025 bei 104,6 mm
(langjähriges Mittel = 65 mm). Somit war der
Januar auch an der Lippe deutlich
überdurchschnittlich nass, erreichte jedoch
anders als an der Emscher nicht die Top 10 der
nassesten Januarmonate ab 1931. Im Lippe-Gebiet
lagen die Monatssummen zwischen minimal 90,0 mm
an der Station Kläranlage Soest und maximal
128,5 mm an der Station Kläranlage
Gelsenkirchen-Picksmühlenbach. Auch an der Lippe
fiel – wie an der Emscher – der größte
Tagesniederschlag am 5. Januar 2025: An jenem
Tag regnete es an der Mess-Station in
Dorsten-Lembeck genau 34,0 mm.
Emschergenossenschaft und Lippeverband
Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV)
sind öffentlich-rechtliche
Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee
des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip
leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten
Emschergenossenschaft sind unter anderem die
Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung
und -reinigung sowie der Hochwasserschutz.
Der 1926 gegründete Lippeverband
bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe
im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem
den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam
haben Emschergenossenschaft und Lippeverband
rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands
größter Abwasserentsorger und Betreiber von
Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer
Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle,
546 Pumpwerke und 59 Kläranlagen).
www.eglv.de
Moers: Ein Streichelzoo mit
‚Mehr‘-Wert: Vorarbeiten beginnen am Montag
Mehr Tiere, neue Wegeverbindungen, ein
begehbares Gehege, Biogarten, ein Grünes
Klassenzimmer, eine Imkerei – der Moerser
Streichelzoo im Freizeitpark wird mehr als ein
‚Tiergehege‘. Das Projekt hat den sperrigen
Namen ‚Außerschulischer Lernort‘. Schwerpunkte
sind - neben der Tierhaltung - Bildung und
Naturerfahrung. Die vhs soll hier genauso
eingebunden werden wie
Naturschutzorganisationen, die LINEG oder die
Jägerschaft.

Der Streichelzoo Moers. Im Hauptgebäude sind u.
a. Räume für Schulungen, Büros und ein Lager.
(Illustration: Tervoort & Banczyk)
Durch
dieses Konzept grenzt sich der Streichelzoo
deutlich gegenüber ähnlichen Einrichtungen in
der Region ab. Die Nutzung bleibt für
Besucherinnen und Besucher weiterhin kostenfrei.
Am Montag, 10. Februar, beginnen die ersten
vorbereitenden Arbeiten für das Hauptgebäude.
Insgesamt fünf Bäume müssen dafür gefällt
werden. Ersatz wird auf dem Gelände gepflanzt.
In der etwa zweijährigen Bauzeit werden die
Tiere extern untergebracht.

Hügel, Wege und Aufenthaltsmöglichkeiten machen
den Streichelzoo für Menschen und Tiere
attraktiver. (Illustration: Zooplanung Schneider
Klein)
Attraktiver für Menschen und
Tiere
Bereits Ende 2021 hatte die Politik die
Neukonzeption beschlossen. Die Planung mit
Unterstützung eines in dem Bereich erfahrenen
Büros wurde mit dem Förderverein Streichelzoo,
Enni und dem Kreisveterinäramt abgesprochen.
Dies gilt auch für die künftigen ‚Bewohner‘. So
wird es u. a. Alpakas, Schafe, Sittiche, Ziegen
und Kaninchen geben. Der neue Außenzaun ist
deutlich niedriger als bisher und macht die
Tiergehege attraktiver für die Besucherinnen und
Besucher.
Die Zwergziegen-Anlage ist
teilweise begehbar – und damit ein ‚echter‘
Streichelzoo. Einige Bereiche werden mit kleinen
Hügeln modelliert. Die Tiere erhalten dadurch
ein abwechslungsreiches Gelände. Besucher laufen
über attraktive, geschwungene Wege mit
Sitzmöglichkeiten und Ruhezonen. Im Hauptgebäude
werden in der einen Hälfte Räume für Schulungen
und Büros untergebracht und in der anderen das
Lager und ein Stall.

Das Gehege der Ziegen ist künftig begehbar.
(Illustration: Zooplanung Schneider Klein)
Förderung aus der Städtebauförderung
Die Gesamtkosten liegen bei rund 3,4 Millionen
Euro – 600.000 Euro mehr als ursprünglich
geplant. Der Hochwasserschutz und Auflagen des
Veterinäramtes sind Gründe für die
Kostensteigerungen. Einen Zuschuss in Höhe von
etwa 2,3 Millionen Euro kommen aus Mitteln der
Städtebauförderung von Bund und Land.
Möglichweise wird auch ein Teil der zusätzlichen
Kosten übernommen. Anfang 2027 sollen die
Arbeiten beendet sein.
Moers:
Initiativkreis meldet sich zur Kostensteigerung
bei Streichelzoo zu Wort
Jüngst
wurde bekannt gegeben, dass sich die Kosten im
Zusammenhang mit dem Streichelzoo im Moerser
Stadtpark erneut um 21,11 %, d. h. um einen
Betrag von 600.000,00 € erhöhen werden. Dies
ergibt sich aus einer Vorlage im Ausschuss für
Stadtentwicklung, Planen und Umwelt vom
23.01.2025.
Ursprünglich wurden die
Investitionskosten mit 1,6 Millionen €
veranschlagt. Im November des Jahres 2021 wurde
darauf hingewiesen, dass mit einer
10-prozentigen Erhöhung der Investitionskosten
zu rechnen sei. Nun müssten Gesamtkosten von
insgesamt 3.419.029,88 € veranschlagt werden.
Aus diesem Anlass bringt sich der Initiativkreis
Moers erneut in die Diskussion ein und
kritisiert noch einmal die hohen Kosten im
Zusammenhang mit dem Vorhaben.
„Wir
geben zu bedenken, dass die jetzt angeführten
Gründe für die Kostensteigerung – ausdrücklich
genannt werden seitens der Verwaltung Maßnahmen
im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz –
deutlich früher im Zuge der Planungen hätten
berücksichtigt werden müssen“, merkt der
stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Theußen
an. Bereits im Jahre 2022 – sowohl die
Rheinische Post als auch die NRZ hatten darüber
berichtet – kritisierte der Initiativkreis
Moers, dass die Kosten für den Streichelzoo
deutlich zu hoch ausfallen würden und forderte
eine kostenbewusstere Umgestaltung.
Damals wurde auf die drohende Rezession, die
galoppierende Inflation und anstehende große
wirtschaftliche Belastungen für Unternehmen,
Bürger und öffentliche Hand in Moers verwiesen.
Hieran erinnert der Initiativkreis erneut. Die
in Moers ansässigen Unternehmen, insbesondere
Gastronomie und Einzelhandel in der Innenstadt,
befürchten noch immer erhebliche Einbußen im
Zusammenhang mit dem anstehenden Umbau der
Innenstadt, auch wenn sich dieser in
Teilabschnitten vollziehen wird.
„Nachdem die Stadtverwaltung erst Mitte Januar
aufgrund des öffentlichen Drucks die geplanten
Baumfällungen erst 5 nach zwölf einstellte, muss
jetzt an anderer Stelle im Moerser Schlosspark
nachgebessert werden. Auf Sicht der nächsten 10
Jahre kostet der Streichelzoo allein den Moerser
Steuerzahler rund 4 Millionen Euro an einmaligen
Investitions- und jährlichen
Unterhaltungskosten“ so Frank Heinrich,
Geschäftsführer des Initiativkreis.
Ob und in welcher Höhe für die drastische
Kostensteigerung weitere Fördermittel beschafft
werden können, ist derzeit noch nicht bekannt.
Anlässlich der nun offenbarten Kostensteigerung
befürchtet der Initiativkreis außerdem, dass es
auch bei den avisierten Unterhaltungskosten des
Streichelzoos von jährlich 300.000,00 € nicht
bleiben wird.
Die damaligen
Vorstandsmitglieder des Initiativkreis haben
bereits im Jahre 2022 an die Verwaltung
appelliert, von den vorgesehenen 300.000,00 €
nur etwa die Hälfte zu investieren, was den mit
dem Streichelzoo verfolgten Zweck in keiner
spürbaren Weise beeinträchtigen würde.
Der Initiativkreis-Vorsitzende Dr. Christoph
Scherer appelliert auch und insbesondere für
anstehende Projekte, wie z. B. den Neubau des
Schlosstheaters, der aus Stadtgesellschaft und
Unternehmerschaft wegen der verhältnismäßig
niedrigen Besucherzahlen im Vergleich zu den
geplanten Investitionen ohnehin kritisch
betrachtet wird, sorgfältig und im Sinne der
Schonung der Haushaltsmittel zu planen: „Wenn
bereits bei einem überschaubaren Projekt wie der
Umgestaltung des Streichelzoos die Kosten
unkontrolliert aus dem Ruder laufen, besteht
berechtigte Sorge, dass man sich auch mit dem
Neubau des Schlosstheaters finanziell übernehmen
wird“. Initiativkreis Moers e.V.
Die Stadt Moers hat ein Amtsblatt
veröffentlicht.
Alle
veröffentlichten Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter
Amtsblatt Nr.03 vom 06.02.2025 (1.75 MB)
Dinslaken: Bildung hautnah:
Schüler*innen Theodor-Heuss-Gymnasiums erkunden
Zukunftsquartier auf Trabrennbahn-Areal
Im Rahmen einer praxisorientierten
Exkursion zur künftigen Entwicklung des
Wohnquartiers auf dem Trabrennbahn-Areal in
Dinslaken hatten rund 38 engagierte
Schüler*innen des Geographiegrundkurses sowie
des Leistungskurses des Theodor-Heuss-Gymnasiums
die Gelegenheit, den Planungsprozess hautnah zu
erleben. Begleitet von ihren Lehrern Manuel
Dornebusch und Markus Pauschert nahmen die
jungen Menschen an einem spannenden
Planungsspaziergang teil.
Geleitet
von den Projektmitarbeiterinnen Meike Trautmann
und Saskia Berger erhielten die Teilnehmenden
Einblicke in die nachhaltige Stadtentwicklung
und die laufenden Rückbauarbeiten auf dem
Gelände. „Ich lade alle ein, sich für die
Zukunft unserer Stadt aktiv einzusetzen. Das
Interesse der Schüler*innen könnte den Anstoß
geben, dass aus Interesse Verantwortung und
Gestaltungswille wird. Danke an die
Lehrer*innen, die im Rahmen des Unterrichts die
Möglichkeit der Teilhabe an unseren wichtigen
Projekten geben", sagt Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel über den Besuch der Schule.
Die Schüler*innen zeigten sich interessiert
am Planungsprozess und diskutierten angeregt
über die Möglichkeiten zur Gestaltung eines
modernen, nachhaltigen Wohnquartiers. Besonders
die Verbindung von Theorie und Praxis hinterließ
einen bleibenden Eindruck. Anja Graumann,
Geschäftsführerin der DIN FLEG mbH, unterstrich
die Bedeutung solcher Begegnungen: “Regelmäßige
Schulbesuche sind seit fünf Jahren ein fester
Bestandteil unserer Arbeit. Sie ermöglichen den
Jugendlichen, urbane Entwicklungen hautnah zu
erleben und ihre Perspektiven einzubringen – ein
wertvoller Beitrag zu einem zukunftsfähigen
Stadtquartier.“
Interessierte
Schulklassen können sich für Führungen über das
Areal oder Unterrichtsbesuche gerne an die DIN
FLEG mbH wenden. Das Trabrennbahn-Areal in
Dinslaken steht exemplarisch für die
ambitionierten Projekte der DIN FLEG mbH, bei
denen Bildung, Bürgerbeteiligung und nachhaltige
Entwicklung Hand in Hand gehen. Solche
Exkursionen zeigen, wie lebendig und praxisnah
Bildung vor Ort sein kann.
Moers-Repelen: Materiallager entsteht auf dem
Parkplatz an der Stormstraße
Enni
treibt Fernwärmeausbau in Moers-Repelen voran
Die Wärmewende nimmt weiter Fahrt auf: Um die
Versorgungssicherheit zu erhöhen und künftig den
wachsenden Bedarf klimaneutraler Wärme zu
decken, baut die ENNI Energie & Umwelt
Niederrhein (Enni) das Fernwärmenetz seit
einigen Wochen in Moers-Repelen weiter aus.
Bis zum Herbst dieses Jahres entsteht
eine neue Verbindung zwischen der vor dem ENNI
Sportpark Rheinkamp aktuell endenden
Fernwärmeleitung und der Heizzentrale der Enni
an der Stormstraße.
Die Arbeiten
erfolgen in zwei Bauabschnitten und umfassen
auch innovative Verlegeverfahren, um die
Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu
halten. Im Zuge ihrer Arbeiten wird Enni auf dem
Parkplatz an der Ecke Storm-/Kamper Straße ab
dem 10. Februar ein Materiallager einrichten,
das bis zum Herbst bestehen bleibt. Dafür muss
das Unternehmen einen Bereich von rund 660
Quadratmetern absperren.
„Die Sperrung
betrifft etwa 20 Stellplätze, die vorübergehend
nicht zur Verfügung stehen werden“, erklärt
Projektleiter Dirk Schlathölter. „Zudem werden
die Glascontainer, die sich derzeit auf dem
Parkplatz befinden, um einige Meter versetzt.“
Kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten wird Enni
in diesem Bereich auch die letzte Trasse der
neuen Fernwärmeleitung verlegen, die unter dem
Parkplatz hindurch von der Stormstraße bis zur
Heizzentrale führt.
Schlathölter betont:
„Mit der neuen Leitung schaffen wir die Basis
für eine klimaneutrale Wärmeversorgung des
gesamten Stadtteils. Wir bitten Anwohner und
Nutzer des Parkplatzes um Verständnis für die
Einschränkungen.“
Fragen zu der
Baumaßnahme beantwortet Enni am
Baustellentelefon unter 02841/104-600. Wer sich
für einen Anschluss an das Fernwärmenetz
interessiert und so frühzeitig die Anforderungen
des Gebäudeenergiegesetzes erfüllen will, kann
sich schon jetzt unter der 02841 104136 an einen
der Energieberater der Enni wenden.
vhs
Moers – Kamp-Lintfort startet kreativ ins
Frühjahrssemester
Mit verschiedenen
Mal- und Zeichenkursen startet die vhs Moers –
Kamp-Lintfort kreativ ins neue
Frühjahrssemester. Los geht es am Dienstag, 18.
Februar, mit dem Workshop ‚Zeichnen lernen‘ in
der vhs an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10.
Insgesamt zwölfmal stehen dienstags ab 19.30 Uhr
die eigene Wahrnehmung und der Zeichenprozess im
Vordergrund.
Mitzubringen sind
Zeichenpapier (A5/A4/A3) und Bleistifte. Einen
Tag später, am Mittwoch, 19. Februar, startet
ebenfalls in der vhs Moers ‚Aquarellmalerei für
Anfänger und Anfängerinnen und
Fortgeschrittene‘. Dieser Kurs läuft zwölfmal
immer mittwochs ab 11 Uhr. Der Schwerpunkt liegt
auf den Grundlagen der Aquarellmalerei, der
Bildgestaltung und der Farblehre.
‚Acrylmalerei – Klassisch und experimentell‘
findet ab Donnerstag, 20. Februar, insgesamt
fünfzehnmal jeweils donnerstags in der vhs
Kamp-Lintfort (Kamperdickstraße 10) statt. Hier
geht es darum, die Techniken, Eigenschaften und
Möglichkeiten der Acrylmalerei spielerisch zu
erkunden.
Der Kurs eignet sich sowohl für
Anfängerinnen und Anfänger als auch für
Fortgeschrittene. Weitere Informationen zu den
Kursen gibt es telefonisch unter 0 28 41/201 –
565 sowie online unter www.vhs-moers.de.
Darüber sind auch die Anmeldungen möglich.
Wesel: Investmentfonds, Index,
ETF, AIF – ein Überblick über verschiedene
Anlageformen
Investmentfonds
wird nachgesagt, dass sie lukrative
Ertragschancen, hohe Flexibilität und
weitreichenden Anlegerschutz bieten - stimmt
das? Und was sind die Unterschiede zwischen
offenen und geschlossenen Fonds, ETFs und
Indexfonds, Fondspolice und Fondssparplan, AIF
und ELTIF? Welche Investments bieten
Kapitalabsicherungen und sind eine Alternative
zu Niedrigzinsen bzw. hoher Inflation?
Finanzplaner Christian Grams klärt in seinem
Vortrag am 11. Februar, 18:00 bis 21:00 Uhr, in
der vhs in Wesel über die wichtigsten
Anlagemöglichkeiten auf. Die Teilnahme am
Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Weitere Informationen unter
0281-203 2590 oder
www.vhs-wesel.de.
Virtuelles Mittelalter im Städtischen
Museum Wesel
Virtuelles Mittelalter:
Die Eidesleistung. 18. Januar - 22. März 2025.
Museum and the City - Städtisches Museum Wesel
in der Innenstadt
Städtisches Museum x
Manuel Rossner
Der Eintrag in die
Rechnungsbücher der Stadt Wesel »Item Derick
Baegert, so hy eyn taffell gemaelt hefft, die nu
op de raitskammer hengt [...]« markiert im Jahr
1494 den Entstehungszeitpunkt des Gerichtsbildes
für das neugebaute Rathaus in Wesel am Großen
Markt. Das Gemälde befindet sich seitdem im
Besitz der Stadt Wesel und des Städtischen
Museums.
Zusammen mit dem
Digitalkunst-Pionier Manuel Rossner aus Berlin
haben wir das den ältesten Schatz in der
Sammlung des Museums nun knapp 600 Jahre nach
seiner Entstehung für Sie in Virtual Reality
erlebbar gemacht. In unserem »Pop-Up-Museum« in
der Weseler Innenstadt können Sie nun mit der
aktuellen Meta Quest 3 Teil der gerade
stattfindenden Gerichtsverhandlung werden und
den Raum und seine Atmosphäre wie zu Zeiten
Derick Baegerts selbst erkunden.
Begleitende Informationen aus der aktuellen
Forschung, ein Video zur Eidesleistung und
Einblicke in die hochauflösende Fotografie, die
Grundlage für die von Manuel Rossner erstellte
interaktive Welt der Eidesleistung, ergänzen das
spatial computing-Erlebnis.
Lassen Sie
sich von uns in die virtuelle Realität begleiten
und erleben Sie die mittelalterliche Szene als
ob Sie dabei gewesen wären!
Derick
Baegert x Die Eidesleistung
Derick Baegert,
der in Wesel eine erfolgreiche Werkstatt
betreibt, erhält im Jahr 1493 den Auftrag vom
Weseler Rat, ein Gemälde für die Ausstattung des
Ratssaals herzustellen und fasst es in einer für
seine Zeit progressive Form. Es ist eines der
ersten Beispiele einer bildfüllenden Darstellung
einer weltlichen Gerichtsverhandlung am Übergang
vom Spätmittelalter zur Neuzeit. Der Verweis auf
die üblicherweise in diesem Kontext dargestellte
christliche Vorstellung des Weltgerichts, findet
sich hier nur noch in einem ›Bild im Bild‹.
Diese spannende Transition vom Mittelalter
in die Neuzeit findet sich sowohl inhaltlich als
auch formal im Gemälde wieder. Baegert gewährt
dem Betrachter mit seiner zeitgenössischen
Schilderung einer Gerichtsszene einen Einblick
in die Lebenswelt des Spätmittelalters, wobei
der Fokus auf dem titelgebenden Schwurakt im
Bildvordergrund liegt. Ganz plastisch führt uns
der Maler hier den inneren psychologischen
Konflikt des Schwörenden vor Augen, indem er ihm
den Teufel als Verkörperung des bösen und einen
Engel als Personifikation des guten, richtigen
Handelns zur Seite stellt.
So
wirklichkeitsnah diese Darstellung der gerade
stattfindenden Gerichtsverhandlung auch scheinen
mag, so ist sie gleichsam durch die Anwesenheit
der Inkarnation von Gut und Böse und die aus der
mittelalterlichen Tradition herrührenden,
ephemeren Begleitsprüche eine Art Parabel mit
lehrreichem Charakter für die Bürgerinnen und
Bürger vor dem realen Gericht in Wesel. Weitere
Informationen:
www.wesel.de/museum
Die
Botschaft, die alle betrifft: ROG x Innocean
Berlin mit der Kampagne zur Bundestagswahl
Wenige Wochen vor der vorgezogenen
Bundestagswahl startet die international tätige
Nichtregierungsorganisation Reporter ohne
Grenzen in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur
Innocean Berlin eine Kampagne, die die Wähler
daran erinnert, dass an diesem entscheidenden
Tag viel auf dem Spiel steht.

Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz im Dezember
letzten Jahres die Vertrauensabstimmung im
Parlament verloren hat, steht Deutschland nicht
nur vor Neuwahlen, sondern auch vor politisch
herausfordernden Zeiten. In diesem
entscheidenden Moment macht Reporter ohne
Grenzen darauf aufmerksam, wie wichtig die
Stimme der Wähler für den Schutz der
Pressefreiheit ist.
Hier geht
es zur Kampagne
Dazu platziert die
NGO einen 30-sekündigen Film im Vorspann von
Kinos, der die typischen Warnhinweise an das
Publikum nachahmt und ihnen einen tieferen Sinn
verleiht. In dem Video erhalten Anweisungen wie
"keine Fotos" und "keine Gespräche" eine völlig
neue Bedeutung. Denn auf die üblichen
Aufforderungen folgt die eindringliche
Botschaft: "Was im Kino gilt, darf niemals für
die Presse gelten.“. Der Film schließt mit einem
kraftvollen Appell: Am 23. Februar aktiv für die
Pressefreiheit einzutreten, denn in einer
Demokratie hat jede einzelne Stimme Gewicht und
trägt dazu bei, Freiheit und Demokratie zu
bewahren. Eine eingeblendete URL führt auf eine
Info-Seite, die zeigt, wie jeder die eigene
Stimme nutzen kann, um ein Zeichen zu setzen und
die unabhängige Berichterstattung zu stärken.
Ziel der Kampagne ist es, die Zuschauenden
zum Nachdenken über die fundamentale Bedeutung
der Pressefreiheit in einer Demokratie zu
bewegen. Mit eindringlichen Bildern und klaren
Botschaften verdeutlicht der Film, wie wichtig
es ist, die eigene Stimme aktiv zu nutzen, um
die Unabhängigkeit der Medien zu schützen.
Deshalb wird der Film in den kommenden Wochen
bis zum Tag vor der Wahl in rund 250 Kinos
deutschlandweit gezeigt. Darüber hinaus wird der
Aufruf ebenfalls in Printanzeigen und auf
diversen Social Media Plattformen zu sehen sein.
Mit dieser Kampagne möchte Reporter ohne
Grenzen ein breites Publikum erreichen und ein
Bewusstsein dafür schaffen, dass jede Stimme
zählt, um die Grundlage für freien und
unabhängigen Journalismus zu sichern.
Nach dem unglaublichen Erfolg der Kampagne "The
First Speech" die sich in einer ähnlichen Art
und Weise politischen Themen gewidmet hat und
weltweit Anklang fand, ist dies nun die zweite
Zusammenarbeit zwischen Reporter ohne Grenzen
und der Kreativagentur Innocean Berlin.
KEINE FOTOS, KEINE VIDEOAUFNAHMEN, KEINE
GESPRÄCHE: DIE NGO REPORTER OHNE GRENZEN (RSF)
VERWANDELT KINOWARNUNGEN IN EIN KRAFTVOLLES
STATEMENT FÜR DIE PRESSEFREIHEIT VOR DER WAHL.
"Populistische und extreme Kräfte
attackieren die freie Presse. Sie fürchten die
Kritik und versuchen, unabhängige Medien mundtot
zu machen. Diese besorgniserregende Entwicklung
sehen wir in vielen Ländern weltweit: nicht nur
in autoritären Staaten, sondern mittlerweile
auch in den USA und sogar in europäischen
Nachbarländern wie Österreich, Italien und der
Slowakei. Ohne eine vielfältige und freie Presse
gibt es keine Demokratie. Wir appellieren an
alle Wähler und Wählerinnen, dies bei ihrer
Stimmabgabe bei der kommenden Bundestagwahl zu
berücksichtigen.“ Anja Osterhaus,
RSF-Geschäftsführerin.
Neuer
Wettbewerb gestartet: Erlebnis Bienenwunder-Sets
für Förderschulen in NRW zu gewinnen
Kinder für die Natur begeistern: Sparda-Stiftung
fördert gemeinsam mit der Initiative Bienen
machen Schule spielerisches Lernen an
Förderschulen Düsseldorf, 6. Februar 2025.
Erstmals werden Bienen-Erlebnissets an
Förderschulen in Nordrhein-Westfalen verlost.
Der Wettbewerb wird von der Initiative Bienen
machen Schule unter Trägerschaft des
gemeinnützigen Vereins Mellifera e. V.
durchgeführt.
Die Stiftung Kunst,
Kultur und Soziales der Sparda Bank West fördert
den Wettbewerb in den Regierungsbezirken
Düsseldorf und Arnsberg mit insgesamt 25 Sets.
Eine bienenfreundliche Umwelt beginnt schon in
den Köpfen unserer kleinsten Mitmenschen.
Mithilfe des interaktiven Sets „Erlebnis
Bienenwunder“ erhalten Kinder spielerisch
Einblicke in die faszinierende Welt der Bienen.
Diese spielen eine zentrale Rolle als
Bestäuberinnen in unseren Ökosystemen.
An ihrem Beispiel werden Wechselbeziehungen
zwischen Pflanzen und Tieren begreifbar.
Gleichzeitig eignen sich Bienen sehr gut, Kinder
für die Natur zu begeistern und ihnen wertvolle
Naturerfahrungen zu vermitteln. Unterschiedliche
Materialien, Spiele und Aktivitäten wurden so
ausgewählt, dass alle Sinne der Kinder
angesprochen werden.

© Initiative Bienen machen Schule, Erlebnis
Bienenwunder Set, Foto_Nick Leukhardt)
„Mit unserem Erlebnis Bienenwunder geben wir
Kindern die Möglichkeit, mit allen Sinnen in die
geheimnisvolle Welt der Bienen einzutauchen.
Dadurch können sie die Liebe zur Natur
entdecken. Das ist für uns ein ganz wichtiges
Anliegen“, sagt Jonas Ewert, Leiter der
Initiative Bienen machen Schule.
Die
Initiative bringt Pädagog*innen und Imker*innen
zusammen, die im Kindergarten oder
Schulunterricht, in der Bienen-AG, in
Umweltzentren, der offenen Kinder- und
Jugendarbeit oder im Imkerverein ein Bewusstsein
für die faszinierende Welt der Bienen schaffen
wollen. Ein zentrales Anliegen ist es, dass
junge Menschen die Möglichkeit erhalten, mit und
von den Bienen zu lernen. Ursula Wißborn,
Vorständin der Sparda-Stiftung, ergänzt: „Bienen
sind unverzichtbar für unsere Ökosysteme.
Mit dem Erlebnis Bienenwunder wecken wir
schon bei den Kleinsten Begeisterung für diese
faszinierenden kleinen Helfer und vermitteln
ihnen spielerisch, wie wertvoll und
schützenswert unsere Natur ist.“
 © Initiative Bienen machen Schule, Foto_Daniel
Saarschmidt) Initiative Bienen machen Schule
© Initiative Bienen machen Schule, Foto_Daniel
Saarschmidt) Initiative Bienen machen Schule
Mitmachen ist ganz einfach. Alle
Förderschulen in NRW sind herzlich eingeladen,
einen Bienen-Reim zu schicken, der, sofern es
die Fähigkeiten der Schüler*innen zulassen, mit
Beteiligung der Kinder entstanden ist, sowie
eine kurze Begründung, weshalb Sie gerne an
ihrer Förderschule mit dem Erlebnis Bienenwunder
arbeiten möchten.
Alle Infos gibt es
unter:
www.mellifera.de/blog/bienen-schule-blog/wettbewerb-foerderschulen.html
Die Stiftung Kunst, Kultur und
Soziales der Sparda-Bank West Die Stiftung
Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West
engagiert sich bereits seit 2004 in
Nordrhein-Westfalen. Seit ihrer Gründung hat sie
insgesamt fast 700 gemeinnützige Projekte mit
mehr als 24 Millionen Euro gefördert. Allein im
vergangenen Jahr unterstützte sie mit 1,16
Millionen Euro 33 Projekte.
Das soziale
Engagement der Stiftung leitet sich nicht
zuletzt aus dem Anspruch ab, die Gemeinschaft
heute und in Zukunft zu stärken. Ziel ist immer,
das Gemeinwohl zu fördern und sich in den drei
Bereichen Kunst, Kultur und Soziales langfristig
für die Menschen vor Ort einzusetzen.
Im
Fokus steht dabei die Unterstützung von Kindern,
Jugendlichen sowie älteren Menschen. Motivation
ist es, die verschiedenen Projekte als Partner
mit voranzubringen. Mehr über die
Sparda-Stiftung und ihre Werte unter
www.stiftung-sparda-west.de und bei Social
Media.
IHK bietet
Zertifikatslehrgang zum Personalsachbearbeiter
Der Erfolg eines Unternehmens steht
und fällt auch mit den Aufgaben rund ums
Personal. Dazu gehören klare Stellenanzeigen,
korrekte Entgeltabrechnungen und rechtlich
einwandfreie Kündigungen.
Das nötige
Wissen dazu gibt es im IHK-Zertifikatslehrgang
zum Personalsachbearbeiter/-in. Er richtet sich
sowohl an Mitarbeiter im Personalmanagement, die
ihre Kenntnisse auffrischen möchten, als auch an
Quereinsteiger, die sich für eine qualifizierte
Position in diesem Bereich interessieren.
Der Lehrgang findet vom 12. März bis 29.
September zwei Mal pro Woche von 17:30 – 20:45
Uhr im Blended Learning-Format statt. Montags
online über MS-Teams und Mittwochs in Präsenz in
Duisburg. IHK-Ansprechpartnerin ist Sabrina
Giersemehl, 0203 2821-382,
giersemehl@niederrhein.ihk.de. Weitere
Informationen und die Möglichkeit sich
anzumelden gibt es unter
https://www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen.

Kindertageseinrichtungen in NRW hatten
durchschnittlich 20,5 Tage im Jahr geschlossen
Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen
waren im Berichtsjahr 2023/2024 durchschnittlich
20,5 Tage geschlossen. Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, waren das genauso viele Tage
wie im Jahr zuvor. Im Berichtsjahr 2021/2022
hatte die Zahl der Schließtage noch bei
19,4 Tagen gelegen. Als Schließtage werden in
der Statistik alle Tage gezählt, an denen eine
Einrichtung z. B. wegen Ferien,
Teamfortbildungen oder Krankheiten geschlossen
war, obwohl sie eigentlich regulär geöffnet
gehabt hätte.
Stundenweise
Schließungen von Einrichtungen werden nicht
erfasst. Städteregion Aachen hatte die meisten
Kita-Schließtage Unter den kreisfreien Städten
und Kreisen gab es 2023/2024 im Durchschnitt die
meisten Schließtage in Einrichtungen der
Städteregion Aachen (23,7), der Stadt Solingen
(23,3) und der Stadt Remscheid (23,1). Die
wenigsten Schließtage wurden in Kitas der Städte
Mönchengladbach und Bochum (16,6) und im Kreis
Lippe (17,0) gezählt.
Betrachtet
wurden alle Kindertageseinrichtungen in
öffentlicher und freier Trägerschaft. Die
Kindertageseinrichtungen in öffentlicher
Trägerschaft hatten im Berichtsjahr 2023/2024
durchschnittlich 21,2 Schließtage (2023: 21,2;
2022: 19,4). Die Kindertageseinrichtungen in
freier Trägerschaft kamen auf durchschnittlich
20,3 Schließtage (2023: 20,3; 2022: 19,5).
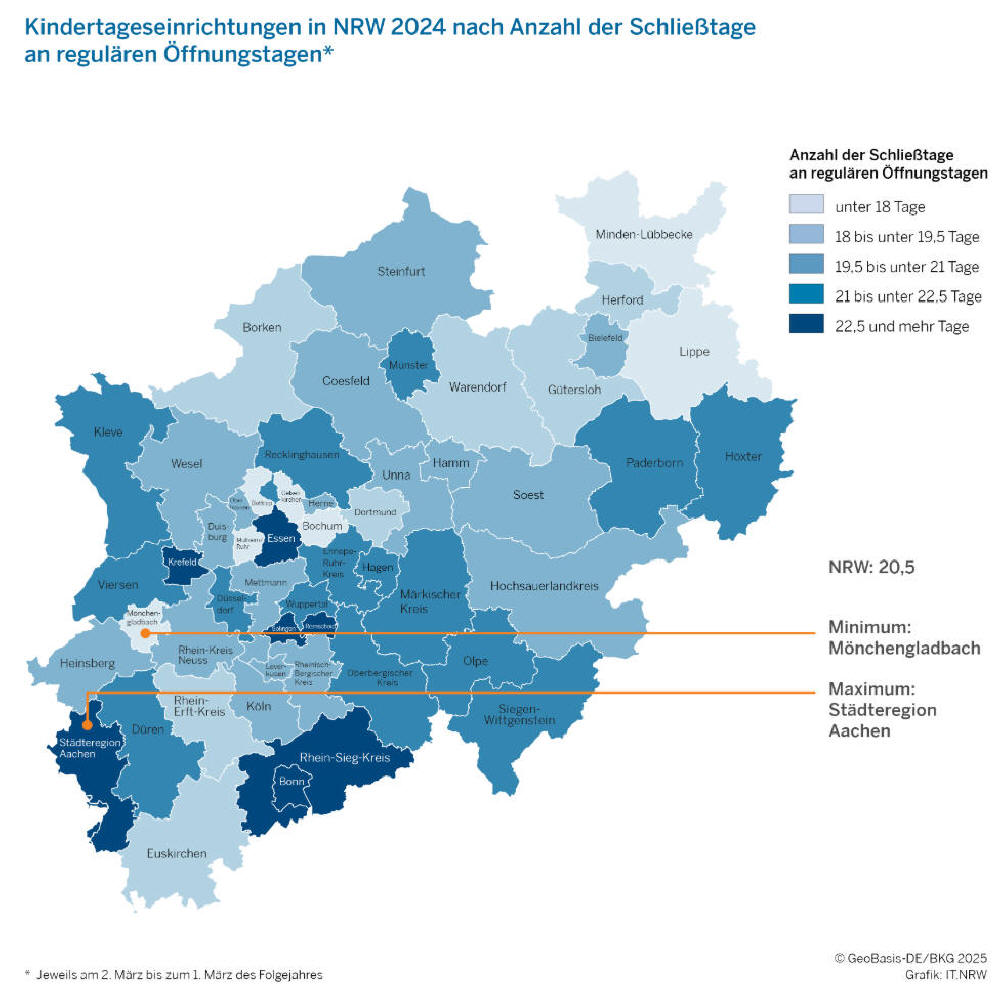
Von 10 783 Kitas in NRW, hatten nur 48 auch
Betreuungszeiten nach 18 Uhr
Wie das
Statistische Landesamt weiter mitteilt, begannen
an regulären Öffnungstagen die Betreuungszeiten
in den meisten der 10 783 Kitas in NRW zwischen
7 Uhr und 7:30 Uhr (93,3 Prozent). 304
Einrichtungen öffneten vor 7 Uhr (2,8 Prozent)
und 417 Kitas nach 7:30 Uhr (3,9 Prozent).
Die Öffnungszeit endete in den meisten
Einrichtungen zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr
(58,1 Prozent). Während 4 466 Kitas bereits vor
16:30 Uhr schlossen (41,4 Prozent), gab es in 48
Einrichtungen (0,4 Prozent) auch
Betreuungszeiten nach 18 Uhr.
Fleischproduktion im Jahr
2024 um 1,4 % gestiegen
• Fleischproduktion steigt erstmals seit dem
Jahr 2016 wieder an, bleibt aber um knapp ein
Viertel unter dem bisherigen Höchststand
•
Schlachtunternehmen erzeugen im Jahr 2024
insgesamt 6,9 Millionen Tonnen Fleisch und damit
97 200 Tonnen mehr als im Jahr 2023
Die
Fleischproduktion in Deutschland ist im Jahr
2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 %
gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, produzierten die
gewerblichen Schlachtunternehmen 2024 nach
vorläufigen Ergebnissen 6,9 Millionen Tonnen
Fleisch. Das waren 97 200 Tonnen mehr als im
Vorjahr.
Damit stieg die inländische
Fleischproduktion nach sieben Rückgängen in
Folge erstmals seit dem Jahr 2016 (8,4 Millionen
Tonnen) wieder an. Insgesamt wurden im Jahr 2024
in den Schlachtbetrieben 48,7 Millionen
Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde
sowie 693,3 Millionen Hühner, Puten und Enten
geschlachtet.
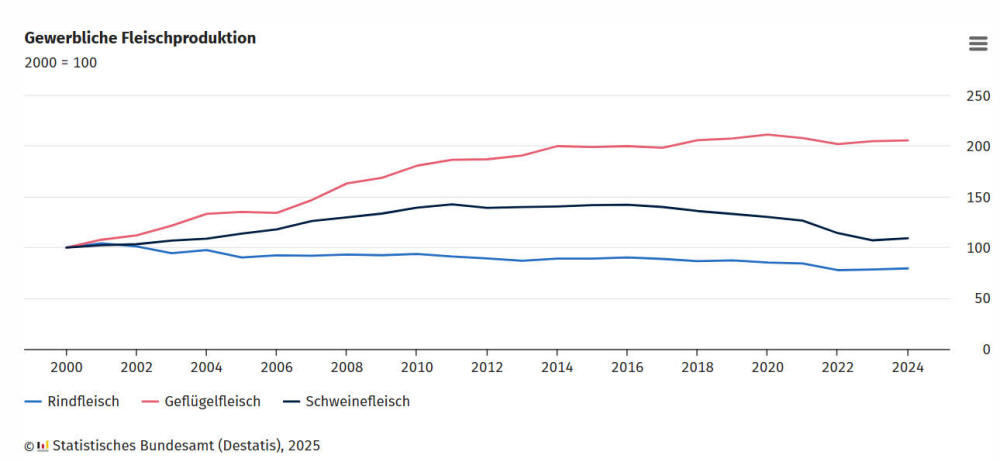
Schweinefleisch: Schlachtmenge um 1,9 %
gestiegen
Mit 44,6 Millionen geschlachteten
Tieren im Jahr 2024 stieg die Zahl der
geschlachteten Schweine gegenüber dem Vorjahr um
1,2 % oder 531 300 Tiere. Dabei erhöhte sich die
Zahl der geschlachteten Schweine inländischer
Herkunft um 1,6 % auf 43,3 Millionen Tiere. Die
Zahl importierter Schweine, die in deutschen
Betrieben geschlachtet wurden, sank dagegen um
9,2 % auf 1,3 Millionen Tiere.
Insgesamt
produzierten die deutschen Schlachtunternehmen
im Jahr 2024 rund 4,3 Millionen Tonnen
Schweinefleisch. Das waren 1,9 % oder 80 500
Tonnen mehr als 2023, im Vergleich zum
Rekordjahr 2016 aber 1,3 Millionen Tonnen
weniger, was einem Rückgang um knapp ein Viertel
(-24,9 %) entspricht.
Rindfleisch:
Schlachtmenge um 1,2 % gestiegen
Die Zahl der
im Jahr 2024 gewerblich geschlachteten Rinder
blieb gegenüber dem Vorjahr mit einem Anstieg um
0,1 % auf 3,0 Millionen Tiere nahezu
unverändert. Allerdings stieg die Schlachtmenge
um 1,2 % auf 1,0 Millionen Tonnen Rindfleisch,
wobei die durchschnittlichen Schlachtgewichte in
allen Rinderkategorien zunahmen.
Geflügelfleisch: Schlachtmenge um 0,3 % erhöht
Die Menge an erzeugtem Geflügelfleisch stieg im
Jahr 2024 gegenüber 2023 um 0,3 % auf 1,6
Millionen Tonnen. Grund für den Anstieg war
allein die um 1,8 % auf 1,1 Millionen Tonnen
gestiegene Erzeugung von Jungmasthühnerfleisch.
Die Produktion von Putenfleisch
(Truthahnfleisch) ging dagegen um 2,1 % auf 408
100 Tonnen zurück. Insgesamt wurden in den
Betrieben im Jahr 2024 rund 653,8 Millionen
Hühner, davon 626,7 Millionen Jungmast- und 27,1
Millionen Suppenhühner geschlachtet. Hinzu kamen
30,2 Millionen Puten sowie 9,3 Millionen Enten.
NRW-Industrie: 40 Prozent
niedrigere Produktion von
Fleisch-Fertiggerichten als 2019
Die nordrhein-westfälischen Betriebe haben
31 200 Tonnen Fertiggerichte auf Grundlage von
Fleisch wie z. B. Gulasch, Kohlrouladen oder
Geflügel-Snacks im Jahr 2023 hergestellt. Wie
das Statistische Landesamt mitteilt, sank die
Produktionsmenge von Fleisch-Fertiggerichten um
8,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Gegenüber
2019 ist die Produktionsmenge um fast 40 Prozent
gesunken (damals: 51 300 Tonnen).
Fertiggerichte auf Grundlage von Fleisch machten
mehr als ein Drittel des gesamten Absatzwertes
aus Insgesamt sind im Jahr 2023 in 38 der 9 901
produzierenden Betriebe des
nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes
Fertiggerichte im Wert von 911 Millionen Euro
hergestellt worden. Mit einem Warenwert von
319 Millionen Euro machten Fertiggerichte auf
der Grundlage von Fleisch ein Drittel des
gesamten Absatzwertes der
Fertiggerichtproduktion aus.
Im Jahr
2019 betrug dieser Anteil noch fast die Hälfte.
Neben Fertiggerichten auf Grundlage von Fleisch
kann bei der Produktion von Fertiggerichten nach
weiteren Hauptbestandteilen unterschieden
werden: Mit einem Absatzwert von 198 Millionen
Euro machten im Jahr 2023 Fertiggerichte wie
Tiefkühlpizza, Baguette und Käsefondues (Andere
Fertiggerichte) 21,7 Prozent vom gesamten
Absatzwert der Fertiggerichte aus. Es folgten
Teigwaren und Teigwarengerichte mit
153 Millionen Euro (16,8 Prozent),
Fertiggerichte auf der Grundlage von Gemüse
(13,7 Prozent) mit 125 Millionen Euro und
Fertiggerichte auf Grundlage von Fisch mit
116 Millionen Euro (12,7 Prozent).
Deutschlandweite Fertiggerichtproduktion war
2023 leicht rückläufig Deutschlandweit wurden im
vergangenen Jahr 1,6 Millionen Tonnen
(−0,7 Prozent gegenüber 2022) Fertiggerichte mit
einem nominalen Absatzwert von 5,5 Milliarden
Euro (+8,6 Prozent) produziert; 16,4 Prozent
(2022: 16,1 Prozent) des Absatzwertes entfiel
auf nordrhein-westfälische Betriebe.
•
Absatzwert
stieg in den ersten drei Quartalen 2024
In
den ersten drei Quartalen 2024 sind in NRW nach
vorläufigen Ergebnissen in 38 Betrieben
Fertiggerichte im Wert von 691,0 Millionen Euro
(+1,7 Prozent gegenüber dem entsprechenden
Vorjahreszeitraum) hergestellt worden. Gegenüber
den ersten neun Monaten 2019 stieg der
Absatzwert nominal um 6,5 Prozent. Der
Absatzwert von Fertiggerichten auf der Grundlage
von Fleisch stieg in den ersten drei Quartalen
2024 gegenüber 2023 um 5,4 Prozent (und sank
gegenüber 2019 um 15,9 Prozent) auf
251 Millionen Euro.
Freitag, 7.
Februar 2025
- Dicker-Pulli-Tag
Warnstreik am
Freitag in Moers: Bürgerservice und Kitas
betroffen
Am Freitag, 7. Februar,
gibt es den nächsten ver.di-Warnstreik, der auch
die Stadtverwaltung trifft. So bleibt der
Bürgerservice komplett geschlossen. Alle
Sprechzeiten fallen aus, bereits vereinbarte
Termine werden verschoben. Zu Einschränkungen
kommt es auch bei Kindertageseinrichtungen.

Die Kita Lockertstraße in Asberg öffnet an
diesem Freitag nicht. Auch in anderen
Kindergärten oder im Offenen Ganztag kann es zu
Ausfällen kommen. Eltern werden direkt von den
Einrichtungen darüber informiert. Ob sich der
Streik auch bei anderen Dienstleistungen der
Stadtverwaltung auswirkt, ist im Vorfeld nicht
absehbar.
Das Briefwahlbüro ist
nicht betroffen. In den Tarifverhandlungen des
öffentlichen Dienstes fordert ver.di eine
Erhöhung der Entgelte um 8 Prozent, mindestens
aber 350 Euro. In der erste Runde haben dies die
Arbeitgeber abgelehnt, aber kein anderes Angebot
gemacht.
Mit warmen
Pullovern Gutes für die Umwelt tun – Stadt Wesel
und Weseler Schulen beteiligen sich am
Dicker-Pulli-Tag
Wer in der kalten
Jahreszeit vor die Tür geht, zieht in der Regel
eine dicke Jacke an. Zuhause wird mit den
sinkenden Temperaturen draußen meistens der
Heizregler höher gedreht. Seit 2020 findet am
ersten oder zweiten Freitag im Februar der
Dicker-Pulli-Tag statt, in diesem Jahr am 7.
Februar. Auch die Stadt Wesel sowie zahlreiche
Weseler Schulen beteiligen sich an dem
Aktionstag.

Der VV präsentiert sich in dicken Pullovern.
Ziel der
Kampagne ist, zu verdeutlichen, dass mit einem
warmen Pullover weniger geheizt werden muss.
„Die Stadt Wesel und die Weseler Schulen leisten
nicht nur einen Beitrag zum Energiesparen,
sondern setzen vor allem ein wichtiges
symbolisches Zeichen für den Klimaschutz“,
erläutert Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.
Im Schnitt können sechs Prozent Energie
mit dem Absenken der Raumtemperatur um einen
Grad Celsius gespart werden. Das schont nicht
nur den Geldbeutel, sondern ist zugleich eine
einfache Möglichkeit, das Klima zu schützen.
Wesels zuständiger Beigeordneter für städtische
Gebäude, Dr. Markus Postulka, lobt die Weseler
Schulen: „Es ist wichtig, vor allem bei jungen
Menschen ein Bewusstsein dafür zu entwickeln,
dass mit einfachen Maßnahmen ein praktischer
Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet
werden kann.“
In Wesel nehmen die
Gemeinschaftsgrundschulen Innenstadt,
Blumenkamp, am Buttendick, am Quadenweg sowie
Konrad-Duden teil. Zudem beteiligen sich die
beiden Weseler Gymnasien
(Andreas-Vesalius-Gymnasium,
Konrad-Duden-Gymnasium) sowie die Gesamtschule
Am Lauerhaas an der Aktion.
Ins Leben
gerufen wurde der Aktionstag in Deutschland von
der Bonnerin Corinna Nitsche Haine. Zunächst
beschränkte sich die Aktion auf den lokalen Raum
in und unmittelbar um Bonn. Erst in den
darauffolgenden Jahren entwickelte sich daraus
ein bundesweiter Aktionstag. Vorbilder für den
Dicker-Pulli-Tag waren laut Initiatorin der
niederländisch-belgische Warmetuiendag sowie der
kanadische National Sweater Day.
Bundestagswahl 2025: Briefwahl sollte
jetzt beantragt werden
Die
Teilnahme an der Bundestagswahl am 23. Februar
2025 ist auch per Briefwahl möglich, wenn man am
Wahltag nicht ins Wahllokal gehen kann oder
möchte. Wie die Bundeswahlleiterin weiter
mitteilt, sollte der Antrag auf Briefwahl so
schnell wie möglich gestellt werden, damit die
dafür erforderlichen Unterlagen rechtzeitig
eintreffen.
Durch die vom Grundgesetz
vorgegebene Frist für eine vorgezogene Neuwahl
sollten die Briefwahlunterlagen in der Regel von
den Wahlämtern den jeweiligen Postdienstleistern
bis zum 10. Februar 2025 übergeben sein und die
Wahlberechtigten innerhalb weniger Tage
erreichen.
Kampfmittelbeseitigungsdienst rückt aus
Düsseldorf an: Römerstraße in Meerbeck während
Bodensondierungen zwei Wochen gesperrt
Es
ist eine der aktuell größten Kanal- und
Straßenbaustellen in Moers. Im Rahmen des mit
der Stadt abgestimmten Erneuerungskonzeptes
saniert die ENNI Stadt & Service Niederrhein
(Enni) in der Römerstraße und einigen ihrer
angrenzenden Nebenstraßen noch bis 2026 weite
Teile der Infrastruktur.
In dem seit
dem vergangenen Frühjahr laufenden Projekt hat
die Blücherstraße bereits einen neuen
Mischwasserkanal und eine neue Fahrbahn
erhalten. Begünstigt durch die milde Witterung
wandert die Baustelle mittlerweile schrittweise
entlang der Römerstraße, die bis zum
Germensdonks Kamp ebenfalls einen neuen
Mischwasserkanal erhalten wird. Läuft weiter
alles nach Plan will der Bauüberwacher der Enni,
Brian Jäger, noch 2025 auch die Nebenstraßen,
wie den Hirtenweg, den Germendonks Kamp und die
Galgenbergsheide angehen.
Kann der
Verkehr aktuell überall in beide Fahrtrichtungen
fließen, wird es für Autofahrer in der
Römerstraße in Kürze aber noch einmal zu
Einschränkungen kommen. Denn nach einem
Verdachtsfall wird der
Kampfmittelbeseitigungsdienst der
Bezirksregierung Düsseldorf im Kreuzungsbereich
zur Galgenbergsheide umfangreiche
Bodensondierungen vornehmen.
„Die
Römerstraße wird dabei ab dem 13. Februar
zunächst für rund zwei Wochen in beide
Fahrtrichtungen zur Sackgasse“, sagt Jäger. „Wie
schon in einer vorherigen Bauphase werden wir
den Verkehr dann in Richtung Moerser Norden
wieder über die Kirschenallee sowie die Mosel-,
Jahn- und Bismarckstraße umleiten. Stadteinwärts
müssen Autofahrer das Nadelöhr dann noch einmal
über die Bismarck- und Donaustraße sowie die
Kirschenallee umfahren.“
In der
Römerstraße wird der
Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt an der
Einmündung zur Galgenbergsheide den Boden mit
mehreren hierzu notwendigen Probebohrungen auf
vorhandene Leitungen und möglicherweise noch
vorhandene alte Kampfmittel erkunden.
„Verdachtsfälle kommen in unserer Region bei
derart großen Kanalbaustellen häufiger vor und
das jetzige Vorgehen ist üblich“, so Jäger
„Sollte sich der Verdacht nicht
erhärten, kann der Verkehr danach sofort wieder
problemlos rollen.“ Bereits im Vorjahr hatte in
der Galgenbergsheide bereits eine solche erste
Sondierung stattgefunden. Im Anschluss an die
Arbeiten in der Römerstraße werden die Experten
der Kampfmittelbeseitigungsdienstes hier noch
weitere Erkundungen durchführen und dazu die
Galgenbergsheide in Höhe der Hausnummer 8 für
den Durchgangsverkehr sperren. Anlieger können
ihre Grundstücke aber durchweg erreichen. Wer
Fragen hat, kann sich unter der Rufnummer
104-600 über die Baumaßnahme informieren.
Moers: Römerstraße in Schwafheim für schwere Lkw
verboten
Aufgrund eines defekten
Durchlasses für einen Wassergraben auf der
Römerstraße in Schwafheim darf diese kleine
Brücke nicht mehr mit schweren Lkw befahren
werden.
Die entsprechende ‚7,5 t‘ –
Beschilderung wird in den umliegenden Straßen
demnächst aufgestellt. Deshalb kann das
Lebensmittelgeschäft lediglich von der Moerser
und das Gartencenter von der Düsseldorfer Straße
mit Fahrzeugen über 7,5 Tonnen angefahren
werden.
COA-Woche 2025:
Informationsstand zu Kindern aus suchtbelasteten
Familien in Moers
Am Dienstag, 18.
Februar 2025, lädt die Kreisverwaltung Wesel
alle Interessierten ein, sich im Rahmen der
„COA-Woche“ (Children of Alcoholics) über die
besondere Situation von Kindern aus
suchtbelasteten Familien zu informieren. Von 9
bis 13 Uhr steht ein Informationsstand am
Übergang zwischen dem Parkplatz an der
Mühlenstraße und der Moerser Innenstadt bereit.
Hier haben die Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, mit Fachkräften ins Gespräch zu
kommen.
Vertreterinnen der Fachstelle
Psychiatriekoordination des Kreises Wesel, des
Jugendamtes Moers sowie der
Drogenberatungsstelle der Grafschafter Diakonie
informieren vor Ort über die spezifischen
Herausforderungen, mit denen Kinder aus
suchtbelasteten Familien konfrontiert sind. Im
Fokus der Veranstaltung stehen die Auswirkungen
von Sucht auf die Entwicklung von Kindern sowie
die Bedeutung von Prävention und Intervention.
„Es ist uns ein Anliegen, die Öffentlichkeit
über die Herausforderungen, mit denen Kinder aus
suchtbelasteten Familien konfrontiert sind,
aufzuklären und ihnen die Unterstützung zu
bieten, die sie benötigen“, erklärt (Ina
Küpperbusch, Fachstelle
Psychiatriekoordination).
Im Rahmen der
COA-Woche setzen sich bundesweit verschiedene
Akteure dafür ein, das Leben von Kindern und
Jugendlichen, die in Familien mit Suchtproblemen
aufwachsen, zu verbessern. Ziel ist es,
Hilfsangebote bekannt zu machen und den
Betroffenen Wege zur Unterstützung aufzuzeigen.
Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen, den Informationsstand zu besuchen
und mehr über Unterstützungsangebote sowie
Beratungsstellen zu erfahren.
Weitere
Infos gibt Ina Küpperbusch (Kreis Wesel,
Fachdienst Gesundheitswesen, Fachstelle
Psychiatriekoordination, Netzwerkkoordinatorin
Netzwerk Kinder psychisch und-/ oder
suchterkrankter Eltern) unter 02841-202513 oder
per Mail:
Ina.kuepperbusch@kreis-wesel.de
Dinslaken: KITA Weyerskamp wird 30
Jahre - Feierlichkeiten mit Tag der offenen Tür
30 Jahre Kita Weyerskamp Unter dem Motto
„30 Jahre kunterbunter Weyerskamp“ erwarten die
Besucher tolle Aktionen in den Ateliers. Mit
selbstgestalteten Geburtstagskronen und
Glitzertattoos lässt sich vor Ort ein
Geburtstags-Outfit gestalten.

Bei Bewegung, Spaß und Kreativ-Angeboten finden
alle kleinen Besucher die passende Unterhaltung.
Bleibende Erinnerungen zum Mitnehmen bietet die
Foto-Box. Selbstverständlich ist auch für das
leibliche Wohl gesorgt. Kommt vorbei, die Kita
freut sich auf alle großen und kleinen
Besucher*innen! Wann? Samstag, 08.02.2025,
11-15 Uhr Wo? Weyerskamp 16, 46539 Dinslaken.
Sozialausschuss tagt am 19. Februar
Am Mittwoch, 19. Februar 2025, tagt der
Sozialausschuss der Stadt Dinslaken. Die Sitzung
beginnt um 17 Uhr im Stadthaus im großen
Sitzungssaal in der 6. Etage. Tagesordnungen und
Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen
finden Interessierte grundsätzlich im
Ratsinformationssystem auf www.dinslaken.de.
Am 11. Februar: Das Flick-Café in Neu_Meerbeck
geht in die nächste Runde Kurz bevor der
Frühling kommt, steht bei vielen das Ausmisten
und Sortieren der Kleidung an. Anstatt
anschließend neue Kleidungsstücke zu kaufen,
empfiehlt das ‚Flick-Café‘ im Stadtteilbüro
Neu-Meerbeck nachhaltige Alternativen und lädt
am Dienstag, 11. Februar, von 14.30 bis 16.30
Uhr zum gemeinsamen Reparieren, Flicken und
Upcyclen ein.
Unter fachkundiger
Leitung können Besucherinnen und Besucher an der
Bismarckstraße 43b beschädigte Kleidungsstücke
retten, aufwerten und ihnen einen neuen Charme
verleihen. Eine Expertin bringt eine Nähmaschine
sowie Materialien für kleinere Reparaturen mit
und gibt wertvolle Tipps, wie aus alten
Lieblingsteilen wieder tragbare Unikate werden.
In geselliger Runde bei Getränken und
Keksen, die das Stadtteilbüro Neu_Meerbeck
stellt, ist auch Zeit für anregende Gespräche
über nachhaltige Mode und kreative
Gestaltungsideen. Das Flick-Café ist eine gute
Gelegenheit, Kleidung länger im Kreislauf zu
halten und der Schnelllebigkeit der
Modeindustrie etwas entgegenzusetzen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Tierphysiotherapie hilft ab April
Vierbeinern im Herzen von Moers
Florian Szepan, Frank Putzmann (beide
Wirtschaftsförderung Moers), Janick Eschler,
Christiane Gesthuysen und Michael Kersting
(Geschäftsführer Moers Marketing GmbH) (v.l.)
freuen sich über die Ansiedlung der
Tierphysiotherapie Eschler in der Burgstraße 16.

Gruppenfoto vor der Eschler Tierphysio. (Foto:
Eschler)
Ab April helfen ausgebildete
Tierphysiotherapeutinnen und –therapeuten
Hunden, wieder auf die Pfoten zu kommen. Seit
über 30 Jahren steht der Name Eschler für
Physiotherapie und Rehabilitation in Moers und
Umgebung. Ab April betreibt Eschler auch eine
Praxis für Tierphysiotherapie Burgstraße 16. D
ie Vermietung des Ladenlokals erfolgt durch
Unterstützung des Landesprogramms ‚ZIO‘
(Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren).
Das Programm wird von der Wirtschaftsförderung
der Stadt Moers koordiniert und ermöglicht die
Anmietung von Ladenlokalen zu günstigen
Konditionen.
Geschäftsideen lohnen sich
Ziel ist es, durch die Fördermittel
Eigentümerinnen und Eigentümer leerstehender
Ladenlokale in der Innenstadt mit potenziellen
Mieterinnen und Mietern zusammenzubringen. Der
Fördergeber legt hier keinen engen Rahmen fest,
sondern öffnet das Spektrum möglicher Nutzungen
für eine größere Vielfalt. „Das Programm sorgt
für den nötigen Rückenwind, um auch neuen,
marktfähigen Formaten den Start zu erleichtert.
Wichtig ist das Signal: Es lohnt sich,
Geschäftsideen in Moers umzusetzen“, erläutert
Wirtschaftsförderer Frank Putzmann.
Therapie mit Unterwasserlaufband
Künftig
helfen extra ausgebildete
Tierphysiotherapeutinnen und –therapeuten Hunden
nach operativen Eingriffen, altersbedingten
Beeinträchtigungen oder angeborenen
orthopädischen Problemen wieder mit Freude auf
vier Pfoten durchs Leben zu gehen. „Unser Ziel
ist es, durch gezielte Physiotherapie die
Gesundheit, Mobilität und das Wohlbefinden der
Hunde zu verbessern.
Moderne
Therapieansätze und Bewegungstherapie mittels
eines Unterwasserlaufbandes werden in Moers und
Umgebung hilfebedürftigen Hunden ab dem April
2025 helfen, beschwerdefreier durchs Leben zu
gehen“, erklärt Janick Eschler.
Ehrenamtliches Engagement in der Kultur stärken
Fünf Freiwilligenagenturen aus dem Ruhrgebiet
sind jetzt Teil des Programms
"Freiwilligenagenturen:Kultur:Vernetzt" des
NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft.
Die Initiative verfolgt das Ziel, ehrenamtliches
Engagement in der freien Kulturszene zu stärken.
Die Freiwilligenagenturen in
Bottrop, Essen, Herten, Kamp-Lintfort und
Mülheim an der Ruhr entwickeln bis August 2026
gemeinsam mit Kulturfördervereinen sowie mit
Künstlerinnen und Künstlern, Theatern,
Bibliotheken und vielen weiteren Kulturorten
neue Formate, um Freiwillige für ein Engagement
in der Kultur zu gewinnen.
Das
NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft
stellt dafür bis 2026 insgesamt 425.000 Euro zur
Verfügung. idr
Informationen:
https://www.mkw.nrw/themen/kultur/kulturpolitik/zukunftsinitiative-buergerschaftliches-engagement-fuer-die-kultur
Moers: Vom urbanen Stadtkind über
asiatische Würze zu Ghettos Faust
Nur noch
Restkarten für den Enni Comedy Salon im Februar
Traumstart für den Enni Comedy Salon:
Die erste Ausgabe der beliebten
Veranstaltungsreihe am 12. Februar ist bereits
so gut wie ausverkauft. Und auch beim zweiten
Termin am 23. April ist die Halle des Moerser
Bollwerk 107 bereits zur Hälfte gefüllt.
Comedy-Fans sollten daher langfristig planen und
neben den beiden Terminen im ersten Halbjahr
auch bereits die Veranstaltungen am 1. Oktober
und am 3. Dezember in den Blick nehmen.
Eins ist bei jedem Enni Comedy Salon
gewiss: Es lohnt sich! Denn Veranstalter Volker
von Liliencron wartet jedes Mal mit einem
herausragenden Line-up der deutschen
Comedy-Größen auf. Die genaue Besetzung wird
jeweils kurzfristig vor dem Termin
bekanntgegeben.
Beim Enni Comedy
Salon am 12. Februar stehen das vom Dorf
stammende, urbane Stadtkind Christin Jugsch, der
Waschechte Kölner Ill- Young Kim, der gerne mal
mit dem nordkoreanischen Diktator verwechselt
wird, sowie Özgür Cebe alias Ghettos Faust auf
der Bühne. Einen Wechsel gab es zudem bei der
Moderation: Heino Trusheim hat das Amt
bedauerlicherweise, aber auf eigenen Wunsch nach
drei Jahren niedergelegt.

In seine Fußstapfen tritt mit Don Clarke ein
weiterer Comedy-Salon-Veteran, der mit seinem
britischen Humor und seiner unverwechselbaren
Bühnenpräsenz jedem Abend sicher seinen eigenen
Stempel aufdrücken wird.
Karten für
den Enni Comedy Salon gibt es im Internet auf
www.comedysalon.de sowie bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen.
Briefmarken
Beauty Contest
- Deutsche Post sucht
Deutschlands schönste Briefmarke 2024
- 56
Briefmarken stehen zur Auswahl – von Rocklegende
Freddie Mercury über die UEFA
Fußball-Europameisterschaft bis hin zur
Weihnachtsbäckerei
- Öffentliche
Online-Befragung startet am 6. Februar und läuft
bis 6. März 2025

Die Deutsche Post will es wieder wissen: Welche
Briefmarke war die schönste im vergangenen Jahr?
Dazu ruft sie alle Fans der Schreibkultur,
Briefmarken-Freunde und sonstige Interessierte
auf, an der öffentlichen Online-Abstimmung des
Unternehmens teilzunehmen.
Diese
startet am 6. Februar unter dem Link
www.deutschepost.de/briefmarkenwahl und läuft
bis 6. März 2025. „Wir freuen uns, wenn wieder
viele Menschen bei unserer Abstimmung mitmachen.
So erhalten wir ein noch besseres Gefühl dafür,
welche Motive bei unseren Kundinnen und Kunden
beliebt sind und womit wir ihnen eine Freude
machen können. Denn wer eine schöne, für sich
passende Briefmarke findet, schmückt damit auch
gerne seinen Brief und verstärkt so seine
Botschaft. Ohnehin hebt sich der Brief von allen
anderen Kommunikationsformaten ab, wenn der
Anlass ein besonderer ist“, sagt Benjamin Rasch,
Leiter Marketing und Produktmanagement der
Deutschen Post.
Auch 2024 war wieder für
jeden Geschmack etwas dabei: Sportfans konnten
sich an den Briefmarken zur UEFA
Fußball-Europameisterschaft und zu den
Olympischen Spielen in Paris freuen. Für
Musikfreunde gab es die Marke zur Rocklegende
Freddie Mercury. In der Serie „Helden der
Kindheit“ erschienen Das Sams und Michel aus
Lönneberga.
Wer es mehr mit Dichtern und
Denkern hat, der konnte beispielsweise zwischen
Erich Kästner und Immanuel Kant wählen.
Tierfreunde kamen mit einer süßen Hunde-Marke
auf ihre Kosten. Und nicht zu vergessen
Deutschlands erste klingende Briefmarke „Die
Weihnachtsbäckerei“, die unter tatkräftiger
Mitwirkung von Liedermacher Rolf Zuckowski und
der Firma Ravensburger entstand.
Bereits
in den vergangenen vier Jahren hat die Deutsche
Post eine solche Umfrage durchgeführt. Zur
schönsten Briefmarke 2023 war das Motiv „100
Jahre Disney“ gewählt worden. 2022 war das
„Polarlicht“ das Siegermotiv. 2021 landete die
„Sendung mit der Maus“-Marke ganz oben auf dem
Siegertreppchen, 2020 „Die Biene Maja“.
In der anonymen Online-Befragung werden
zusätzliche Fragen zu Briefmarken und deren
Nutzung gestellt. Dabei können die Teilnehmer
auch eigene Themen und Motive vorschlagen. Wer
möchte, nimmt an einem Gewinnspiel mit Preisen
rund um Post und Briefmarken teil.
Jedes
Jahr erscheinen mehr als 50 neue Briefmarken.
Jede Bürgerin und jeder Bürger kann Themen für
ein Briefmarkenmotiv vorschlagen. Diese werden
im sogenannten „Programmbeirat“ besprochen und
festgelegt, anschließend entscheidet der
„Kunstbeirat“ über die jeweiligen Motive. Beide
Gremien sind mit Politikern, Vertretern des
Bundesfinanzministeriums und der Deutschen Post
sowie Philatelisten besetzt, der Kunstbeirat
zusätzlich mit Grafikprofessoren.
Die
Hälfte der Motive gestaltet die Deutsche Post
mit eigenen Grafikern selbst. Offizieller
Herausgeber der Postwertzeichen mit dem Aufdruck
„Deutschland“ ist das Bundesministerium der
Finanzen. Erhältlich sind die Briefmarken in
Postfilialen und online im Shop der Deutschen
Post. Weitere Einzelheiten zu Briefmarken unter
deutschepost.de/briefmarke.

NRW: 17 Prozent aller Jobs befinden
sich im Niedriglohnbereich
Wie
schon im April 2023 sind auch im April 2024 rund
1,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse d. h.
17 Prozent aller rund 8,5 Millionen Jobs in
Nordrhein-Westfalen unterhalb der
bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle von
13,79 Euro brutto je Stunde entlohnt worden.
Damit liegt der Anteil der „Niedriglöhner” in
NRW leicht über dem Wert von 16 Prozent für das
Bundesgebiet.
Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, befand sich im April 2014
und somit vor Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns zum 01. Januar 2015 noch jeder
fünfte Job (20 Prozent) in NRW im
Niedriglohnbereich. Die Zahl der Niedriglohnjobs
sank seit April 2014 von rund 1,6 Millionen auf
1,4 Millionen, während die Gesamtzahl der
Beschäftigungsverhältnisse in NRW im gleichen
Zeitraum von rund 7,7 Millionen auf
8,5 Millionen anstieg.
•
Jüngere und
ältere Beschäftigte sind besonders häufig in
Niedriglohnjobs tätig
Während rund 12 bis
14 Prozent der Beschäftigten im Alter von 25 bis
65 Jahren für einen Niedriglohn tätig waren,
traf dies auf 44 Prozent der unter 25-Jährigen
und auf 35 Prozent der über 65-Jährigen zu.
•
Jede fünfte
Frau und jeder siebte Mann ist im
Niedriglohnsektor beschäftigt
Frauen waren
in der Gruppe der Beschäftigten im
Niedriglohnsektor mit rund 811 000 Jobs im
Vergleich zu den Männern (635 000 Jobs) stärker
vertreten. Gemessen an allen beschäftigten
Frauen wurde jede fünfte Frau (20 Prozent)
unterhalb der Niedriglohnschwelle entlohnt.
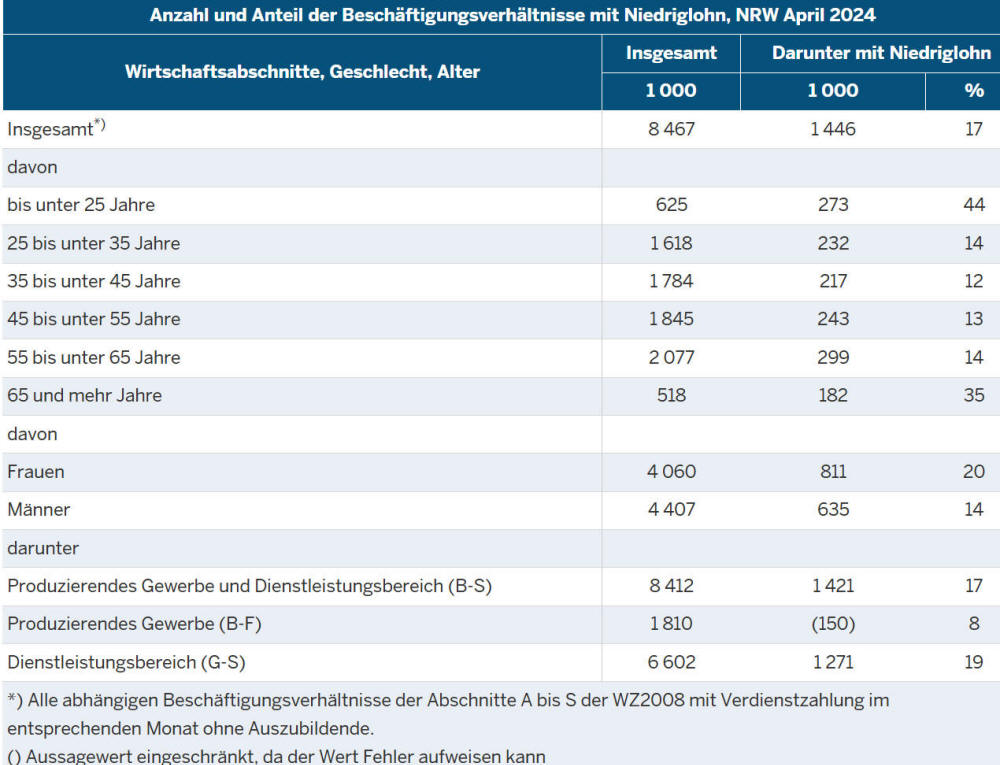
In der Gruppe der Männer trifft dies auf
jeden siebten Mann (14 Prozent) zu. Fast 90
Prozent der Niedriglohnjobs befinden sich im
Dienstleistungsbereich Mit rund 1,3 Millionen
Beschäftigungsverhältnissen befanden sich fast
90 Prozent der Niedriglohnjobs im
Dienstleistungsbereich. Während im
Dienstleistungsbereich fast jeder fünfte
Beschäftigte (19 Prozent) für einen Niedriglohn
arbeitet, trifft dies im Produzierenden Gewerbe
nur auf jeden zwölften Beschäftigten (8 Prozent)
zu.
1,3 Millionen weniger
Niedriglohnjobs von 2014 bis 2024
•
Niedriglohnquote im Osten in zehn Jahren von 35
% auf 18 % fast halbiert
• Im Westen sank
die Niedriglohnquote lediglich von 19 % auf 16 %
• Auch Verdienstabstand zwischen Gering- und
Besserverdienenden in Deutschland zwischen April
2014 und April 2024 gesunken
•
In den zehn Jahren von April 2014 bis April 2024
ist die Zahl der Niedriglohnjobs in Deutschland
um 1,3 Millionen gesunken. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im April
2024 rund 6,3 Millionen
Beschäftigungsverhältnisse und damit knapp jeder
sechste Job (16 %) mit einem
Bruttostundenverdienst unterhalb der
Niedriglohnschwelle von 13,79 Euro entlohnt.
•
Im April 2014 und somit vor der Einführung des
gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015
befand sich noch mehr als jeder fünfte Job (21 %
oder rund 7,6 Millionen) im Niedriglohnsektor.
Die Niedriglohnschwelle lag damals bei 10,00
Euro brutto je Stunde. Zum Niedriglohnsektor
zählen alle Beschäftigungsverhältnisse (ohne
Auszubildende), die mit weniger als zwei Drittel
des mittleren Bruttostundenverdienstes entlohnt
werden.
•
Bundesweit stärkster Rückgang der
Niedriglohnquote zwischen April 2022 und April
2023
Zwischen April 2022 und April 2023
sank der Anteil der Jobs unterhalb der
Niedriglohnschwelle an allen
Beschäftigungsverhältnissen um 3 Prozentpunkte
von 19 % auf 16 %. Das war der stärkste Rückgang
der Niedriglohnquote innerhalb der vergangenen
zehn Jahre. In diesem Zeitraum von April 2022
und April 2023 war der gesetzliche Mindestlohn
von 9,82 Euro auf 12,00 Euro gestiegen.
•
Niedriglohnsektor schrumpft im Osten deutlich
stärker als im Westen
Der Anteil der
niedrigentlohnten Jobs an allen
Beschäftigungsverhältnissen halbierte sich in
den östlichen Bundesländern im
Zehnjahresvergleich nahezu: Der Anteil sank um
17 Prozentpunkte von 35 % auf 18 %. In den
westlichen Ländern sank der Anteil dagegen nur
um 3 Prozentpunkte von 19 % auf 16 %.
•
Abstand zwischen Gering- und Besserverdienenden
im Zehnjahresvergleich verringert
Nicht nur
der Anteil der Niedriglohnjobs hat sich in den
zehn Jahren von 2014 bis 2024 verringert,
sondern auch der Verdienstabstand zwischen
Gering- und Besserverdienenden: So erhielten
Besserverdienende (obere 10 % der Lohnskala) im
April 2024 das 3,00-Fache des
Bruttostundenverdienstes von Geringverdienenden
(untere 10 % der Lohnskala), im April 2014 war
es noch das 3,48-Fache. Dabei zählte eine Person
im April 2024 bis zu einem
Bruttostundenverdienst von 13,00 Euro zu den
Geringverdienenden und ab 39,05 Euro brutto pro
Stunde zu den Besserverdienenden.
•
Lohngefälle im Westen nach wie vor stärker als
im Osten
Nach wie vor war das Lohngefälle
im April 2024 im Westen deutlich größer als im
Osten: So erhielten Besserverdienende in den
westlichen Bundesländern den 3,08-fachen
Bruttostundenverdienst von Geringverdienenden,
während Besserverdienende in den östlichen
Bundesländern den 2,50-fachen Verdienst von
Geringverdienenden erzielten. Im April 2014
hatte der Verdienstabstand im Westen bei 3,47
und im Osten bei 3,31 gelegen.
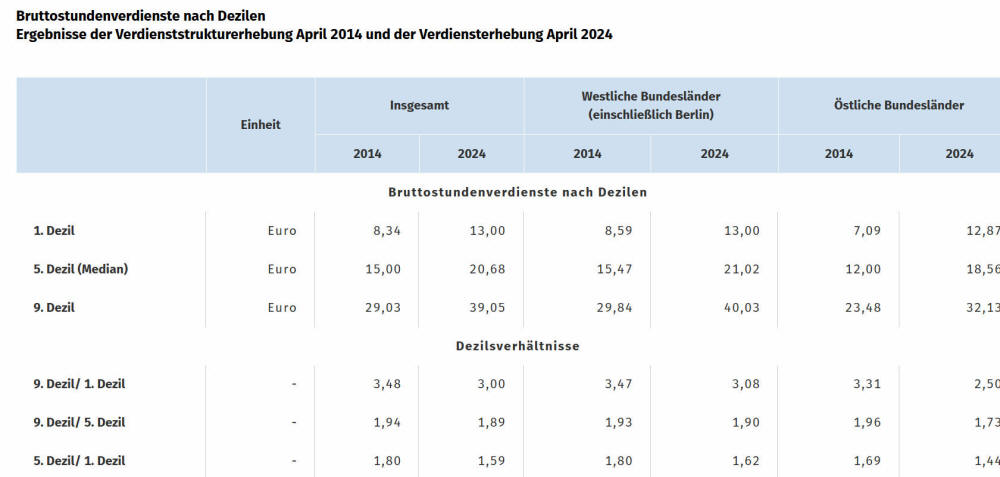
NRW: Knapp sechs
Prozent mehr Personen wurden 2023 wegen
Widerstands gegen oder Angriffen auf
Vollstreckungsbeamte verurteilt
Die
Gerichte in Nordrhein-Westfalen haben im Jahr
2023 insgesamt 2 832 Personen wegen Widerstandes
oder tätlichen Angriffen auf
Vollstreckungsbeamte verurteilt. Wie Information
und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, waren das
5,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2022:
2 680).
Zu den
Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten zählen in
erster Linie Polizeibedienstete sowie
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher.
Rund 61 Prozent der Verurteilungen gehen auf
einen tätlichen Angriff zurück In 39,2 Prozent
aller Fälle verurteilten die Gerichte Personen
wegen des Widerstandes gegen
Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB).
In diesen Fällen hatten die Verurteilten Beamten
Gewalt angedroht oder Gewalt gegen Beamtinnen
und Beamte ausgeübt, als diese eine Maßnahme
vollstrecken wollten (z. B. eine Verhaftung).
60,8 Prozent der Verurteilungen erfolgten wegen
eines tätlichen Angriffs auf
Vollstreckungsbeamte (§ 114 StGB).
Hierbei hatten die verurteilten Personen
Beamtinnen und Beamte im Dienst körperlich
angegriffen oder versucht, sie zu attackieren.
Die Tat stand nicht in einem Zusammenhang mit
einer konkreten Vollstreckungsmaßnahme. Unter
den Verurteilten waren 268 Personen in NRW, die
nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden und in
den meisten Fällen sog. Zuchtmittel
(Verwarnungen, Auflagen oder Jugendarrest) als
Strafe erhielten.
Die übrigen 2 564
Personen wurden nach allgemeinem Strafrecht
verurteilt. Die häufigste Strafe im allgemeinen
Strafrecht war die Geldstrafe (83,8 Prozent der
Verurteilungen nach § 113 StGB und 61,4 Prozent
nach § 114 StGB). Gegen rund 30 Prozent der nach
allgemeinem Strafrecht verurteilten Personen
wurde eine Freiheitsstrafe verhängt. Der Anteil
an ausgesprochenen Freiheitsstrafen lag bei den
Verurteilungen wegen des Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) bei
16,2 Prozent.
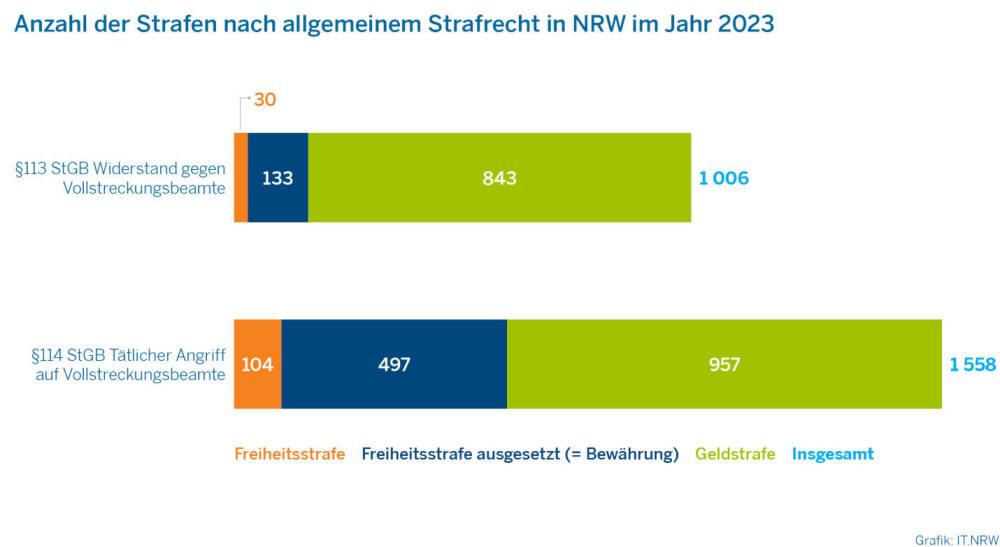
Bei 133 der insgesamt 163 zu einer
Freiheitsstrafe Verurteilten wurde die
Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt. Bei den
Verurteilungen wegen eines tätlichen Angriffs
auf Vollstreckungsbeamte (§ 114 StGB) lag der
Anteil der Freiheitsstrafen bei 38,6 Prozent.
Von den insgesamt 601 Verurteilten mit
Freiheitsstrafe erhielten 497 eine Aussetzung
der Strafvollstreckung zur Bewährung.
Zum Vergleich: Insgesamt lag der Anteil der
Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe an der
Gesamtzahl der Verurteilungen wegen Verstößen
gegen §§ 113, 114 StGB in NRW bei 29,8 Prozent.
Mehr als die Hälfte der Verurteilten bereits
zuvor wegen anderer Delikte verurteilt.
Von den im Jahr 2023 insgesamt 2 832 nach
allgemeinem und Jugendstrafrecht verurteilten
Personen waren 54,2 Prozent (1 535 Personen)
bereits in einem früheren Verfahren verurteilt
worden, wobei diesen Verurteilungen auch andere
Delikte, z. B. Diebstahl, zugrunde liegen
können.
Donnerstag,
6. Februar 2025
Moers trauert um Dr.
Jürgen Schmude

Dr. Jürgen Schmude
Mit Bestürzung hat die
Moerser Stadtgesellschaft den Tod von Dr. Jürgen
Schmude (Foto: pst, Jahr 2015) aufgenommen. Er
ist im Alter von 88 Jahren am Montag, 3.
Februar, verstorben. „Der Familie gilt unsere
herzliche und aufrichtige Anteilnahme“, erklärt
Bürgermeister Christoph Fleischhauer. „Ich habe
Dr. Jürgen Schmude als einen gradlinigen,
bescheidenen und vor allem klugen Menschen
kennengelernt, der seine Meinung stets fundiert
und mit bedachten Worten geäußert hat.“
Von 1969 bis 1994 war Schmude Mitglied des
Bundestages. Als Bundesminister für Bildung und
Wissenschaft war er von 1978 bis 1981 tätig.
Danach wurde er zuerst zum Bundesminister der
Justiz und später zum Bundesminister des Innern
ernannt.
Christliche Haltung
Trotz
seiner verantwortungsvollen und anstrengen
Aufgaben hat sich Schmude auch weiterhin
lokalpolitisch engagiert – besonders im
Kulturbereich. Unter anderem dafür hat er 2019
den Verdienstorden des Landes NRW erhalten.
Bereits 1982 hatte ihm die Stadt Moers den
Ehrenring verliehen. Angefangen hatte die
politische Laufbahn des SPD-Politikers 1964 als
Mitglied des Rates der Stadt Moers und ab 1969
als Kreistagsabgeordneter.
Neben dem
politischen und gesellschaftlichen Engagement
war Schmude die Arbeit in der Kirche sehr
wichtig. Von 1985 bis 2003 war er Präses der
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). „Seine christliche Haltung hat er stets
zum Maßstab des eigenen Handelns und seiner
eigenen Entscheidungen gemacht. Das hat mir sehr
imponiert“, so Fleischhauer abschließend.
Bundestagswahl 2025:
deutlich weniger Wahlbewerberinnen und
Wahlbewerber als 2021
Zur Bundestagswahl am
23. Februar 2025 treten insgesamt 4.506
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an. Wie die
Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, finden sich
darunter 1.422 Frauen (32 %). Bei der letzten
Wahl am 26. September 2021 hatten sich 6.211
Kandidatinnen und Kandidaten beworben (2.024
oder 33 % Frauen). Damit treten 2025 knapp 1.700
weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an
als 2021.
Bei der kommenden
Bundestagswahl bewerben sich 806 Personen nur in
einem Wahlkreis sowie 1.841 Kandidatinnen und
Kandidaten ausschließlich auf einer Landesliste.
1.859 Personen kandidieren sowohl in einem
Wahlkreis als auch auf einer Landesliste. Auf
den 229 Landeslisten der 29 Parteien (2021: 338
Landeslisten von 40 Parteien), die in den
Ländern für die Bundestagswahl 2025 zugelassen
wurden, treten insgesamt 3.700 Personen an
(2021: 4.927).
Darunter sind 1.298
oder 35 % Frauen (2021: 1.752 oder 36 %).
Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber der
SPD, der Unionsparteien CDU und CSU sowie der
FDP kandidieren in allen 299 Wahlkreisen. GRÜNE
und Die Linke sind jeweils in 297 Wahlkreisen
zugelassen worden, die AfD in 295 Wahlkreisen.
Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der
parteilosen Einzelbewerberinnen und
Einzelbewerber – von 197 bei der Bundestagswahl
2021 auf 62 bei der Bundestagswahl 2025. Die
Gesamtzahl der Wahlkreisbewerberinnen und
Wahlkreisbewerber liegt bei 2.665 (2021: 3.360),
darunter 712 oder 27 % Frauen (2021: 960 oder
29 %).
Je Wahlkreis bewerben sich
durchschnittlich 8,9 Personen. Den Stimmzettel
mit den meisten Wahlvorschlägen gibt es im
Wahlkreis 82 „Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg –
Prenzlauer Berg Ost“ mit 20 Listenpositionen.
Die wenigsten Wahlvorschläge mit jeweils 11
Listenpositionen finden sich auf den
Stimmzetteln in fünf Wahlkreisen in Thüringen.
587 der 733 gegenwärtigen Abgeordneten des
Deutschen Bundestages kandidieren erneut. Dies
entspricht einem Anteil von 80 %.
94
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber sind nach der
Bundestagswahl 2021 volljährig geworden und
damit erstmals wählbar. Die jüngste Bewerberin
bei der Bundestagswahl 2025 ist 18 Jahre alt und
kandidiert im Wahlkreis 295 „Zollernalb –
Sigmaringen“ in Baden-Württemberg. Die mit 88
Jahren älteste Bewerberin kandidiert für eine
Landesliste in Hamburg. Das Durchschnittsalter
der 4.506 Bewerberinnen und Bewerber liegt bei
der Bundestagswahl 2025 bei 45,3 Jahren (2021:
45,5 Jahre).
Zahl der Woche: 233,5
Millionen Euro für den Erhalt von Landesstraßen
2024 floss mehr Geld in die
Straßensanierung als geplant 05.02.2025 220
Millionen Euro hatte das Land
Nordrhein-Westfalen 2024 für den Erhalt der
Landesstraßen im Haushalt eingeplant.
Tatsächlich ausgegeben werden konnten am Ende
sogar 233,5 Millionen Euro.
„Wir
tragen jetzt die Hypothek vergangener Jahrzehnte
ab, in denen man sich mit vielen Neubauten
geschmückt hat, aber auf Verschleiß gefahren
ist. Den Preis dafür zahlen wir jetzt. Deshalb
sind hohe Investitionen in Erhaltungsmaßnahmen
entscheidend, um die Infrastruktur für die
Zukunft fit zu machen. Wir investieren mehr als
jede Landesregierung zuvor in die Sanierung",
erklärt NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer.

Die steigenden Investitionen in die
Landesstraßenerhaltung sind zentraler Baustein,
um den Sanierungsstau der Verkehrsinfrastruktur
in NRW abzubauen. Für die Erhaltung von
Bundesstraßen, die sich im Zuständigkeitsbereich
des Landesbetriebs Straßenbau
Nordrhein-Westfalen befinden, wurden im
vergangenen Jahr 175,5 Millionen Euro
investiert. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr
2023 eine Steigerung um 27,4 Millionen Euro
(Ist-Ausgabe 2023: 148,1 Millionen Euro).
Auch die Bilanz der Baumaßnahmen lässt
sich sehen: Insgesamt 151 Maßnahmen sah das
Landesstraßenerhaltungsprogramm für 2024 vor,
viele davon mit mehrjährigen Bauzeiten. Davon
konnten 66 Maßnahmen im vergangenen Jahr fertig
gestellt werden, 38 sind im Bau, 47 in
Vorbereitung.
Zusätzlich konnten 77
weitere Maßnahmen auf sanierungsbedürftigen
Straßenabschnitten vorgezogen und angegangen
werden. Somit weist die Bilanz der
Straßenerhaltungsmaßnahmen zum Jahresende 2024
insgesamt 181 Maßnahmen und damit 30 mehr als
vorgesehen auf.
Ziel ist es, in den
kommenden zehn Jahren den sanierungsbedürftigen
Anteil von Straßen, Brücken und Tunneln in
Nordrhein-Westfalen deutlich abzubauen. Das
NRW-Straßennetz besteht aus rund 17.000
Kilometer Straßen, mehr als 7.300
Brücken-Teilbauwerken in der Zuständigkeit des
Landes sowie weiteren Straßen und Brücken, für
die der Bund und die Kommunen zuständig sind.
Mit der im November 2023 gestarteten
Sanierungsoffensive geht NRW die große
Herausforderung an, die vorhandene
Straßeninfrastruktur zukunftsfest zu machen. Bis
Ende 2024 konnten 304 Kilometer an Bundes- und
Landesstraßen fertig saniert werden, 87
Kilometer Straßenkilometer sind derzeit in der
Realisierung. 12 Brücken wurden bereits durch
Ersatzneubauten ersetzt, 39 Brücken befinden
sich derzeit in der Realisierung und für das
Ersatzneubautenprogramm 2025 sind 42 Brücken
vorgesehen.
Der Erhalt der
Infrastruktur, besonders der Brücken, ist
vielerorts aber akut gefährdet. "Wir haben uns
jahrzehntelang zu wenig um die vorhandene
Infrastruktur gekümmert. Das holt uns jetzt mit
kaputten Brücken ein", sagte Oliver Krischer,
Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen, bei einem
Informationsbesuch zum Zustand der
Straßenbrückeninfrastruktur in Wipperfürth.
Allein in die Zuständigkeit des Landes
Nordrhein-Westfalen fallen derzeit insgesamt
6.422 Brücken (7.308 Teilbauwerke), die durch
den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
betreut werden. "Ein großer Teil der Brücken in
Nordrhein-Westfalen wurde in den 60er und 70er
Jahren gebaut. Sie sind nicht für die heutigen
Verkehrsbelastungen ausgelegt. Eine Folge wird
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
voraussichtlich ein vermehrt schlechterer
Zustand unserer Brücken sein, die deshalb
vielfach saniert oder neu gebaut werden müssen",
sagte Minister Krischer.
"Da gibt es
eine Bugwelle, der wir begegnen, in dem wir der
Sanierung, dem Erhalt und dem Ersatz von Brücken
Vorrang einräumen. Knappes Geld und noch
knappere Personalkapazitäten werden wir dort
einsetzen müssen, wo sie am dringendsten
gebraucht werden."
Moers: Anmeldeverfahren für
weiterführende Schulen startet in Kürze
Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden
Schulen für das Schuljahr 2025/2026 startet in
Kürze. Die Anmeldungen nehmen die jeweiligen
Schulsekretariate entgegen. Die Gymnasien stehen
dafür von Montag, 10. Februar, bis Mittwoch, 12.
Februar, von 14 Uhr bis 18 Uhr zur Verfügung.
Aufnahmeanträge von Absolventinnen und
Absolventen der Hauptschule und Realschule, die
ihre Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe
fortsetzen wollen, werden am Grafschafter
Gymnasium und am Gymnasium Rheinkamp
entgegengenommen.
Anmeldungen bei
Gesamtschulen vom 10. bis 12. Februar
Für die
Gesamtschulen ist der Anmeldezeitraum ebenfalls
von Montag, 10. Februar, bis Mittwoch, 12.
Februar, allerdings von 9 bis 16 Uhr. Das
Anmeldeverfahren für die gymnasiale Oberstufe an
der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, der
Anne-Frank-Gesamtschule und der
Hermann-Runge-Gesamtschule findet ebenfalls in
diesem Zeitraum statt.
Anmeldezeit für
Hauptschule und Realschule vom 24. bis 26.
Februar
Die Hauptschule und die Realschule
nehmen die Anmeldungen für die fünfte Klasse von
Montag, 24. Februar, bis Mittwoch, 26. Februar,
von 9 bis 16 Uhr entgegen. Die Eltern der
Schülerinnen und Schüler der betreffenden
Jahrgänge haben bereits ein ausführliches
Informationsschreiben des Schulträgers über das
Anmeldeverfahren erhalten.
Gemeinsam für ein
sauberes Moers: Jetzt zum Abfallsammeltag
anmelden
Die ENNI Stadt & Service
Niederrhein (Enni) lädt alle Moerser Bürgerinnen
und Bürger auch 2025 wieder zu einem
Abfallsammeltag ein. Unter dem Motto „Gemeinsam
für ein sauberes Moers“ haben Einzelpersonen,
Schulklassen, Kindergärten, Vereine und
Nachbarschaften diesmal am 8. März die
Gelegenheit, aktiv ein Zeichen für mehr
Sauberkeit in der Stadt und gegen Müllsünden zu
setzen. Interessierte können sich bis zum 28.
Februar anmelden und sich so an dieser wichtigen
Umweltaktion beteiligen.
Seit 2007
erfreuen sich die Abfallsammeltage im Rahmen der
Initiative „Sauberes Moers“ großer Beliebtheit.
Jahr für Jahr engagieren sich in der Grafenstadt
rund 1.000 Freiwillige, um tonnenweise wilden
Müll aus der Natur zu entfernen und das
Stadtbild so zu verschönern. Fundstücke sind
dabei stets nicht nur kleinere Abfälle, sondern
auch große und sperrige Gegenstände wie
Autoreifen, Möbel oder kaputte Elektrogeräte.
„Es kommt bei dieser Aktion aber
nicht nur auf die gesammelte Menge an, sondern
vor allem auf das Zeichen, das wir gemeinsam
setzen“, betont Claudia Jaeckel, die die
Abfallsammeltage der Enni seit Jahren
koordiniert. Nach der Anmeldung bespricht die
Abfallexpertin mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die Details – darunter das
gewünschte Sammelgebiet, die Ausgabe der
kostenfreien Müllsäcke und Handschuhe so-wie die
Sammelstellen, an denen Enni den gesammelten
Abfall abholt. Im Sinne der Nachhaltigkeit
empfiehlt Enni, die bereitgestellten Handschuhe
mehrfach zu nutzen oder eigene mitzubringen.
Die Abfallsammeltage helfen zu einem
besseren Stadtbild beizutragen und die Kosten
für die aufwendige Entsorgung wilder
Müllablagerungen zu reduzieren, die ansonsten
alle Moerser über die Abfallgebühren
finan-zieren. Dabei ist arglos weggeworfener
Müll auch deswegen eine Unsitte, weil sperrige
Abfälle ganz einfach beim
Kreislaufwirtschaftshof in Moers-Hülsdonk
abgeben werden können oder Enni sie nach
vorheriger Anmeldung über die Sperrmüllabfuhr
sogar direkt an Haustüren abholt.
„Alle
Moerserinnen und Moerser sollten daher ein
Interesse haben, das Thema aktiv anzugehen“, so
Claudia Jaeckel. „Schon jetzt bedanke ich mich
bei allen Freiwilligen, die die Aktion auch in
diesem Jahr unterstützen.“
Alle
Informationen zum Abfallsammeltag am 8. März
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf
www.enni.de/abfallsammeltag
Tender Rhein spendet an das Kinderhospiz
Löwenzahn und Pusteblume e. V. Eine
kleine Abordnung des Tenders A 513 RHEIN kam aus
Rostock, wo das Boot zurzeit in der Werft liegt,
auf einen Kurzbesuch in die Patenstadt. Im
Gepäck befand sich ein Scheck, der zum
wiederholten Male für das Kinderhospiz Löwenzahn
und Pusteblume e.V. bestimmt war.

In der Messe der Marinekameradschaft Wesel
e.V. fand im Beisein der stellvertretenden
Bürgermeisterin Ulla Hornemann die Übergabe des
Schecks in Höhe von 1654,00 Euro statt. Maria
van der Vliet, Schriftführerin des Hospizes,
bekam den Scheck vom Kommandanten
Korvettenkapitän Denis Bähr im Namen der
Besatzung überreicht.
Die Summe kam
während einer Versteigerung anlässlich der
Weihnachts- und Verabschiedungsfeier an Bord
zusammen. Hierzu waren auch Vertreter der
Marinekameradschaft eingeladen, die einige
maritime „Stehrümchen“ der Versteigerung
beisteuerten. Text: Marinekameradschaft Wesel e.
V. - Hajo Strotkamp
Eigenheimbesitzer
wollen in Solaranlagen, Wärmepumpen und
Elektroautos investieren – politische Vorlieben
spielen fast keine Rolle
Hausbesitzer, die im
eigenen Haus leben, planen in hohen Anteilen die
Anschaffung neuer Energietechnologien: Bis 2029
wollen zwei Drittel der Eigenheimbewohner in
Deutschland eine Solarstromanlage betreiben –
fast doppelt so viel wie heute. Bei Wärmepumpen
und Elektroautos übersteigen die
Anschaffungspläne die heutige Verbreitung sogar
deutlich. Dieser Trend ist unabhängig von der
Parteipräferenz. Zu diesen Ergebnissen kommt
eine repräsentative Umfrage des Instituts für
Demoskopie Allensbach unter mehr als 4.000
selbstnutzenden Hauseigentümern.
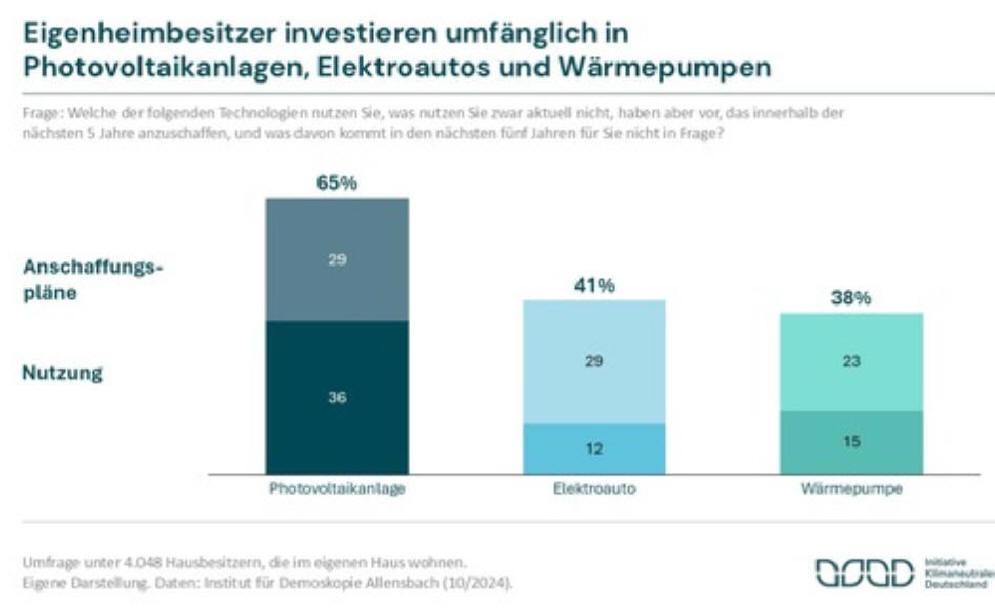
Bis 2029 könnten demnach 65 Prozent aller
Eigenheimbewohner in Deutschland eine
Solarstromanlage besitzen, 41 Prozent ein
Elektroauto und 38 Prozent eine Wärmepumpe. Das
ist beinahe eine Verdoppelung bei Solaranlagen
(derzeit 36 Prozent), mehr als eine Verdoppelung
bei Wärmepumpen (aktuell 15 Prozent) und mehr
als eine Verdreifachung bei Elektroautos
(aktuell 12 Prozent).

Solaranlagen kommt dabei eine
Schlüsselrolle zu: So zeigen Hausbesitzer, die
bereits heute ihren eigenen Solarstrom erzeugen
oder die Installation einer Solaranlage planen,
ein sehr hohes Interesse, auch in Wärmepumpen
und Elektroautos zu investieren. Ihr Anteil ist
viermal größer als bei Hausbesitzern ohne
Solarstromanlage bzw. entsprechenden
Anschaffungsplänen. Dieser Zusammenhang gilt
unabhängig von Einkommen und politischen
Vorlieben.
•
Parteipolitische
Präferenzen spielen kaum eine Rolle
Die
Umfrage zeigt, dass parteipolitische Präferenzen
von Hauseigentümern bei der Technologiewahl
insgesamt nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Jeweils rund ein Drittel der Wähler von Union
(37 Prozent), SPD (37 Prozent), FDP (44
Prozent), AfD (34 Prozent) und BSW (28 Prozent)
haben bereits eine PV-Anlagen installiert. Bei
den Unterstützern der Grünen (50 Prozent) und
der Linken (50 Prozent) ist es sogar jeder
zweite.
Auch bei den
Anschaffungsplanungen für PV-Anlagen zeichnet
sich ein über Parteipräferenzen hinweg
ausgeglichenes Bild ab: 34 Prozent der
Grünen-Wähler, 33 Prozent der BSW-Wähler und 32
Prozent der SPD-Wähler unter den
Eigenheimbesitzern planen bis 2029 eine
Investition, gefolgt von jeweils 30 Prozent bei
Unions- und 29 Prozent bei FDP-Wählern. Damit
liegt die Investitionsbereitschaft bei diesen
Wählern im Bundesdurchschnitt von 29 Prozent.
Bei den Unterstützern der Linken (25 Prozent)
und der AfD (23 Prozent) ist die Bereitschaft
zum Kauf einer Solarstromanlage etwas geringer
als im Bundesdurchschnitt.
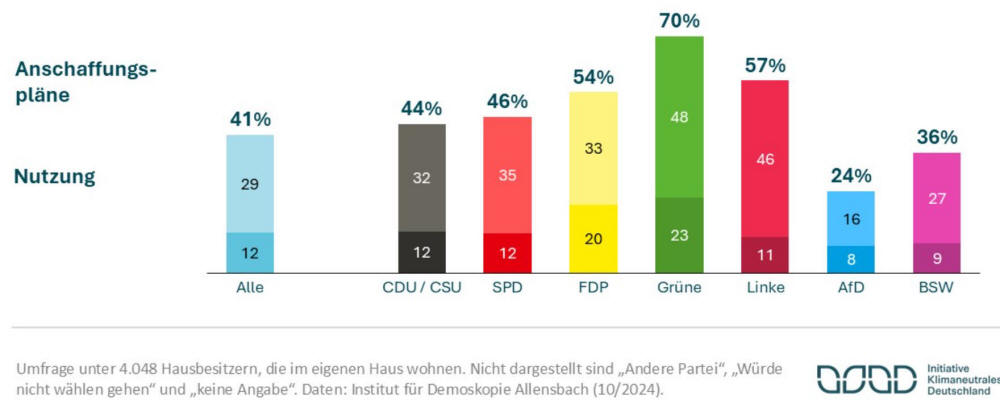
„Unsere Daten zeigen, dass die
Investitionspläne von Hausbesitzern in moderne
Energietechnologien relativ wenig von
Parteipräferenzen abhängen. Vielmehr stehen
insbesondere bei der Investition in
Photovoltaikanlagen – der zentralen Technologie
in diesem Feld – finanzielle Erwägungen im
Vordergrund. Den Ausbau privater
Photovoltaikanlagen voranzubringen, erwarten
Hausbesitzer dabei erstaunlicherweise nicht nur
von den Grünen, sondern auch von der CDU.“, sagt
Dr. Steffen de Sombre vom Institut für
Demoskopie Allensbach, der die Studie
verantwortet hat.
•
Investitionsbereitschaft
löst sich von der Höhe des Haushaltseinkommens
Bisher war die Frage, ob Eigenheimbesitzer in
Solaranlagen, Wärmepumpen oder Elektroautos
investieren, stark vom Einkommen abhängig. So
finden sich in rund der Hälfte der Haushalte mit
einem monatlichen Nettoeinkommen von 5.000 Euro
und mehr schon heute eine Solarstromanlage auf
dem Dach. Bei Haushaltseinkommen von bis zu
2.500 Euro ist das nur bei 24 Prozent der
Eigenheimbesitzer der Fall, bei Einkommen von
2.500 Euro bis unter 5.000 Euro hingegen bei 35
Prozent der Hauseigentümer.
Die Umfrage
zeigt nun, dass das Haushaltseinkommen für die
Investitionsbereitschaft in Solaranlagen keine
dominierende Rolle spielt: Bei
Haushaltseinkommen von mehr als 2.500 Euro im
Monat streben über alle Einkommensklassen hinweg
rund 30 Prozent der Hauseigentümer den Bau einer
Solarstromanlage an. Ähnlich hoch ist der Anteil
der Haushalte mit einem Einkommen von 2.500 Euro
bis 5.000 Euro, die ein Elektroauto anschaffen
wollen (30 Prozent).
Bei der Wärmepumpe
fällt die Anschaffungsbereitschaft hingegen
etwas kleiner aus. Sie liegt bei Werten von 23
Prozent in der Einkommensklasse von 2.500 bis
5.000 Euro und 31 Prozent bei den Haushalten mit
einem Einkommen von mehr als 7.500 Euro.
Hauseigentümer, die bisher keine Investition in
Erwägung ziehen, nennen hierfür über alle drei
Technologien hinweg die Anschaffungskosten als
Hauptgrund. Das betrifft vor allem die Befragten
mit einem Haushaltseinkommen von weniger als
2.500 Euro. Hier ist die
Anschaffungsbereitschaft auch am geringsten.
Umgekehrt nennt allerdings die Mehrheit der
Eigenheimbesitzer, die moderne
Energietechnologien bereits nutzen oder deren
Anschaffung planen, die Ersparnis bei den
Energiekosten als Motivation: Bei den Betreibern
von Photovoltaikanlagen sind es 81 Prozent, bei
jenen von Wärmepumpen 58 Prozent. Bei
denjenigen, die ein Elektroauto fahren oder
anschaffen wollen, geben 43 Prozent als Grund
an, dass sie zuhause laden können.
„Diese
Zahlen zeigen, dass Technologien wie Wärmepumpen
und Elektroautos längst vor allem im ländlichen
Raum angekommen sind. Hier gehen Pragmatismus
und technologische Aufgeschlossenheit vor
Ideologie. Mit den richtigen Rahmenbedingungen
kann die nächste Bundesregierung diesen
Technologieboom verstetigen. Davon würde neben
den Hausbesitzern auch der deutsche Mittelstand
profitieren, also Hersteller und
Installateure.", sagt Carolin Friedemann,
Gründerin und Geschäftsführerin der Initiative
Klimaneutrales Deutschland (IKND). Die
Initiative hatte die Umfrage in Auftrag gegeben.
Peter Wegner, Präsident des Verbands
Wohneigentum, ergänzt: „Nach den harten Debatten
scheint das Gebäudeenergiegesetz allmählich auf
der Sachebene anzukommen. Hauseigentümerinnen
und -eigentümer erwarten schlicht, dass die
kommende Bundesregierung vernünftige und – ganz
wichtig – verlässliche Investitionsbedingungen
schafft. Flankiert werden müssen diese durch
niedrigschwellige Beratungs- und
Informationsangebote.“
Die Umfrage ist
vor dem Hintergrund entstanden, dass rund 80
Prozent der Wohngebäude in Deutschland Ein- oder
Zweifamilienhäuser sind und darin 41,5 Millionen
Menschen leben – vielfach in kleinen Städten und
auf dem Land. Diese Menschen sind von den
Transformationsthemen Energieerzeugung,
zukunftsfähiges Heizen und Autofahren besonders
betroffen.
Helau und Alaaf –
Karnevalsumzüge im Kreis Wesel 2025
Die fünfte Jahreszeit ist bereits im vollen
Gange und erwartet mit dem Straßenkarneval ihren
Höhepunkt. Auch im Kreis Wesel sind die Jecken
wieder los. Mit zahlreichen teilnehmenden
Gruppen und prunkvollen Wagen ziehen die
Festzüge durch die Straßen und begeistern Jung
und Alt.
Das Team der
EntwicklungsAgentur Wirtschaft (EAW) des Kreises
Wesel hat für alle, die an dem närrischen
Treiben teilnehmen möchten, eine Übersicht über
alle diesjährigen Karnevalsumzüge
zusammengestellt. Nähere Informationen gibt es
bei der EAW unter Mail: tourismus@kreis-wesel.de
Abwendung von
Lebensversicherungs-Insolvenzen zu Lasten der
Betriebsrenten *
- Warum gerade
Betriebsrenten bei Versicherer-Schieflagen zu
kürzen sind ?
-
Insolvenzantrag oder Rettung insolventer
Lebensversicherer durch die BaFin ?
Die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) beaufsichtigt unter anderem die
Lebensversicherer. Allein die BaFin ist
berechtigt einen Insolvenzantrag zu stellen, §
312 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Die
BaFin hat jedoch mehrere Alternativen, wie
beispielweise die Bestandsübertragung oder die
Herabsetzung der Leistungen in der
Lebensversicherung.
In Frage kommt
fallweise, daß die private Auffanggesellschaft
„Protektor Lebensversicherungs-AG“ die
Rechtsansprüche der Kunden insolventer
Lebensversicherer „sichert“, indem die
Versicherungsverträge zur Aufrechterhaltung von
garantierten Leistungen und Risikoschutz
übernommen werden; §§ 221-231 VAG. Die Übernahme
der Verträge bedarf einer Anordnung der BaFin, §
222 VAG – nur bis zu fünf Prozent der
Garantieleistungen können dabei gekürzt werden.
Bei dieser Gelegenheit können auch
Tarifbestimmungen und Versicherungsbedingen
angepaßt werden. Freiwillig sind inzwischen auch
22 Pensionskassen dieser Sicherungseinrichtung
freiwillig beigetreten.
Die
unvermeidliche Insolvenz des Lebensversicherers?
Die Bafin ordnet nach Gesetz die Übertragung der
Lebensversicherungen auf Protektor nur an, wenn
dies für die Wahrung der Belange der
Versicherten erforderlich ist.
Reichen die
mit Protektor möglichen Maßnahmen absehbar
ohnehin nicht aus, weil auch bei fünf Prozent
Garantiekürzung und mit allen verpflichtenden
Nachschüssen der Branche zu viel Geld fehlt,
verbietet sich Protektor ohnehin. Dann kann die
Insolvenz geeigneter sein.
Für die
Wahrung der Belange der Versicherten kann statt
Protektor zur Abwendung der Insolvenz von
vornherein aber auch das Verfahren des
vorläufigen Zahlungsverbots und der dann auch
ungleichmäßig zulässigen Herabsetzung der
Versicherungsleistungen nach § 314 VAG besser
geeignet sein.
Etwa wenn große Teile der
Versicherten ohnehin bereits wegen beim
Lebensversicherer nur rückgedeckter Zusagen auf
betriebliche Altersversorgung (bAV) oder
Direktversicherungen über den zusagenden
Arbeitgeber geschützt sind, werden die Belange
dieser Versicherten bereits dadurch bestens
gewahrt. Die versicherten Arbeitnehmer werden
durch die Arbeitgeberhaftung, die sogenannte
Einstandspflicht für die arbeitsvertraglichen
Zusagen auf bAV-Leistungen, ausreichend
gesichert.
Herabsetzung der
Leistungen des Versicherers um weit mehr als
fünf Prozent
Geht es mithin um
bAV-Lebensversicherungen, so können diese dann
gezielt um weit mehr als die bei Protektor
erlaubten fünf Prozent herabgesetzt werden, weil
der Arbeitgeber dafür eintritt.
Die Belange
der übrigen Versicherten können dann durch
gezielte stärkere Herabsetzungen nur in den
durch Arbeitgeber ohnehin zu 100 Prozent
abgesicherten Bereichen womöglich besser gewahrt
werden als durch Protektor. Ihre Verträge können
bestenfalls ganz ohne Herabsetzungen fortgesetzt
werden.
Die Bafin wählt möglichst das
Verfahren, das zur Wahrung der Belange der
Versicherten am besten geeignet ist. Das muss
also nicht die Übertragung auf Protektor sein.
Nirgendwo im Gesetz steht, dass die BaFin die
Belange der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer
berücksichtigen müsste.
Wer meinte beim
WEF 2025, Berater kosten nur viel Geld - man
käme besser gleich zu ihm? Die BaFin MUSS ja
laut Gesetz auf die Belange der Versicherten
(also der Arbeitnehmer in der bAV), nicht der
Versicherungsnehmer (VN, also der Arbeitgeber)
abstellen. Das ist volle Absicht und macht Sinn.
Wer durch den Arbeitgeber geschützt ist (und bei
dessen ggf. auch dadurch eintretenden Insolvenz
durch den Pensionssicherungsverein PSVaG), bei
dem kann man zugunsten anderer
Versicherter,
die keine solche Kompensation erhalten, weit
mehr kürzen. Seine Belange werden dadurch nicht
beeinträchtigt.
Bisweilen versuchen
Arbeitgeber auch gegenüber den Mitarbeitern die
bAV-Leistungen
herabzusetzen, womit der Fall
dann rasch bei Gericht landen kann. Dabei wird
es schwierig sein, die tatsächliche Kürzung
genau zu beziffern, wenn man der
Versicherungsmathematik nicht kundig ist.
Versicherungsvermittler, insbesondere Makler,
werden sich auch die Frage gefallen lassen
müssen, ob und wie sie etwa den Arbeitgeber als
Versicherungsnehmer über diese existenziellen
Risiken beraten haben wollen.
In der
Praxis fehlt regelmäßig bereits in der
Beratungsdokumentation jeder Hinweis auf die
Arbeitgeberhaftung für unbegrenzte – oder bei
Protektor-AG begrenzte – Kürzungen und den Fall
der Lebensversicherer-Insolvenz, wenn all das
versagt.
*von Dr. Johannes Fiala, PhD,
RA, MBA Finanzdienstleistungen (Univ.), MM
(Univ.), Geprüfter Finanz-und Anlageberater
(A.F.A.), Bankkaufmann (www.fiala.de) und
Dipl.-Math. Peter A. Schramm, Sachverständiger
für Versicherungsmathematik, Aktuar DAV,
öffentlich bestellt und vereidigt von der IHK
Frankfurt am Main für Versicherungsmathematik in
der privaten Krankenversicherung
www.pkv-gutachter.de

50 % der Erwachsenen in Deutschland sind
verheiratet
Zahl und Anteil der
Verheirateten binnen 30 Jahren nahezu
kontinuierlich gesunken: 1993 waren noch 60 %
der Bevölkerung ab 18 Jahren verheiratet
Jede zweite erwachsene Person in Deutschland
ist verheiratet. Das entsprach 35,0 Millionen
Menschen, die Ende 2023 in einer Ehe lebten. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) zum
Welttag der Ehe am 9. Februar mitteilt, waren
das gut 50 % der Bevölkerung ab 18 Jahren
hierzulande. Zahl und Anteil der Verheirateten
sinken jedoch seit Jahren nahezu kontinuierlich:
30 Jahre zuvor hatten noch rund 39,3 Millionen
volljährige Menschen in einer Ehe gelebt, das
waren 60 % aller Erwachsenen.
Jede
dritte erwachsene Person ist ledig – Anteil
deutlich gestiegen Im selben Zeitraum stieg die
Zahl der volljährigen ledigen Personen und ihr
Anteil an der Bevölkerung ab 18 Jahren deutlich.
Ende 2023 waren 22,6 Millionen Menschen ab
18 Jahren ledig, also nicht verheiratet,
verwitwet oder geschieden. 1993 waren gut
15,8 Millionen Erwachsene ledig. Der Anteil der
Ledigen an der Bevölkerung ab 18 Jahren ist
binnen 30 Jahren von 24 % auf rund 33 %
gestiegen.
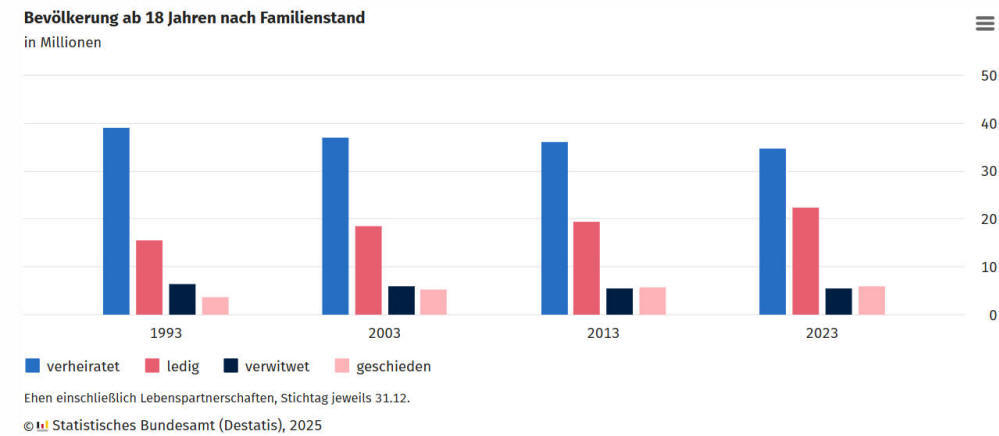
Durchschnittsalter bei der ersten Heirat auf
neuem Höchststand
Dass der Anteil der
Verheirateten seit Jahren schrumpft, geht auch
damit einher, dass die Menschen bei ihrer ersten
Heirat immer älter sind – sofern sie überhaupt
heiraten.
Das Durchschnittsalter bei der
ersten Eheschließung ist binnen 30 Jahren um
rund sechs Altersjahre gestiegen und hat einen
neuen Höchststand erreicht: Im Jahr 2023 waren
Frauen bei ihrer ersten Heirat im Schnitt
32,8 Jahre alt, Männer 35,3 Jahre.
1993
hatte das Durchschnittsalter bei der ersten
Eheschließung für Frauen bei 26,8 Jahren und für
Männer bei 29,2 Jahren gelegen.
Zahl der Eheschließungen auf zweitniedrigstem
Stand seit 1950
Die Zahl der Eheschließungen
insgesamt ist langfristig rückläufig. 2023
wurden insgesamt 361 000 Ehen geschlossen, das
war der zweitniedrigste Stand seit 1950. Mehr
als drei Viertel (78 %) der 722 000
Eheschließenden heirateten zum ersten Mal, waren
zuvor also weder geschieden noch verwitwet.
Gut 97 % der Ehen schlossen Paare
unterschiedlichen Geschlechts und knapp 3 %
Paare gleichen Geschlechts. Nach der Einführung
der Ehe für alle im Oktober 2017 gehen seit dem
Berichtsjahr 2018 auch gleichgeschlechtliche
Eheschließungen in die Statistik ein.
NRW: 2024 wurden vier
Prozent weniger Strauchbeeren geerntet
Im Jahr 2024 haben 149 nordrhein-westfälische
Betriebe auf 1 076 Hektar Anbaufläche
7 596 Tonnen Strauchbeeren produziert. Wie das
Statistische Landesamt anhand endgültiger
Ergebnisse der Strauchbeerenerhebung mitteilt,
war die Erntemenge damit um vier Prozent
geringer als im Vorjahr (2023: 7 914 Tonnen).
Damit sank die Erntemenge das zweite
Jahr in Folge und liegt auf dem Niveau von 2021.
Im Vergleich zum Jahr 2012 (damals:
3 511 Tonnen) hat sich die Erntemenge mehr als
verdoppelt. Die Landwirte im Regierungsbezirk
Köln verzeichneten gut die Hälfte der
landesweiten Erntemenge (55,7 Prozent).
Auf rund 40 Prozent der Freilandfläche
wurden Heidelbeeren angebaut
Mit einer
Anbaufläche von 904 Hektar wurden Strauchbeeren
in NRW im vergangenen Jahr überwiegend im
Freiland kultiviert. Die anbaustärkste
Strauchbeerenart ist nach wie vor die
Kulturheidelbeere, deren Anbaufläche mit
355 Hektar mehr als ein Drittel (39,3 Prozent)
der gesamten Freilandfläche für Strauchbeeren
beansprucht. Es folgten rote und weiße
Johannisbeeren (243 Hektar) und schwarze
Johannisbeeren (95 Hektar).
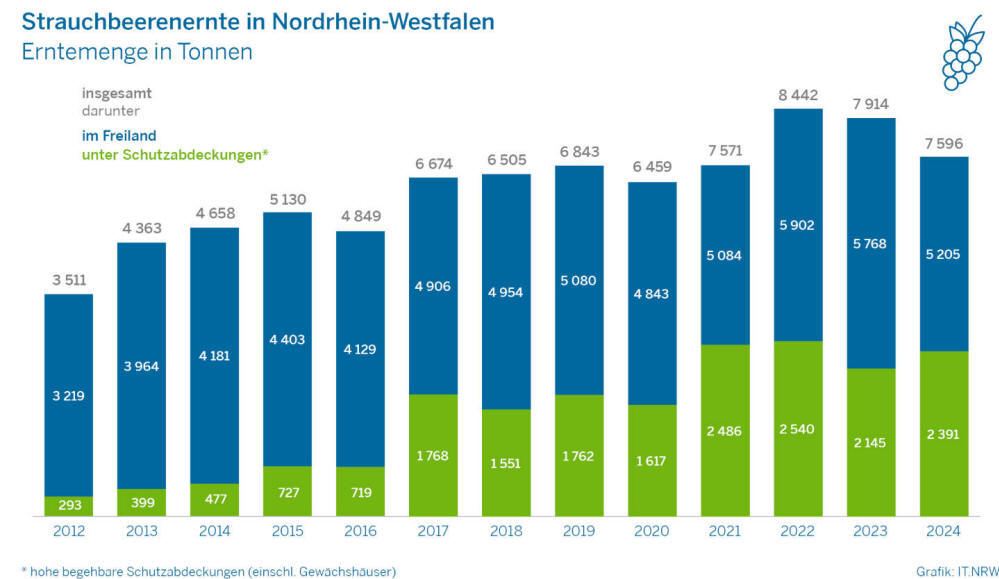
Von den 5 205 Tonnen im Freiland geernteten
Strauchbeeren entfielen 2 103 Tonnen auf die
Kulturheidelbeeren (40,4 Prozent) und
1 663 Tonnen (31,9 Prozent) auf die roten und
weißen Johannisbeeren. Unter Schutzabdeckungen
wurden 1 717 Tonnen Himbeeren angebaut Auf
172 Hektar wurden Strauchbeeren unter hohen
begehbaren Schutzabdeckungen bzw. in
Gewächshäusern angebaut; hier wurden überwiegend
Himbeeren (130 Hektar) produziert. Insgesamt
wurden auf dieser Fläche 2 391 Tonnen
Strauchbeeren erzeugt, darunter 1 717 Tonnen
Himbeeren.
Mittwoch, 5.
Februar 2025
A40: Vollsperrung im
Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg
in Fahrtrichtung Venlo
Von Freitag (14.02.)
um 21 Uhr bis Montag (17.02.) um 5 Uhr wird die
A40 im Bereich des Autobahnkreuzes
Duisburg-Kaiserberg in Fahrtrichtung Venlo
vollgesperrt. Im Zuge dieser Sperrung werden die
äußeren Stahlschutzeinrichtungen montiert sowie
eine Deckensanierung vorgenommen.
A3
Fahrtrichtung Köln: Die Ausfahrt der A3 auf die
A40 in Fahrtrichtung Venlo ist gesperrt. Die
Ausfahrt der A3 auf die A40 in Fahrtrichtung
Essen ist möglich. A3 Fahrtrichtung Arnheim: Die
Ausfahrten der A3 auf die A40 in beiden
Fahrtrichtungen sind gesperrt. Eine Umleitung
wird eingerichtet.
Empfehlung der Autobahn
GmbH den gesperrten Streckenbereich großräumig
zu umfahren.
RVR legt Kommunalfinanzbericht
Ruhrgebiet vor: Städten und Kreisen droht
erneuter Anstieg der Schulden
Die
zahlreichen Bemühungen der Ruhrgebietskommunen,
ihre Haushalte auszugleichen, sind ausgeschöpft.
Wenn die neue Bundesregierung keine tragfähige
Lösung der Altenschuldenproblematik finde und
bei der strukturellen Unterfinanzierung nicht
gegensteuere, drohe eine erneute und massive
Krise der Kommunalfinanzen, warnen die Verfasser
des Kommunalfinanzberichts Ruhrgebiet 2024.
Die Finanzanalyse im Auftrag des
Regionalverbandes Ruhr (RVR) von Professor Dr.
Martin Junkernheinrich und Gerhard Micosatt ist
heute (4. Februar) im RVR-Wirtschaftsausschuss
vorgestellt worden. Mit dem
Kommunalfinanzbericht präsentiert der RVR
jährlich eine regionale Bestandsaufnahme der
kommunalen Finanzsituation. Im Berichtsjahr 2023
haben die Kommunen in der Region im Durchschnitt
gerade noch einmal einen Haushaltsausgleich
(+900.000 Euro) erzielt.
"Im
haushalterischen Sinn waren also die
Konsolidierungsanstrengungen des letzten
Jahrzehnts erfolgreich", so Prof.
Junkernheinrich. "Doch 2023 hat sich das
Ergebnis für die Ruhrgebietskommunen schon
deutlich verschlechtert. Für 2024 ist ein
Defizit nicht mehr aufzuhalten, und der
eingeschlagene Weg zu ausgeglichenen Haushalten
steht auf tönernen Füßen."
Dies wird
an den wieder steigenden Liquiditätskrediten
deutlich: Sie haben sich im vergangenen Jahr bis
zum Ende des dritten Quartals um drei Milliarden
Euro erhöht. Der Weg zu schuldenfreien
Haushalten aus eigener Kraft hat für die
Finanzexperten Junkernheinrich und Micosatt drei
entscheidende Makel: Die nach 2020/2021
notwendige Anschlussregelung für den
Stärkungspakt Stadtfinanzen steht immer noch
aus, so dass steigende Zinsen wieder zu einem
erheblichen Problem werden.
Außerdem
werden die negativen Folgen der langjährigen
Haushaltskonsolidierung wie zum Beispiel
Investitionsverzicht und hohe Abgabenlast immer
stärker spürbar. Eine neue Krisenlage und die
anhaltend schwache Konjunktur in Deutschland
können alle Anstrengungen der letzten Jahre in
kurzer Zeit zunichtemachen. Erforderlich sind
grundsätzliche Anstrengungen, um das
Gemeindefinanzsystem mit einer
aufgabenangemessenen Finanzausstattung wieder
vom Kopf auf die Füße zu stellen und mit einem
Entschuldungsprogramm endlich einen Neustart zu
ermöglichen, so das Resümee im aktuellen
Kommunalfinanzbericht.
RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin unterstützt
daher die Forderungen der kommunalen
Spitzenverbände, die Städte und Gemeinden
stärker als bisher am Steueraufkommen zu
beteiligen und die Altschuldenproblematik zu
lösen. "Wenn diese beiden Maßnahmen beherzt
umgesetzt werden, bekommen unsere Kommunen im
Ruhrgebiet endlich wieder mehr Spielräume für
die dringend erforderliche Modernisierung der
Verkehrsinfrastruktur, den Neu- und Ausbau von
Schulen und Kindergärten, die Digitalisierung
und die Wärmewende."
IHK-Ruhrlagebericht:
Wirtschaft im Stimmungstief / Unzufriedenheit
mit politischen Rahmenbedingungen wächst
Fachkräftemangel, schwache Inlandsnachfrage,
hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie schlechte
wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen belasten
zunehmend die Wirtschaft im Ruhrgebiet. Das ist
das Fazit des 114. Ruhrlageberichts, den die
Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet
heute vorgelegt haben. An der Umfrage haben rund
780 Unternehmen mit mehr als 92.000
Beschäftigten teilgenommen.
Im
Vergleich zum Jahresbeginn 2024 ist der
IHK-Konjunkturklimaindex von 94 auf 92,7 Punkte
gesunken. Schlechter war der Wert bisher nur im
Herbst 2022 mit 77 Punkten. Nur knapp 23 Prozent
der Befragten bewerten ihre Wirtschaftslage als
gut (Vorjahr: 26 Prozent). Gleichzeitig ist die
Anzahl der Unternehmen, welche die Lage als
schlecht einschätzen, um vier Punkte auf 24
Prozent gestiegen.
Schlechte
Stimmung herrscht vor allem im Handel, wo nur 14
Prozent mit der aktuellen Geschäftslage
zufrieden sind. Im Industriesektor bezeichnen 19
Prozent die Situation als gut; im vergangenen
Jahr lag der Wert noch bei 29 Prozent. Gewachsen
ist die Unzufriedenheit mit den politischen
Rahmenbedingungen: 62 Prozent sehen darin den
größten Unsicherheitsfaktor für ihre
wirtschaftliche Entwicklung. Dazu zählen
fehlende Planbarkeit, politischer Stillstand,
überbordende Bürokratie, mangelnde Stabilität
sowie unklare Rahmenbedingungen. Eine
zusätzliche Belastung stellt die
Verkehrsinfrastruktur im Ruhrgebiet dar. idr
Bundesweite interaktive
Lern-Umgebung für die Binnenschifffahrt "BiWAS"
startet
Bi-was?! So heißt die neue
internationale Lern-Umgebung für die
Binnenschifffahrt. Die Abkürzung steht für
Binnenwasserstraßenwissen. Denn der Stau auf
unseren Straßen beginnt im Klassenzimmer. Nur
Profis wissen bisher, dass Kanäle tolle
Verkehrswege sind: Sie verbinden Transport von
Waren mit Klimaschutz.
Am 13.
Februar wird eine der größten deutschsprachige
interaktive Lehr- und Lernplattform rund um
unsere Wasserstraßen in der Niederrheinischen
IHK vorgestellt. Lehrkräfte, Lernende und
Interessierte profitieren von interaktiven
Übungen und geballtem Wissen.
Duisburg
setzt damit ein bundesweites Zeichen für Bildung
und gegen den Fachkräftemangel in der Branche.
Entwickelt wurde die Plattform von der
Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V.,
gefördert wurde das Projekt vom
Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
Fünftes Organstreitverfahren wegen
Änderung des Kommunalwahlgesetzes eingegangen
Verfassungsgerichtshof Münster: Die
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz,
Elitenförderung und basisdemokratische
Initiative, Landesverband Nordrhein-Westfalen
e.V., hat am 30. Januar 2025 ein
Organstreitverfahren gegen den Landtag
Nordrhein-Westfalen wegen der Änderung des
Kommunalwahlgesetzes hinsichtlich des
Sitzverteilungsverfahrens eingeleitet.
Die Ersetzung des bisher bei Kommunalwahlen
angewendeten Sitzungsverteilungsverfahrens nach
Sainte-Laguë durch ein Quotenverfahren mit
prozentualem Restausgleich verletze sie in ihren
Rechten auf Chancengleichheit als politische
Partei und auf Gleichheit der Wahl. VerfGH 7/25
Halbjahreszeugnisse für
rund zwei Millionen Schülerinnen und Schüler
Zeugnistelefone der Bezirksregierungen bieten
wieder Unterstützung
Am Freitag, 7. Februar 2025, endet an den rund
5.400 Schulen in Nordrhein-Westfalen das erste
Halbjahr des Schuljahrs 2024/25, und rund zwei
Millionen Schülerinnen und Schüler erhalten ihre
Halbjahreszeugnisse. Nordrhein-Westfalens
Grundschulen können die Zeugnisse bereits ab
Montag, 3. Februar 2025, ausgeben.
Schulministerin Dorothee Feller: „Die
Halbjahreszeugnisse sind ein wichtiger
Meilenstein im Schuljahr. Sie spiegeln die
Anstrengungen und den Einsatz der vergangenen
Monate wider und machen sichtbar, welche Erfolge
und Fortschritte die Schülerinnen und Schüler
bereits erzielt haben. Gleichzeitig ermutigen
sie zum Blick nach vorne und bieten den
Schülerinnen und Schülern eine wertvolle
Orientierung, um die eigenen Leistungen
gegebenenfalls noch zu verbessern.
Unseren Lehrkräften danke ich, dass sie ihren
Schülerinnen und Schülern Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten vermitteln und auf ihre
Stärken und Schwächen gleichermaßen eingehen.
Für das zweite Schulhalbjahr wünsche ich allen
Schülerinnen und Schülern, ihren Lehrkräften und
allen, die bei uns in Nordrhein-Westfalen am
Schulleben beteiligt sind, Zuversicht und viel
Freude am Lehren und Lernen.”
Zeugnis-Telefon für Eltern,
Schülerinnen und Schüler
Am Freitag, 7. Februar 2025, erhalten die
Schülerinnen und Schüler der weiterführenden
Schulen ihre Halbjahreszeugnisse. Aus diesem
Anlass bietet die Bezirksregierung Düsseldorf ‒
neben den Sorgentelefonen von Städten und
sozialen Einrichtungen ‒ wieder ein
Zeugnis-Telefon an.
Eltern sowie
Schülerinnen und Schüler können dort vor allem
rechtliche Fragen klären, etwa wenn sie die
Notengebung für ungerecht halten oder Fragen zur
Schullaufbahn haben. Das Zeugnis-Telefon zu
Fragen aus den Schulformen Realschule,
Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und
Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg ist unter
der Rufnummer 0211 475-4002 an folgenden Tagen
erreichbar:
· Freitag, 07.02.2025,
· Montag, 10.02.2025, Dienstag,
11.02.2025, jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 15:00 Uhr.
In den
Grundschulen ist die Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse bereits seit dem 03.02.2025
möglich. Zu Fragen aus den Schulformen
Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist
das Zeugnistelefon der Bezirksregierung bei den
jeweiligen Schulämtern der zehn kreisfreien
Städte sowie der fünf Kreise im Regierungsbezirk
Düsseldorf eingerichtet.
Diese sind zu den
vorgenannten Zeiten unter folgenden Rufnummern
zu erreichen:
Krefeld 02151 86-2535
oder 86-2554
Kreis Kleve 02821 85-497
Kreis Wesel 0281 207-2212
Von diesen zentralen
Rufnummern werden eingehende Anfragen
weitervermittelt an die Ansprechpersonen, die
Auskünfte zu Zeugnisfragen geben können.
Aktuelle
Aktion Mensch-Umfrage: Große Sorgen und Ängste
von Menschen mit Behinderung vor der
Bundestagswahl
- Mehrheit befürchtet zunehmende
Behindertenfeindlichkeit in Deutschland
-
Stimmungsbild von Menschen mit Behinderung
zeigt: Über zwei Drittel sorgen sich um
Bedeutungsverlust von Inklusion auf politischer
Ebene
- Befragte sehen Handlungsbedarf bei
sozialen Sicherungssystemen, bedarfsgerechten
Wohnungen und Arbeitsmarktchancen
Aktion
Mensch appelliert: Sorgen und Ängste müssen als
Weckruf verstanden werden, Diskriminierung muss
ein Ende finden. In etwas mehr als zwei Wochen
entscheiden die Bürger*innen in Deutschland
darüber, wer sie und ihre Interessen künftig im
Bundestag vertreten soll. Dass viele Menschen
mit Behinderung im Vorfeld der Wahl beunruhigt
auf die kommende Legislaturperiode blicken,
zeigen die Ergebnisse einer aktuellen
bundesweiten Online-Umfrage der
Sozialorganisation Aktion Mensch.

67 Prozent der Befragten befürchten demnach,
dass die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit
Behinderung von Parteien und Politiker*innen als
immer unwichtiger erachtet und damit – im
Vergleich zu anderen Themen – eher als „Luxus”
angesehen werden. Hiermit einher geht bei nahezu
zwei Dritteln die Angst, dass ihre Belange nach
der Bundestagswahl weniger mitgedacht werden als
zuvor. Auch mit Blick auf das
gesamtgesellschaftliche Klima zeigt sich: Über
die Hälfte der Befragten sorgt sich vor einer
Zunahme der Behindertenfeindlichkeit in
Deutschland.
„Die Umfrage zeichnet ein
erschreckendes Bild. Die geäußerten Sorgen und
Ängste von Menschen mit Behinderung müssen von
politischen Entscheider*innen als ein Weckruf
verstanden werden”, kommentiert Christina Marx,
Sprecherin der Aktion Mensch.
„Bei
Inklusion handelt es sich um nichts Geringeres
als ein Menschenrecht, zu dem sich Deutschland
mit der Ratifizierung der
UN-Behindertenrechtskonvention vor 16 Jahren
verpflichtet hat. Als Aktion Mensch senden wir
damit einen klaren Appell in Richtung Politik,
die noch immer vielfach bestehende strukturelle
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und
die erheblichen Barrieren im Alltag endlich
anzugehen.”
Soziale Gerechtigkeit und
Existenzsicherung als zentrale Handlungsfelder
Als die für sie persönlich wichtigsten Themen
geben 43 Prozent der befragten Menschen mit
Behinderung die Inflation und steigenden
Lebenshaltungskosten sowie 36 Prozent Armut und
soziale Ungleichheit an. Diese Priorisierung
verwundert nicht – schließlich unterliegen
Menschen mit Behinderung einem hohen
Armutsrisiko.
Entsprechend sollte sich
die nächste Bundesregierung aus ihrer Sicht vor
allem für den Erhalt oder Ausbau der sozialen
Sicherungssysteme, etwa die Krankenversicherung
oder das Bürgergeld (47 Prozent), mehr
bedarfsgerechte Wohnungen für Menschen mit
Behinderung (46 Prozent) und eine Verbesserung
der Arbeitsmarktchancen (36 Prozent) einsetzen.
Politische Partizipation und Teilhabe:
Enorm hohe Wahlbeteiligung geplant
Bei all
den Unsicherheiten rund um Existenzsicherung und
Diskriminierung ist es Menschen mit Behinderung
umso wichtiger, aktiv mitzuentscheiden, welche
Parteien und Politiker*innen sie künftig im
Deutschen Bundestag vertreten: Immerhin 94
Prozent der Befragten wollen bei der
Bundestagswahl von ihrem Stimmrecht Gebrauch
machen.
Und das ist den meisten laut
Umfrage auch möglich – angesprochen auf Hürden
und Herausforderungen, die sich ihnen bei der
letzten Wahl stellten, geben nahezu zwei Drittel
an, keine Hindernisse in Bezug auf die
Barrierefreiheit wahrgenommen zu haben.
Verbesserungsbedarf besteht der Befragung
zufolge dennoch vor allem bei Sitzgelegenheiten
für Wartende, dem Erreichen der Wahllokale sowie
der Orientierung innerhalb dieser.
Bundestagswahl 2025: Hinweise für blinde und
sehbehinderte Wahlberechtigte sowie zum
barrierefreien Wählen
Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025
können blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte
ihre Stimme mithilfe von Stimmzettelschablonen
eigenständig und ohne Unterstützung einer
Vertrauensperson abgeben. Wie die
Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, geben die
Landesvereine des Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenverbandes e.V. (DBSV) die
Stimmzettelschablonen kostenlos aus.
Stimmzettelschablonen werden bundesweit seit der
Bundestagswahl 2002 und der Europawahl 2004
angeboten. Die Bundesregierung erstattet den
Blindenvereinen die Herstellungskosten.
Wer mit einer Stimmzettelschablone wählen
möchte, kann diese – auch ohne Mitglied in einem
Blindenverein zu sein – bei den Landesvereinen
des DBSV anfordern. Die Stimmzettelschablone mit
den erläuternden Begleitinformationen erhalten
DBSV-Mitglieder, sobald alle notwendigen
Informationen vorliegen.
Wichtig:
Nicht-Mitglieder des DBSV müssen die
Stimmzettelschablone mit der dazugehörigen
Informations-CD beim örtlich zuständigen
DBSV-Landesverein anfordern; nur so ist
gewährleistet, dass die für den jeweiligen
Wahlkreis richtige Schablone und die richtige CD
verschickt werden kann. Wählerinnen und Wähler,
die Wahlhilfen nutzen möchten, sollten diese
möglichst frühzeitig anfordern, damit sie noch
rechtzeitig zur Wahl geliefert werden können.
Im Internet gibt es weitere Informationen
und Links zu allen Bundesländern unter
https://www.dbsv.org/wahlen.
Zum
barrierefreien Wählen
Für Wahlberechtigte mit
Mobilitätseinschränkungen ist der barrierefreie
Zugang zum Wahlraum besonders wichtig. Auf der
Wahlbenachrichtigung wird darüber informiert, ob
der Wahlraum barrierefrei zugänglich ist und wo
Informationen über barrierefreie Wahlräume und
Hilfsmittel erhältlich sind. Ist der auf der
Wahlbenachrichtigung benannte Wahlraum nicht
barrierefrei, können Betroffene einen Wahlschein
beantragen und damit in einem anderen
barrierefreien Wahlraum in ihrem Wahlkreis
wählen. Selbstverständlich besteht immer die
Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen.
Wahlberechtigte können sich unter bestimmten
Voraussetzungen im Wahllokal oder bei der
Briefwahl durch eine andere Person unterstützen
lassen. Dies gilt, wenn sie nicht (ausreichend)
lesen oder wegen einer körperlichen
Beeinträchtigung nicht selbst den Stimmzettel
kennzeichnen, falten oder in die Wahlurne werfen
können. Die Hilfsperson kann frei bestimmt
werden.
So können beispielsweise auch
Mitglieder des Wahlvorstandes bei der
Stimmabgabe helfen. Soweit erforderlich, darf
die Hilfsperson gemeinsam mit dem Wähler oder
der Wählerin die Wahlkabine aufsuchen. Die
Hilfsperson darf aber nur die Wünsche des
Wählers oder der Wählerin erfüllen und ist
verpflichtet, ihre dadurch erlangten Kenntnisse
geheim zu halten.
Moers: Abendschüler
und –schülerinnen der vhs freuen sich über
Abschlüsse
Herzlichen Glückwunsch
zum Schulabschluss!“ hieß zum Ende des
Herbstsemesters für sieben Absolventinnen und
einen Absolventen der vhs-Abendlehrgänge. Bis zu
1.000 Unterrichtsstunden haben die Frauen und
der Mann im Alter zwischen 18 und 43 Jahren
jeden Abend von montags bis donnerstags in der
vhs hinter sich gebracht.

Die stolzen Absolventinnen und der Absolvent mit
vhs-Lehrkräften und vhs-Fachbereichsleiter Tim
Henning (l.; Foto: vhs)
„Ihr
Durchhaltevermögen wird heute belohnt“, freute
sich vhs-Leiterin Beate Schieren-Ohl und
überreichte die lang ersehnten „Erweiterten
Ersten Schulabschlüsse“ (Hauptschulabschluss
nach Klasse 10A). „Besondere Ehre gebührt in
diesem Lehrgang einer Teilnehmerin mit der
Traumnote 1,0. Ebenfalls großartig ist der
bestandene Abschluss einer gebürtigen Rumänin“,
freute sich vhs-Fachbereichsleiter Tim Henning.
Sie hat an der Volkshochschule Moers
ihre ersten Bildungserfahrungen gesammelt, da
sie in Rumänien aufgrund der Tatsache, dass sie
im Rollstuhl sitzt, nicht zur Schule gehen
konnte. Bereits im vergangenen Jahr absolvierte
sie erfolgreich ihren Ersten Schulabschluss
(Hauptschulabschluss) und erreichte nun ihr
nächstes Bildungsziel.
Einige
Absolventinnen haben bereits ihre
Ausbildungsverträge in der Tasche und starten im
April in Ausbildungen im Pflege- und
Erziehungsbereich. Andere nutzen weiter die
Möglichkeiten der vhs Abendlehrgänge und streben
den nächsthöheren Schulabschluss an: die
Fachoberschulreife. Wer ebenfalls einen
Schulabschluss nachholen möchte, kann sich bei
vhs-Fachbereichsleiter Tim Henning telefonisch
unter 0 28 41/201 – 559 oder per E-Mail tim.henning@moers.de informieren.
Moers:
Musikschüler zeigen Engagement und
Durchhaltevermögen
Für ihre Erfolge
beim Regionalwettbewerb ‚Jugend musiziert‘ hat
die Moerser Musikschule die Schülerinnen und
Schüler mit ihren Lehrkräften zu einer Ehrung am
Mittwoch, 29. Januar, eingeladen.

Musizierende der Moerser Musikschule. Foto: pst
Zu einer kleinen Ehrungsfeier hat die
Moerser Musikschule Schülerinnen und Schüler der
Einrichtung am Mittwoch, 29. Januar, eingeladen.
Die Kinder und Jugendlichen von 7 bis 18 Jahren
haben sehr erfolgreich am Regionalwettbewerb
‚Jugend musiziert‘ teilgenommen, den in diesem
Jahr die Moerser Musikschule ausrichtete. Die
jungen Menschen haben 22 erste Preise und acht
zweite Preise erhalten, wobei drei Teilnehmende
zum Landeswettbewerb weitergeleitet worden sind.
Die stellvertretende Musikschulleiterin
Ulrike Schweinfurth fragte bei der Ehrung die
jungen Musikerinnen und Musiker nach ihren
Erfahrungen während der Vorbereitungen, Proben
und beim Wettbewerb. Fast alle hatten
zwischendurch Durststrecken oder waren vom Üben
‚genervt‘. Aber sie haben es ausnahmslos
durchgezogen und würden nochmal beim Wettbewerb
antreten. Ulrike Schweinfurth lobte in dem
Zusammenhang das Engagement der Jugendlichen,
die neben Schule, Hobbys, Familie und
Freundschaften trotzdem das Instrument lernen
wollen.
Sparkasse am Niederrhein
unterstützt den Wettbewerb
Auch
Musikschulleiter Georg Kresimon gratulierte den
Teilnehmenden. „Ich danke aber auch den
Lehrkräften, die euch so toll begleitet haben,
und dem Förderkreis“, sagte Kresimon. Da die
Ausrichtung des Wettbewerbs Kosten für die
Musikschule erzeugt, unterstützt die Sparkasse
am Niederrhein die Veranstaltung in jedem Jahr
finanziell.
Der Dank ging aber auch
zurück an Leiter Kresimon. Hong Lenz vom
Förderverein übergab ihm stellvertretend für den
Förderkreiseine Dank-Urkunde für sein Engagement
bei der Ausrichtung der Wettbewerbe und der
Leitung der Schule. Darin ist zu lesen: „Mit
viel Taktgefühl und Leidenschaft bist du unser
Kapellmeister der Herzen!“
Auch die
jungen Musizierenden erhielten ein kleines
Geschenk. „Ihr habt tolle Leistungen gezeigt“,
lobte Hong Lenz die Kinder und Jugendlichen. Zum
Abschluss des Nachmittags äußerte Ulrike
Schweinfurth schmunzelnd noch einen Wunsch: „Im
nächsten Jahr treffen wir uns in der gleichen
Runde – mit noch ein paar mehr Schülerinnen und
Schüler dazu!“
Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck: Infos rund ums Ehrenamt
Viele verschiedenfarbige Hände - Freiwillig -
Verschiedene Ehrenamtsmöglichkeiten stellen sich
vor. Verantwortung übernehmen, Kontakte knüpfen
und Dinge bewegen: Das sind nur 3 Gründe, um
sich ehrenamtlich zu engagieren.
An
diesem Tag informiert die Freiwilligenzentrale
Moers von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck, Bismarckstraße 43b, zum Thema
,Ehrenamt‘. Interessierte, die Ideen für
Projekte haben oder wissen möchten, wo ihre
Erfahrungen und ihr Wissen gebraucht werden,
sind herzlich eingeladen vorbeizukommen.
Rückfragen sind telefonisch beim Stadtteilbüro
Neu Meerbeck unter 0 28 41 / 201 - 530 sowie per
E-Mail an stadtteilbuero.meerbeck@moers.de
möglich.
Veranstaltungsdatum 05.02.2025 -
10:00 Uhr - 12:00 Uhr. Veranstaltungsort
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck, Bismarckstraße 43b,
47443 Moers
Moers: Lern-Treff
Viele Menschen mit Lese- und Schreibproblemen
verbergen ihre Schwierigkeiten. Sie befürchten
bloßgestellt zu werden oder ihren Arbeitsplatz
zu verlieren. Für sie heißt das, nicht
aufzufallen und die Ausbildung, Freundschaften
oder sogar ihre Partnerschaft zu riskieren.
Funktionaler Analphabetismus ist in unserer
Gesellschaft immer noch ein Tabuthema.
Deshalb bieten wir Hilfe an. Ohne Anmeldung.
Ohne Termin. Jede und jeder Erwachsene mit
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben ist
eingeladen jeden Mittwoch, zwischen 11 und 13
Uhr in das Café Sonnenblick in der Moselstr. 55
in Meerbeck zu kommen.
Bei einer
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen hilft unsere
Grundbildungsexpertin bei allen
Schriftsprachproblemen (z. B. Anträge,
Bewerbungen, Rechnungen usw.), hat ein offenes
Ohr für die Probleme und findet, sofern vom
Ratsuchenden gewünscht, auch einen passenden
Lese- und Schreibkurs.
Kursleitung: Hülya
Reske, unentgeltlich
ComedyArts
in Moers - Hennes Bender: Wiedersehen macht
Freude
Hennes Bender ist AUSHÄUSIG
AGAIN. Und einer der dienstältesten
deutschsprachigen Standup-Pioniere hat nichts
von seiner Form eingebüßt: Der Pottfather of
german Comedy kommt im praktischen
platzsparenden Vertikal-Format auf die Bühnen
zurück.

In seinem neunten Soloprogramm schaut er nicht
zurück, sondern vehement nach vorne und
verarbeitet all das in WIEDERSEHN MACHT FREUDE.
Dabei bleiben auch die wichtigsten Fragen der
heutigen Zeit nicht unbeantwortet: Was tun, wenn
es tatsächlich zu einer Eichhörnchen-Invasion
kommen sollte? Hilft dann wirklich nur noch
gehamstertes Klopapier? Und was sagen echte
Hamster eigentlich dazu? Wird der Mensch je
lernen, wie man richtig Rolltreppe fährt?
Hier hilft nur Vorbeikommen, Hinsetzen und
sich Stand-Up-Unterhaltung vom Feinsten
hingeben: Das Comedy-Comeback, auf das man lange
warten musste. Auch Hennes Bender selbst.
Dabeisein ist alles, wenn es wieder heißt:
WIEDERSEHN MACHT FREUDE.
Veranstalter:
Internationales ComedyArts Festival Moers &
Bollwerk
Gefördert durch: Sparkasse am
Niederrhein. Ticket online-Shop
Veranstaltungsdatum
06.02.2025 - 20:00 Uhr -
22:00 Uhr. Veranstaltungsort
Jugend-Kultur-Zentrum 'Bollwerk 107', Zum
Bollwerk 107, 47441 Moers
Moers: Hauskonzert
Marcel
Balbone (BF) percussion
Veranstaltungsdatum
06.02.2025 - 19:30 Uhr - 21:30 Uhr.
Veranstaltungsort Improviser Residenz.
Veranstalter Festivalbüro des moers Festivals,
Ostring 9, 47441 Moers.
Nachwächterin berichtet am 7. Februar aus
der Moerser Stadtgeschichte
Ausgestattet mit Schlapphut, Laterne und Horn
und begrüßt Gästeführerin Erika Ollefs die
Teilnehmenden des Stadtrundgangs am Freitag, 7.
Februar, um 19 Uhr. Start ist am Denkmal von
König Friedrich I. auf dem Neumarkt.

In historischer Gewandung berichtet Erika
Ollefs über die Tätigkeiten eines alten
Berufsstandes: Nachtwächter mussten damals nicht
nur die Tore öffnen und schließen, sondern auch
nachts in den Gassen nach dem Rechten sehen. Bei
dem Spaziergang erfahren die Teilnehmenden
Wissenswertes und lustige Begebenheiten aus der
Moerser Stadtgeschichte.
Weitere Infos zu den Stadtführungen
Verbindliche Anmeldungen zu der Führung nimmt
die Stadtinformation entgegen: Kirchstraße
27a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 6-0. Kosten pro
Person: 8 Euro.
Moers: Harold und Maude. Von:
Colin Higgins

(Foto: Schlosstheater Moers)
Der
neunzehnjährige Harold hat eine große
Ingenieursbegabung und nutzt diese für sein
noch größeres Interesse am Morbiden. Aus dem
Internat geworfen, besucht er in seiner
übermäßig vorhandenen Freizeit Schrottplätze
und Beerdigungen und schafft sich als Gefährt
einen Leichenwagen an. Um von seiner
egozentrischen Mutter Gefühlsreaktionen zu
erhalten, konstruiert er aufwendige
Vorrichtungen, mit denen er verschiedenste
Suizid-Szenarien fingiert.
Die
Mutter weiß sich nur noch mit einem
Psychoanalytiker und einer Dating-Plattform zu
helfen. Harold soll heiraten und normal werden.
Während er die Versuche der Mutter spektakulär
mit seiner Trickkiste sabotiert, begegnet er auf
einer Beerdigung der lebensfrohen und
energischen Maude. Kurzerhand befindet sich
Harold inmitten der Abenteuer der fast
achtzigjährigen Ex-Aktivistin und erfährt so
die Möglichkeiten des Lebens. Bald wird aus
einer Freundschaft eine Liebesgeschichte.
07.02.2025 - 19:30 Uhr - 21:15 Uhr.
Veranstaltungsort Schlosstheater - Kapelle
Adresse Rheinberger Straße 14, 47441 Moers.
Eintritt: 22 Euro, ermäßigt 8 Euro
Tickets
unter: Tel.: 0 28 41 / 8 83 41 10 oder
www.schlosstheater-moers.de
Landrat Ingo Brohl verleiht Verdienstkreuz am
Bande an Heinz Peter Maas aus Moers
Am Freitag, 31. Januar 2025, verlieh Landrat
Ingo Brohl das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
an Heinz Peter Maas aus Moers.
Der
82-jährige wurde für sein jahrelanges Engagement
für Menschen mit und ohne Sehbehinderung geehrt.
Heinz Peter Maas erblindete mit 37 Jahren. Es
gelang ihm, die Erblindung zu verarbeiten und
trotzdem bis ins hohe Alter unabhängig und
selbstbestimmt zu leben. Als Vorbild motivierte
er erfolgreich andere erblindete oder
sehbehinderte Menschen trotz des Handicaps am
Leben teilzuhaben.
Aufgrund seiner
Augenerkrankung schulte Heinz Peter Maas von
seinem Ausbildungsberuf als Garten- und
Landschaftsgärtner von 1974 bis 1977 im
Berufsförderwerk für Blinde und Sehbehinderte in
Düren zum Telefonisten um. Bereits zu der Zeit
setzte er sich im Gremium der Rehabilitierenden
für seine Mitschülerinnen und Mitschüler ein.
Darüber hinaus gehört Heinz Peter Maas
seit über 40 Jahren dem Vorstand des Blinden-
und Sehbehindertenvereins für Moers und Umgebung
e.V. an. Seit 2009 ist er 1. Vorsitzender des
Vereins. Dort steht er als Ansprechpartner für
Betroffene, Angehörige, Ärztinnen und Ärzte,
Politikerinnen und Politiker sowie für die
Verwaltung zur Verfügung.
Ende der 70er
und Anfang der 80er Jahre übernahm er außerdem
Schriftführertätigkeiten in der
Blindenwassersportgemeinschaft Moers und in der
Blindensportgemeinschaft Moers.
Er
selbst war auch sportlich aktiv und engagierte
sich intensiv in den Sportarten Blindenkegeln
und Torball. Auch hier war er als Gruppenleiter,
Abteilungsleiter und Vorstandsmitglied
Ansprechpartner und Organisator bei sportlichen
Events sowie bei Bezirks-, Landes- und
Bundesmeisterschaften.
Auch im hohen
Alter setzt sich Heinz Peter Maas noch immer für
die Belange Betroffener ein und besucht neben
Schulen auch die Krankenhäuser im Moerser
Stadtgebiet. Er bringt den Schülerinnen und
Schülern den Alltag und das Leben von
sehbehinderten Menschen näher und leistet
Aufklärungsarbeit. In den Krankenhäusern
vermittelt der Auszubildenden in der Pflege
hilfreiche Umgangsweisen mit sehbehinderten
Patienten und Patientinnen.
Seit 1998
ist Heinz Peter Maas stimmberechtigtes Mitglied
im Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt
Moers. Dort vertrat er zunächst den
Paritätischen, Kreisgruppe Wesel, und später den
Blinden- und Sehbehindertenverein für Moers und
Umgebung e.V..
Landrat Ingo Brohl: „Ich
finde es bemerkenswert, dass Sie trotz Ihrer
inzwischen 82 Lebensjahre noch immer so aktiv
und interessiert am Leben teilhaben und bin
stolz darauf, dass hier im Kreis Wesel Menschen
wie Sie leben, die bereit sind, ihre
Lebenserfahrung, Kenntnisse und Fähigkeiten,
aber auch ihre Empathie und Freundlichkeit in
den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Mit
Ihrem Engagement leisten Sie einen wertvollen
Beitrag für die Integration von Menschen mit
einer Beeinträchtigung in die Gesellschaft.
Ich hoffe, dass sich auch in Zukunft
viele Menschen im Kreis Wesel bereit erklären
werden, sich ehrenamtlich einzubringen, so wie
Sie es in vorbildlicher Weise getan haben und
auch heute noch tun. Das bedingungslose,
ehrenamtliche Helfen, ohne eine Gegenleistung
dafür zu erwarten, ist in der heutigen Zeit
nicht selbstverständlich. Ich freue mich daher
sehr darüber, Ihnen heute als Anerkennung für
Ihre Leistungen das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
überreichen zu dürfen.“


NRW-Industrie: Süßwarenproduktion war 2023
auf höchstem Stand der letzten zehn Jahre
Im Jahr 2023 sind in 44 der 9 901 produzierenden
Betrieben des nordrhein-westfälischen
Verarbeitenden Gewerbes 806 100 Tonnen Süßwaren
im Wert von 3,9 Milliarden Euro hergestellt
worden. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
anlässlich der am 2. Februar 2025 beginnenden
internationalen Süßwaren-Messe (ISM in Köln)
mitteilt, stieg die Produktionsmenge von
Süßwaren damit auf den höchsten Stand der
letzten zehn Jahre (2013: 671 000 Tonnen).
Betrachtet wurden Süßwaren ohne
Dauerbackwaren. Bezogen auf die Einwohnerzahl
des Landes sind das 121 Gramm Süßwaren pro Kopf
und Tag. Die Absatzmenge war um 30 700 Tonnen
bzw. 4,0 Prozent höher als ein Jahr zuvor; der
Absatzwert stieg nominal um 592 Millionen Euro
(+17,7 Prozent).
Der
durchschnittliche Absatzwert je Kilogramm
Süßwaren war mit 4,88 Euro um 13,3 Prozent höher
als ein Jahr zuvor. Von der
NRW-Süßwarenproduktion des Jahres 2023 entfielen
u. a. 448 000 Tonnen (+7,9 Prozent gegenüber
2022) auf Süßwaren ohne Kakaogehalt (einschl.
weißer Schokolade). Darunter befanden sich
279 900 Tonnen (+4,6 Prozent) Dragees,
Gummibonbons und Gelee-Erzeugnisse. Ferner
wurden 341 800 Tonnen (+2,2 Prozent) Schokolade
u. a. kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen
produziert.
Nahezu ein Drittel des
deutschlandweiten Absatzwerts entfiel auf NRW
Bundesweit lag der Absatzwert der
Süßwarenproduktion im Jahr 2023 bei
11,9 Milliarden Euro (+13,2 Prozent gegenüber
2022). Davon entfielen 32,9 Prozent auf
nordrhein-westfälische Betriebe (2022:
31,7 Prozent). 39,2 Prozent des
nordrhein-westfälischen Absatzwerts wurde in
Betrieben des Regierungsbezirks Köln erzielt,
gefolgt von Betrieben in den Regierungsbezirken
Detmold (32,5 Prozent), Düsseldorf
(22,0 Prozent), Münster (4,3 Prozent) und
Arnsberg mit 2,0 Prozent.
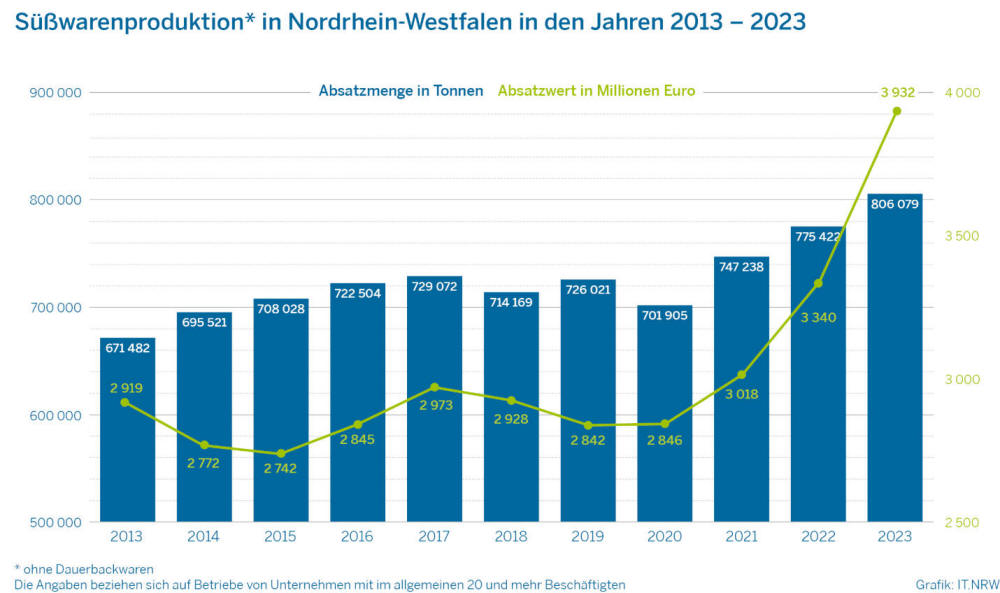
Rückgang der Süßwaren-Produktion in den
ersten drei Quartalen 2024
Für die ersten
drei Quartale 2024 liegen vorläufige Ergebnisse
vor. In 45 der nordrhein-westfälischen Betriebe
wurden 571 300 Tonnen Süßwaren (−34 500 Tonnen
bzw. −5,7 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum) hergestellt. Der Absatzwert
stieg nominal um 36 Millionen Euro
(+1,3 Prozent) auf 2,9 Milliarden Euro. Der
durchschnittliche Absatzwert pro Kilogramm stieg
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum
um 7,4 Prozent und gegenüber den ersten drei
Quartalen 2019 um 34,7 Prozent auf 5,01 Euro.
1,4 % weniger Bier im Jahr
2024 abgesetzt
• Inlandsabsatz um 2,0 % gesunken, Bierexporte
um 1,6 % höher als im Vorjahr
• Auch
langfristig sinkender Bierabsatz: Im Jahr 2024
haben die Brauereien und Bierlager 13,7 %
weniger Bier abgesetzt als im Jahr 2014
Der Bierabsatz ist im Jahr 2024 gegenüber dem
Vorjahr um 1,4 % oder 119,4 Millionen Liter
gesunken. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, setzten die in Deutschland
ansässigen Brauereien und Bierlager insgesamt
rund 8,3 Milliarden Liter Bier ab.
Damit
setzte sich die langfristige Entwicklung
sinkender Absatzzahlen trotz der Fußball-
Europameisterschaft im eigenen Land als
Großereignis im Sommer fort. In den Zahlen sind
alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus
Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU)
eingeführte Bier nicht enthalten.
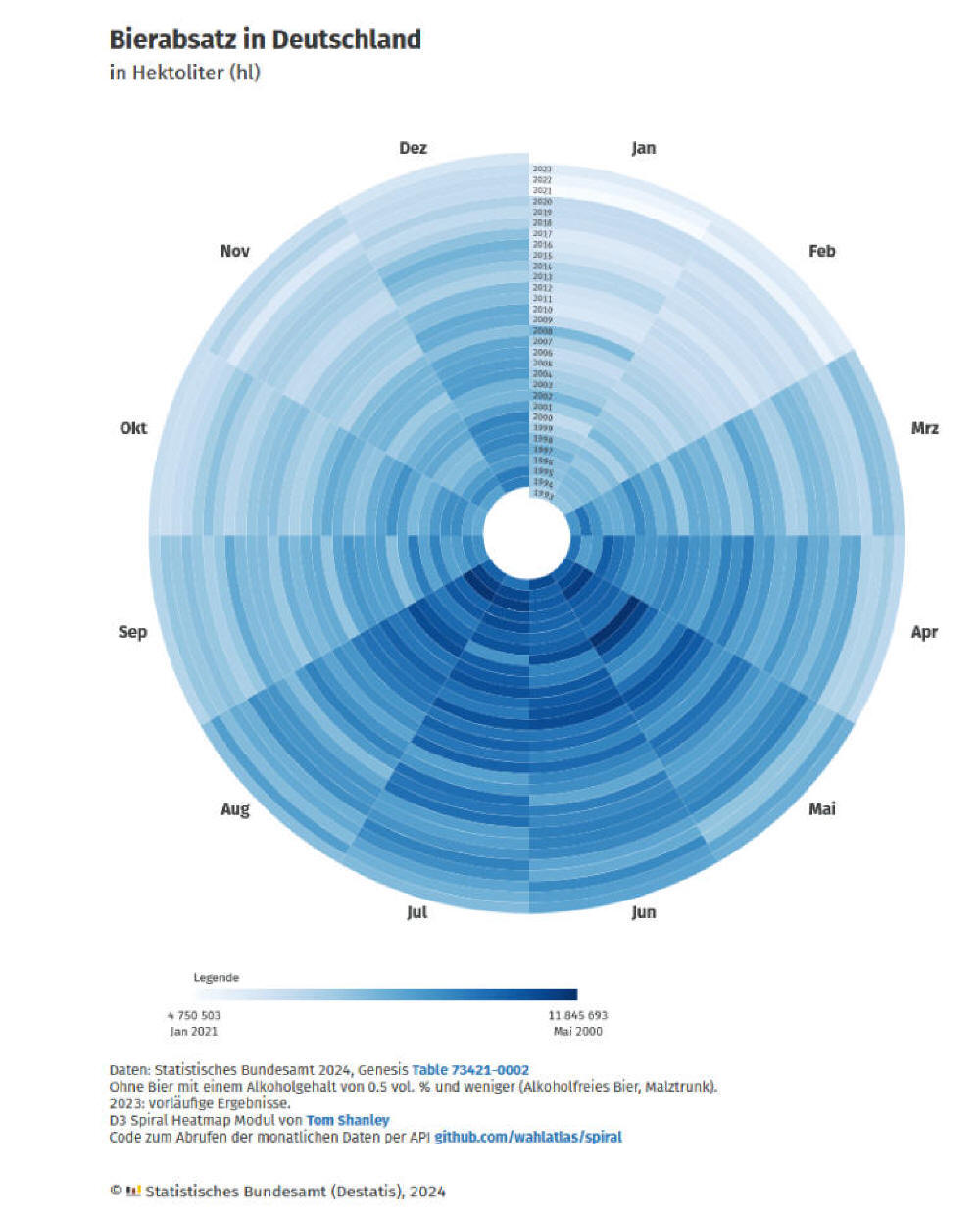
Bierabsatz mit deutlichen saisonalen
Schwankungen und langfristigem Rückgang
Bei
den monatlichen Bierabsatzzahlen zeigte sich
auch 2024 das übliche saisonale Muster: Ebenso
deutlich wie der Bierabsatz in den Frühjahrs-
und Sommermonaten stieg, ging er im Herbst und
Winter wieder zurück.
Zudem
bestätigte sich der langfristig rückläufige
Trend beim Bierabsatz: So setzten die Brauereien
und Bierlager im Jahr 2024 insgesamt 13,7 % oder
1,3 Milliarden Liter weniger Bier ab als im Jahr
2014. Inlandsabsatz sinkt um 2,0 %, Exporte
steigen um 1,6 % 82,3 % des Bierabsatzes waren
im Jahr 2024 für den Inlandsverbrauch bestimmt
und wurden versteuert. Der Inlandsabsatz sank im
Vergleich zu 2023 um 2,0 % auf 6,8 Milliarden
Liter.
17,6 % oder
1,5 Milliarden Liter Bier wurden steuerfrei
exportiert, das waren 1,6 % mehr als 2023. Davon
gingen 808,4 Millionen Liter (+3,1 %) in
EU-Staaten und 644,0 Millionen Liter (-0,3 %) in
Nicht-EU-Staaten. 10,6 Millionen Liter (-6,8 %)
gaben die Brauereien unentgeltlich als Haustrunk
an ihre Beschäftigten ab.
Auch bei
Biermischungen rückläufige Entwicklung im Jahr
2024 Bei den Biermischungen – Bier gemischt mit
Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen
alkoholfreien Zusätzen – war im Jahr 2024
ebenfalls ein Absatzrückgang zu verzeichnen.
Gegenüber dem Jahr 2023 wurden 4,6 % weniger
Biermischungen abgesetzt. Sie machten mit
384,8 Millionen Litern 4,7 % des gesamten
Bierabsatzes aus.
Dienstag, 4.
Februar 2025 - Weltkrebstag:
Weltkrebstag: Blutspenden sind für die
Krebstherapie unverzichtbar
Anlässlich des
Weltkrebstages am 04. Februar weisen die
Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) darauf hin, dass die sichere Versorgung
mit therapeutischen Blutkomponenten
(Blutkonserven) eine zentrale Rolle bei der
Behandlung von Krebspatienten spielt. Rund 20
Prozent aller Blutspenden kommen krebskranken
Mitmenschen zugute.

Nach Angaben der Deutschen
Krebshilfe erkranken in Deutschland jährlich
rund 500.000 Menschen an Krebs - Tendenz
steigend. Viele dieser Patientinnen und
Patienten sind auf regelmäßige Bluttransfusionen
angewiesen, um lebenswichtige Blutbestandteile
wie zum Beispiel Blutplättchen zu erhalten.
Blutspenden sind für Krebspatienten
überlebenswichtig Chemo- und Strahlentherapien
belasten den Körper, weil sie auch die
Blutbildung stark beeinträchtigen.
Die Chemotherapie greift die Teilungsfähigkeit
der Krebszellen an. Dabei werden auch gesunde
Blutzellen in Mitleidenschaft gezogen. Störungen
der Blutzellbildung im Knochenmark können zu
Blutungen und Blutarmut führen, weshalb
regelmäßige Bluttransfusionen notwendig werden.
Zudem sind bei Krebserkrankungen häufig
aufwändige Operationen notwendig, bei denen es
zu starken Blutungen kommen kann - ein weiterer
Grund für den hohen Bedarf an Blutspenden.
Die DRK-Blutspendedienste stellen in
Deutschland gemeinsam mit den Spenderrinnen und
Spendern einen Großteil der Versorgung von
Krankenhäusern und Arztpraxen mit Blutpräparaten
sicher. Besonders herausfordernd ist die
Versorgungskette mit Blutplättchen
(Thrombozyten), die vermehrt in der
Krebstherapie Verwendung finden und lediglich
vier Tage haltbar sind. Blutspende braucht
dringend Nachwuchs Im Jahr 2024 haben 3.160.254
Menschen beim DRK freiwillig und unentgeltlich
Blut gespendet.
Das sind in etwa
genauso viele wie im Jahr 2023. Demgegenüber
steht jedoch ein starker Rückgang der
Erstspender um mehr als sechs Prozent. Dies
verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, die
Spenderbasis zu verbreitern - gerade die
jüngeren Generationen sind aufgerufen, sich als
Lebensretterinnen und Lebensretter dauerhaft zu
engagieren. Bundesweit finden Interessierte
Informationen und Termine unter
www.drk-blutspende.de
Aktuelle
Krankenwelle
Der DRK-Blutspendedienst West
weist auf eine überdurchschnittlich starke
Erkältungs- und Grippewelle in seinem
Versorgungsgebiet (NRW, Rheinland-Pfalz,
Saarland) hin, die in den kommenden Wochen zu
einem deutlichen Rückgang der Blutspenden führen
kann. Nach Karneval ist zudem erfahrungsgemäß
mit weiteren krankheitsbedingten Ausfällen zu
rechnen.
Daher der Appell, jetzt Blut zu
spenden. Detaillierte Informationen und die
Möglichkeit, einen persönlichen Termin zur
Blutspende zu vereinbaren, finden sich zentral
unter
www.blutspende.jetzt oder telefonisch
(kostenfrei) unter 0800 11 949 11.
Gemeinsam für ein sauberes Moers:
Jetzt zum Abfallsammeltag anmelden
Die ENNI Stadt & Service Niederrhein (Enni) lädt
alle Moerser Bürgerinnen und Bürger auch 2025
wieder zu einem Abfallsammeltag ein. Unter dem
Motto „Gemeinsam für ein sauberes Moers“ haben
Einzelpersonen, Schulklassen, Kindergärten,
Vereine und Nachbarschaften diesmal am 8. März
die Gelegenheit, aktiv ein Zeichen für mehr
Sauberkeit in der Stadt und gegen Müllsünden zu
setzen. Interessierte können sich bis zum 28.
Februar anmelden und sich so an dieser wichtigen
Umweltaktion beteiligen.
Seit 2007
erfreuen sich die Abfallsammeltage im Rahmen der
Initiative „Sauberes Moers“ großer Beliebtheit.
Jahr für Jahr engagieren sich in der Grafenstadt
rund 1.000 Freiwillige, um tonnenweise wilden
Müll aus der Natur zu entfernen und das
Stadtbild so zu verschönern. Fundstücke sind
dabei stets nicht nur kleinere Abfälle, sondern
auch große und sperrige Gegenstände wie
Autoreifen, Möbel oder kaputte Elektrogeräte.
„Es kommt bei dieser Aktion aber nicht nur auf
die gesammelte Menge an, sondern vor allem auf
das Zeichen, das wir gemeinsam setzen“, betont
Claudia Jaeckel, die die Abfallsammeltage der
Enni seit Jahren koordiniert. Nach der Anmeldung
bespricht die Abfallexpertin mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Details –
darunter das gewünschte Sammelgebiet, die
Ausgabe der kostenfreien Müllsäcke und
Handschuhe so-wie die Sammelstellen, an denen
Enni den gesammelten Abfall abholt. Im Sinne der
Nachhaltigkeit empfiehlt Enni, die
bereitgestellten Handschuhe mehrfach zu nutzen
oder eigene mitzubringen.
Die
Abfallsammeltage helfen zu einem besseren
Stadtbild beizutragen und die Kosten für die
aufwendige Entsorgung wilder Müllablagerungen zu
reduzieren, die ansonsten alle Moerser über die
Abfallgebühren finan-zieren. Dabei ist arglos
weggeworfener Müll auch deswegen eine Unsitte,
weil sperrige Abfälle ganz einfach beim
Kreislaufwirtschaftshof in Moers-Hülsdonk
abgeben werden können oder Enni sie nach
vorheriger Anmel-dung über die Sperrmüllabfuhr
sogar direkt an Haustüren abholt. „Alle
Moerserinnen und Moerser sollten daher ein
Interesse haben, das Thema aktiv anzugehen“, so
Claudia Jaeckel. „Schon jetzt bedanke ich mich
bei allen Freiwilligen, die die Aktion auch in
diesem Jahr unterstützen.“
Alle
Informationen zum Abfallsammeltag am 8. März
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf
www.enni.de/abfallsammeltag
Stiftung Warentest: Experten
erklären: So ändern Sie Ihr Passwort zum letzten
Mal
Passwörter nerven. Doch sie sind
wichtig, um Datenraub und Identitätsdiebstahl zu
verhindern. Allerdings: Nach aktuellem
Sicherheitsstand sollen Passwörter nicht
regelmäßig geändert werden. Die Expertinnen und
Experten der Stiftung Warentest zeigen zum
eigentlich obsoleten „Ändere-dein-Passwort-Tag“,
wie starker Passwortschutz im Netz heute
aussieht. Das Ziel: Starker Schutz von
Internet-Konten und das Passwort zum letzten Mal
ändern.
Nie wieder das Passwort wechseln:
Diesen Wunschtraum können sich viele
Verbraucherinnen und Verbraucher am diesjährigen
„Ändere-dein-Passwort-Tag“ am 1. Februar 2025
selbst erfüllen. Denn Fachleute sind sich seit
langem einig: Anlassloses Wechseln von
Passwörtern gibt keinen Zugewinn an Sicherheit.
Sondern führt am Ende oft nur zu einfachen und
unsicheren Passwörtern. Wichtig für einen
starken Schutz der Internet-Konten: Jeder
Account bekommt ein individuelles Passwort und
wird am besten mit Zwei-Faktor-Schutz oder mit
Passkeys geschützt.
„Die neueste,
sicherste und dazu noch bequemste Alternative
zum klassischen Passwort ist Passkey. Nach einer
biometrischen Prüfung wie Fingerabdruck oder
Gesichtserkennung wird auf dem Smartphone oder
Computer ein kryptographisches Verfahren
gestartet, das den Anwender gegenüber der
Webseite authentifiziert. Der Clou: Passkeys
funktionieren nur auf der Webseite, für die sie
eingerichtet wurden. Das verhindert, dass
dubiose Nachbildungen von Banking-Seiten die
Login-Daten abgreifen können“, so Markus
Bieletzki, IT-Sicherheitsexperte der Stiftung
Warentest.
Er ergänzt: „Wird keine
Passkey-Option angeboten, so sollte jede und
jeder wenigstens die wichtigsten Internet-Konten
mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung sichern.
Hierbei wird ein starkes Passwort um ein zweites
Element, meist ein Zahlencode aus einer App,
ergänzt.“
Passwortmanager sind das Mittel
der Wahl für sichere und individuelle
Passwörter. Denn sie lösen zwei Probleme
gleichzeitig: Die damit erstellten Passwörter
sind sehr lang und komplex – und Nutzende müssen
sich nur noch ein Masterpasswort merken, mit dem
sich der Passwortmanager aufschließen lässt.
Potenzielles Problem mit dem Passwortmanager:
Vergisst man das Masterpasswort oder verliert
man Handy oder PC, auf dem er installiert ist,
ist man möglicherweise aus den eigenen Accounts
ausgesperrt, da man die einzelnen Passwörter
nicht mehr kennt.
Markus Bieletzki
empfiehlt: „Nutzen Sie die Tipps der Stiftung
Warentest, um sichere Passwörter zu erstellen
und ändern Sie Ihre Passwörter zum 1. Februar
ein letztes Mal. Und wenn Sie bereits sichere
Passwörter haben, aktivieren sie den
Zwei-Faktor-Schutz oder Passkeys.“
Tipps
für starke Passwörter, Infos rund um sichere
Internet-Konten sowie Testergebnisse zu Apps für
Zwei-Faktor Schutz und Passwortmanagern bietet
die Stiftung Warentest unter
www.test.de/passwort-tag.
Briefwahl ab sofort
Gegenüber früheren Wahlen ist der Zeitraum für
die Briefwahl verkürzt. Daher appelliert
Landeswahlleiterin Monika Wißmann an alle, die
Briefwahl machen möchten, aktiv daran
mitzuwirken, dass ihr Wahlbrief rechtzeitig
ankommt. „Die beste Variante zur Vermeidung von
Postlaufzeiten ist die Briefwahl vor Ort, auch
Direktwahl genannt. Sie wird voraussichtlich ab
dem 10. Februar in vielen Gemeinden angeboten.
Es ist dann möglich, mit der
Wahlbenachrichtigung und dem Personalausweis zum
Wahlamt zu gehen, dort die Briefwahlunterlagen
zu erhalten, die Wahl in einer Wahlkabine
auszuüben und den Wahlbrief direkt in eine
Wahlurne einzuwerfen“, erläutert die
Landeswahlleiterin.
Informationen
zur Adresse und Öffnungszeiten der betreffenden
Wahlämter und Briefwahlzentren finden sich auf
der Wahlbenachrichtigung und den Internetseiten
der Städte und Gemeinden unter dem Stichwort
Briefwahl vor Ort, Briefwahl direkt oder
Direktwahl. „Ich bin den Städten und Gemeinden
dankbar, dass sie diese Möglichkeit anbieten und
dafür zum Teil das Personal verstärkt wurde“,
erklärt Wißmann.
Wer lieber zu Hause
die Wahlunterlagen ausfüllen möchte, sollte in
Betracht ziehen, die Briefwahlunterlagen beim
Wahlamt abzuholen und den ausgefüllten Wahlbrief
rechtzeitig selbst in den Behördenbriefkasten
einzuwerfen. Briefwahlunterlagen können auch von
einer bevollmächtigten Person abgeholt werden.
Die notwendige Vollmacht kann auf der Rückseite
der Wahlbenachrichtigung erteilt werden.
Bevollmächtigte dürfen für höchstens vier
Wahlberechtigte die Wahlunterlagen abholen.
Der Briefwahlantrag kann schriftlich,
per Telefax, per E-Mail oder persönlich beim
Wahlamt des Wohnortes gestellt werden. Eine
telefonische Antragstellung ist nicht möglich.
Für schriftlichen Anträge steht die Rückseite
der Wahlbenachrichtigung zur Verfügung. Sie
sollte ausgefüllt und an der vorgesehenen Stelle
unterschrieben werden und anschließend im
Wahlamt am Wohnort abgegeben oder in einem
frankierten Umschlag dorthin geschickt werden.
Für die Antragstellung per E-Mail
haben viele Gemeinden in ihrem Internetangebot
ein Online-Formular eingerichtet. Die
Wahlbenachrichtigungen sind inzwischen bei den
rund 12,6 Millionen Wahlberechtigten in
Nordrhein-Westfalen eingegangen. “Wer jetzt noch
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber
meint, wahlberechtigt zu sein, sollte sich bis
spätestens Freitag, 07. Februar 2025, an seine
Gemeindeverwaltung wenden.
Nur dann
kann noch rechtzeitig eine Überprüfung
erfolgen“, betont Landeswahlleiterin Monika
Wißmann. Die Landeswahlleiterin weist darauf
hin, dass Wahlscheine bzw. die Briefwahl noch
bis Freitag, den 21. Februar 2025, um 15:00 Uhr
beim Wahlamt der Gemeinde beantragt werden
können. Der Wahlbrief mit gefülltem
Stimmzettelumschlag und unterschriebenem
Wahlschein muss bis zum Wahltag (23. Februar
2025) um 18 Uhr bei der Gemeinde eingehen.
Bundestagswahl 2025: Reihenfolge der
Parteien auf Stimmzetteln steht fest
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf den
Stimmzetteln innerhalb der Länder bei der
Bundestagswahl am 23. Februar 2025 steht fest.
Wie die Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, ist
die Reihenfolge der Parteien nicht im ganzen
Bundesgebiet gleich. In jedem der 299 Wahlkreise
stehen unterschiedliche Personen zur Wahl. Für
jeden Wahlkreis müssen daher eigene Stimmzettel
gedruckt werden.
Inhalt und Aufbau
der Stimmzettel sind in § 30 des
Bundeswahlgesetzes festgelegt. Auf dem
Stimmzettel in der linken Spalte werden für die
Wahl mit der Erststimme die sogenannten
Kreiswahlvorschläge aufgeführt. In der rechten
Spalte stehen für die Wahl mit der Zweitstimme
die Landeslisten der Parteien. Die Reihenfolge
ist zunächst nach den Parteien bestimmt, die mit
Landeslisten antreten.
Ihre
Reihenfolge in der rechten Spalte des
Stimmzettels richtet sich nach der Zahl der
Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bei der
letzten Bundestagswahl 2021 im jeweiligen Land
erzielt haben. Die übrigen Parteien sind in
alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Somit
ist die
Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln
innerhalb jedes einzelnen Landes einheitlich.
Bei der Bundestagswahl 2025 nimmt
Listenplatz 1 die SPD in zwölf Ländern ein (in
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Berlin, Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland). In
Sachsen und Thüringen steht die AfD an erster
Stelle, in Baden-Württemberg die CDU und in
Bayern die CSU.
Den Listenplatz 2
belegt in sieben Ländern die CDU (in
Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz und im Saarland). In vier
Ländern findet sich die SPD an zweiter Stelle
(in Sachsen, Thüringen, Bayern und
Baden-Württemberg). Die GRÜNE nimmt in Hamburg,
Bremen und Berlin den Listenplatz 2 ein, die AfD
in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.
In jeweils sieben Ländern stehen auf dem
Listenplatz 3 die CDU (in
Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen,
Brandenburg, Berlin, Sachsen und Thüringen) und
die GRÜNE (in Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Bayern und Baden-Württemberg). In Sachsen-Anhalt
ist es die AfD, im Saarland die FDP. Zugelassene
Wahlvorschläge erscheinen selbst dann auf dem
Stimmzettel, wenn eine Partei nachträglich
erklärt, auf die Teilnahme an der Wahl
verzichten zu wollen.
29 Parteien nehmen an der
Bundestagswahl 2025 teil
An der
Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am
23. Februar 2025 nehmen 29 der 41
vom Bundeswahlausschuss formal anerkannten
Parteien teil:
Niederschrift über die 2. Sitzung des
Bundeswahlausschusses für die Bundestagswahl
2025

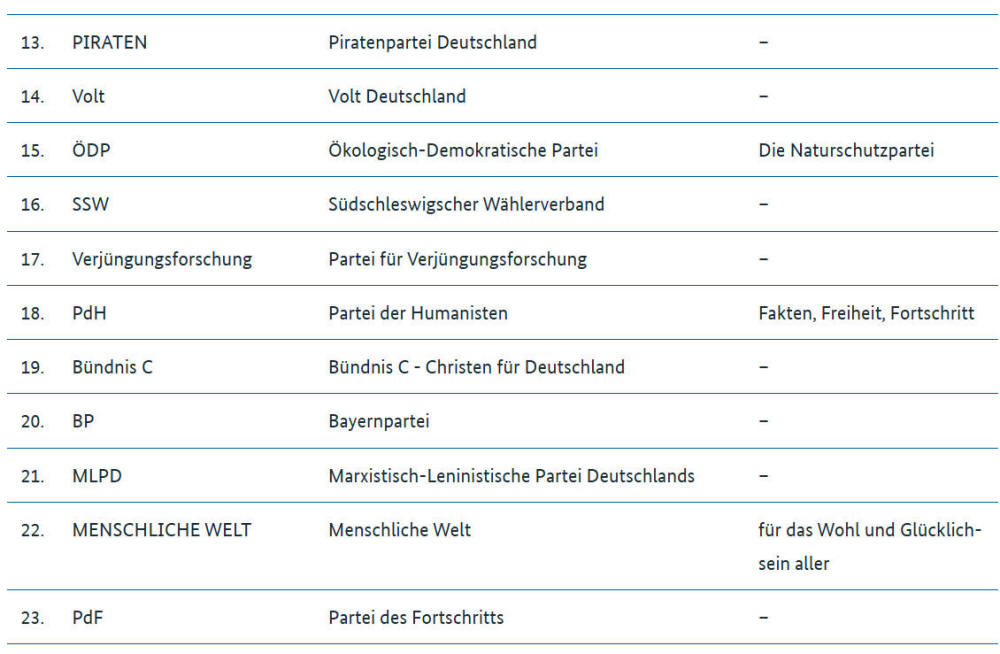

Die Parteien SPD, GRÜNE, FDP, AfD,
Die Linke, FREIE WÄHLER, Volt, MLPD, BÜNDNIS
DEUTSCHLAND und BSW sind in allen 16 Ländern mit
Landeslisten vertreten. Die CDU tritt in allen
Ländern außer Bayern an, die CSU nur in Bayern.
Die übrigen Parteien werden nicht in allen
Ländern auf den Stimmzetteln stehen. So treten
SSW, Verjüngungsforschung, Bündnis C, BP,
MENSCHLICHE WELT, SGP, BüSo und WerteUnion
jeweils nur in einem Land an.
Als Moers zur Stadt wurde
Der Moerser
Historiker Dr. Joachim Daebel wird am Mittwoch,
12. Februar, um 18.30 Uhr im Rittersaal des
Moerser Schlosses einen Vortrag über „Die
Gründung der Stadt Moers um 1300" halten. Dabei
handelt es sich um die Fortführung einer 2023
begonnenen Vortragsreihe, die auf seinem neuen
Buch basiert, das derzeit in Vorbereitung ist:
„Die Herren und Grafen von Moers. Eine
Herrschaftsgeschichte am Niederrhein 1186-1501,
Teil 1 Der Aufstieg 1186-1448."
Den
Anfang der Reihe bildeten die Vorträge ,Der
Niederrhein als geschichtlicher Raum" (24. Mai
2023) und „Die Entstehung der Grafschaft Moers"
(15.Februar 2024). Im weiteren Verlauf sollen
bedeutende Herrschergestalten aus dem Haus Moers
vorgestellt werden, die den Aufstieg der kleinen
Grafschaft bewirkt haben. Veranstalter ist der
Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in
Zusammenarbeit mit der Stadt Moers. Der Eintritt
ist frei..
Moers: Lichtspiele im Alten
Landratsamt am 6. Februar: Das weiße Band
Das
weiße Band‘ ist bei den ‚Lichtspielen im Alten
Landratsamt‘ (Kastell 5) am Donnerstag, 6.
Februar, 19.30 Uhr zu sehen. Der in schwarz-weiß
gedrehte Film handelt von unerklärlichen
Zwischenfällen, die im Sommer 1913 das Idyll
einer kleinen protestantischen Gemeinde im
Norden Deutschlands erschüttern.
Zunächst fällt der Dorf-Arzt vom Pferd und
bricht sich dabei fast den Hals. Es ist die Rede
von einem über den Weg gespannten Stolperdraht,
der jedoch nicht mehr auffindbar ist. Danach
stirbt die Frau eines Kleinbauern bei einem
vermeidbaren Arbeitsunfall im Sägewerk. Schuld
am fahrlässigen Umgang mit
Sicherheitsvorkehrungen ist offenbar der adelige
Gutsherr.
Kurz darauf wird dessen
kleiner Sohn schwer misshandelt und die Scheune
seines Hofs geht in Flammen auf. Nachdem weitere
Gewaltverbrechen geschehen, ziehen die
Dorfbewohnerinnen und –bewohner die Polizei
hinzu. Doch die Ermittler kehren unverrichteter
Dinge wieder in die Stadt zurück. Das Böse ist
unfassbar – und doch lebt es mitten unter den
Menschen. Der junge, idealistische Dorflehrer
kommt den schockierenden Zusammenhängen
schließlich auf die Spur.
Der Eintritt
zu dem Kinoabend ist frei. Um telefonische
Anmeldung wird gebeten unter 0 28 41 /
201-68200.
Wesel/Moers:
Elternkurs zum Thema Pubertät
In
der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und
Kinder des Kreises Wesel in Moers, Mühlenstr. 9
- 11, findet an den beiden Dienstagen, 01. und
08. April, jeweils von 17:00 bis 19:30 Uhr ein
kostenfreier Elternkurs zum Thema Pubertät
statt.
Eingeladen sind
Erziehungsberechtigte, die Informationen und
Handlungsanregungen erhalten möchten, um sich im
Kontakt mit ihren pubertierenden Kindern
sicherer zu fühlen. Interessierte können sich in
der Beratungsstelle unter der Telefonnummer
02841/2021931 anmelden.
Bedeutung
Zivil-Militärischer Zusammenarbeit wächst – BBK
zentraler Akteur
Als Reaktion auf die aktuellen geopolitischen
Herausforderungen hat das Zukunftsforum
Öffentliche Sicherheit jetzt das Grünbuch
„Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) 4.0 im
militärischen Krisenfall“ veröffentlicht. An der
Erarbeitung war auch das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (kurz:
BBK) beteiligt.
Der BBK-Präsident Ralph
Tiesler begrüßt die Arbeit am Thema und die
damit verbundene Aufmerksamkeit: „Eine gute
Zivil-Militärische Zusammenarbeit, also die
gegenseitige Unterstützung von Streitkräften und
der zivilen Seite, ist die Grundlage für eine
wirkungsvolle Gesamtverteidigung. Das
vorliegende Papier ermöglicht es, das Thema mehr
als bisher in den Fokus zu rücken. Es zeigt aber
auch, wie bedeutend die Arbeit des BBK im
Hinblick auf die Zivile Verteidigung ist. Zivile
und militärische Verteidigung müssen zusammen
gedacht und bearbeitet werden. Das ist seit der
Gründung des Amtes Teil unserer DNA.“
Die Arbeit des BBK folgt dem Ansatz, dass
Gesamtverteidigung gesamtgesellschaftlich
betrachtet werden muss. Deshalb arbeitet das BBK
derzeit unter anderem in einer Bund-Länder
Arbeitsgruppe unter Leitung des
Bundesinnenministeriums eng mit den
Bundesländern, dem Bundesministerium der
Verteidigung, der Bundeswehr und dem Technischen
Hilfswerk (THW) zu Fragen der Zivilen
Verteidigung zusammen. Gleichzeitig entwickeln
die Fachleute gemeinsam mit der kommunalen Ebene
Standards, die die lokale Gefahrenabwehrplanung
um Aspekte des Zivilschutzes ergänzen und dabei
auch die Zivil-Militärische Zusammenarbeit
einbeziehen.
„Es freut mich, dass der
gesamtgesellschaftliche Ansatz auch im Grünbuch
die Richtung vorgibt. Eine Armee kann ihre
Verteidigungsaufgaben nur dann gut wahrnehmen,
wenn sie unterstützt wird. Das erfordert ein
hohes Maß an Kooperation und Verantwortung.
Diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung
nehmen wir als BBK wahr. Sie ist dringend
notwendig, damit wir im Zusammenspiel aller
Akteure eine resiliente Gesellschaft sein
können, die in allen Krisen widerstandsfähig
ist“, sagt Präsident Tiesler weiter.
Bereits heute erbringt das BBK zahlreiche
Leistungen für eine effiziente
Zivil-Militärische Zusammenarbeit:
· Das BBK
implementiert die Zivile Alarmplanung. Diese
stellt sicher, dass im Krisenfall sehr schnell
zivile Maßnahmen umgesetzt werden, die die
Streitkräfte unterstützen.
· An seiner
Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile
Verteidigung (BABZ) bildet das BBK Themen der
Zivil-militärischen Zusammenarbeit aus und
fördert damit die Kooperation zwischen
militärischen und zivilen
Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträgern.
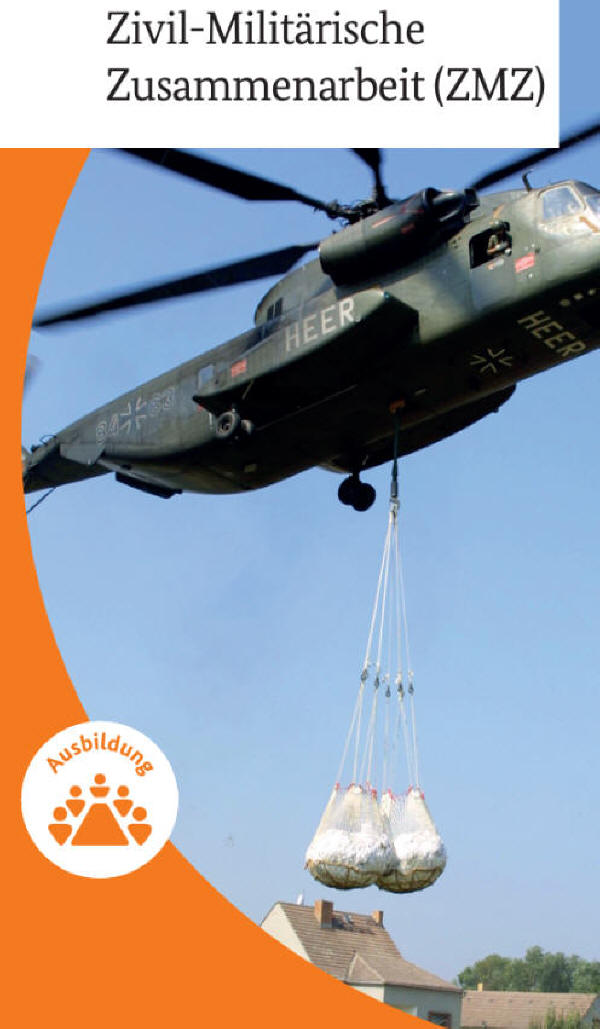
Dieses Engagement wurde 2024 mit dem CIMIC
Award of Excellence, einem Preis für
Zivil-Militärische Zusammenarbeit ausgezeichnet.
· Das BBK berät Bund, Länder und Unternehmen
zum Schutz und der Identifikation Kritischer
Infrastrukturen sowie schutzbedürftiger ziviler
Objekte, die auch für die Verteidigung wichtig
sind.
· Die Aufgaben der Warnung der
Bevölkerung vor den besonderen Gefahren eines
Verteidigungsfalls für den Bund werden durch das
BBK wahrgenommen und bundesweit koordiniert. Mit
militärischen Stellen werden warndienstliche
Informationen über chemische, biologische,
radiologische und nukleare Gefahren geteilt.
· Das BBK leistet einen Beitrag zur Erstellung
eines zivilen Lagebildes, das dazu dient, ein
Gesamtlagebild auf Bundesebene zu erreichen.
Zum Begriff Zivil-Militärische
Zusammenarbeit
Der Begriff Zivil-Militärische
Zusammenarbeit (kurz: ZMZ) beschreibt das
Zusammenwirken von staatlichen oder
nichtstaatlichen zivilen Organisationen mit den
Streitkräften.
Die Zusammenarbeit findet im
Bereich der Bündnis- und Landesverteidigung, in
der Gefahrenabwehr, bei Hilfeleistungen im
Katastrophenfall oder bei Auslandseinsätzen der
Streitkräfte im Rahmen von
Stabilisierungsoperationen oder humanitären
Hilfseinsätzen statt.


Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ,
engl. Civil-Military Co-operation, CIMIC) ist
das Zusammenwirken von staatlichen oder
nichtstaatlichen zivilen Organisationen mit
denen der militärischen Verteidigung im Bereich
der Landesverteidigung, in der Gefahrenabwehr /
Zivilschutz oder bei Auslandseinsätzen.

Weltkrebstag:
Zahl der stationären Krebsbehandlungen 2023
gegenüber Vorjahr gestiegen
Krebs
ist mit einem Anteil von 8 % an allen
Krankenhausaufenthalten der fünfthäufigste
Behandlungsgrund Krebs bleibt nach Krankheiten
des Kreislaufsystems die zweithäufigste
Todesursache Medizinischer Fortschritt: Zahl der
Todesfälle wegen Krebs bei Jüngeren binnen
20 Jahren deutlich gesunken.
Im Jahr 2023 wurden rund
1,44 Millionen Patientinnen und Patienten wegen
einer Krebserkrankung im Krankenhaus behandelt.
Damit stieg die Zahl der stationären
Krebsbehandlungen gegenüber dem Vorjahr um
2,4 %, lag aber noch immer unter dem
Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 mit
1,55 Millionen Behandlungsfällen, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des
Weltkrebstages am 4. Februar mitteilt. Die Zahl
der stationären Krankenhausbehandlungen
insgesamt stieg im Jahr 2023 gegenüber dem
Vorjahr um 2 %.

Krebs war der Grund für jeden zwölften
Krankenhausaufenthalt
Krebs war im Jahr 2023
der fünfthäufigste Grund für einen
Krankenhausaufenthalt: 8 % aller stationären
Behandlungen waren auf eine Krebserkrankung
zurückzuführen. Häufiger wurden nur Krankheiten
des Kreislaufsystems (15 %), Verletzungen,
Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen
(10 %), Krankheiten des Verdauungssystems (10 %)
und Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und
Bindegewebes (8 %) stationär behandelt.
Mehr als die Hälfte aller Krebspatientinnen und
-patienten im Alter von 60 bis 79 Jahren
Besonders häufig werden Menschen im Alter von 60
bis 79 Jahren wegen Krebs im Krankenhaus
behandelt. Mehr als die Hälfte (55 %) aller
Krebspatientinnen und -patienten war 2023 in
dieser Altersgruppe. Ein Fünftel (20 %) der
Krebspatientinnen und -patienten war im Alter
von 40 bis 59 Jahren, weitere 20 % waren 80
Jahre oder älter. Jüngere Menschen werden
deutlich seltener aufgrund einer Krebserkrankung
stationär behandelt: Nur 5 % der
Krebspatientinnen und -patienten waren unter 40
Jahre alt.
Lungenkrebs war die Ursache
für jede achte stationäre Krebsbehandlung
Von
allen Krebspatientinnen und -patienten 2023
wurden diejenigen mit der Diagnose Lungen- und
Bronchialkrebs (12 %), Darmkrebs (10 %) und
Brustkrebs (9 %) am häufigsten versorgt, gefolgt
von Hautkrebs (8 %), Harnblasenkrebs (7 %) und
Prostatakrebs (7 %).
Unter den
weitverbreiteten Krebserkrankungen gab es im
Jahr 2023 durchweg einen Anstieg der stationären
Behandlungen gegenüber dem Vorjahr: Am
deutlichsten stiegen dabei die
Krankenhausaufenthalte aufgrund von Hautkrebs
(+7 %), Prostatakrebs (+7 %) und Harnblasenkrebs
(+4 %).
230 300 Menschen starben 2023 an
den Folgen von Krebs
Mit verbesserter
Prävention, Vorsorge und Behandlung bei
Krebserkrankungen steigen auch die
Heilungschancen. Zwar ist die Zahl der
Todesfälle mit der Ursache Krebs binnen 20
Jahren gestiegen: Im Jahr 2023 starben mit 230
300 Menschen rund 10 % oder 21 000 Menschen mehr
an den Folgen von Krebs als 2003 mit 209 300
krebsbedingten Todesfällen.
Der Anstieg
dürfte jedoch vor allem auf die Alterung der
Bevölkerung zurückzuführen sein. Im Jahr 2023
starben in der Altersgruppe 80 Jahre und älter
knapp zwei Drittel (+64 %) mehr Menschen an
Krebs als noch 20 Jahre zuvor. Bei den jüngeren
Altersgruppen sind die Zahlen dagegen im selben
Zeitraum gesunken: prozentual am stärksten in
der Gruppe der unter 40-Jährigen (-32 %). Aber
auch in den Altersgruppen von 40 bis 59 Jahren
(-26 %) und von 60 bis 79 Jahren (-6 %) starben
im Jahr 2023 weniger Menschen als 20 Jahre
zuvor.
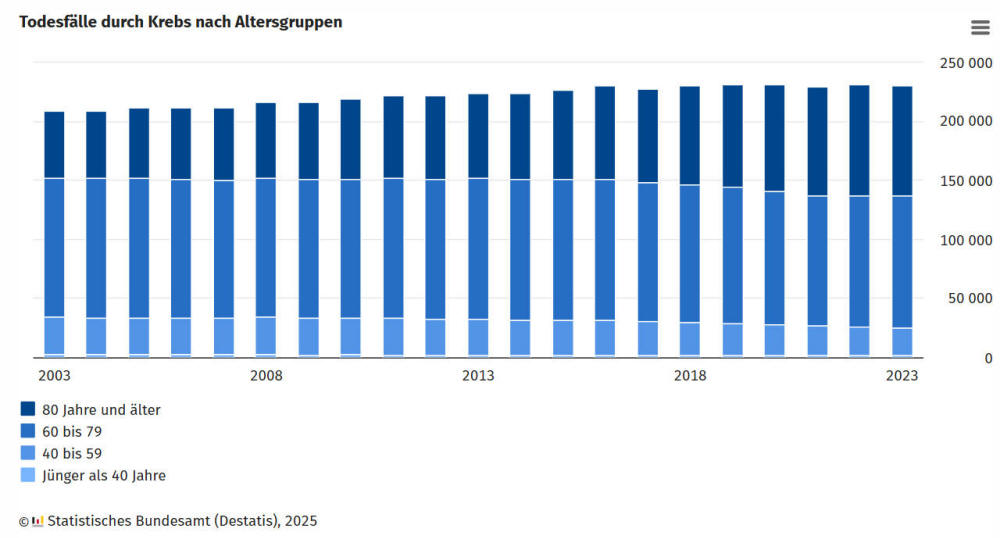
Krebs ist die zweithäufigste Todesursache
Der Anteil der an Krebs Verstorbenen an den
Todesfällen insgesamt ist zwischen 2003 und 2023
gesunken: von 25 % im Jahr 2003 auf 22 % im Jahr
2023. Krebs blieb dennoch auch im Jahr 2023 die
zweithäufigste Todesursache, nur an Krankheiten
des Kreislaufsystems starben mehr Menschen
(348 300 oder 34 % aller Todesfälle). 54 % der
an Krebs Verstorbenen waren Männer, 46 % Frauen.
Bei Menschen im Alter von 40 bis
74 Jahren war Krebs die häufigste Todesursache:
Mehr als jeder dritte Todesfall (36 %) in dieser
Altersgruppe war die Folge von
Krebserkrankungen.
Lungenkrebs ist die
Ursache für ein Fünftel aller krebsbedingten
Todesfälle Die häufigste krebsbedingte
Todesursache war wie in den Vorjahren Lungen-
und Bronchialkrebs mit 44 900 Todesfällen. Diese
Krebserkrankung allein war somit für ein Fünftel
(20 %) der krebsbedingten Todesfälle oder gut
4 % der Todesfälle insgesamt im Jahr 2023
ursächlich. Zu den häufigsten krebsbedingten
Todesursachen zählten zudem Darmkrebs
(24 100 Todesfälle), Bauchspeicheldrüsenkrebs
(19 400), Brustkrebs (18 700) und Prostatakrebs
(15 200).
NRW: Mehr als jeder Fünfte starb
2023 aufgrund einer Krebserkrankung
Im Jahr 2023 war Krebs (bösartige Neubildungen)
die Ursache für 22,6 Prozent aller Todesfälle in
Nordrhein-Westfalen. Zehn Jahre zuvor hatte
dieser Anteil noch bei 26,0 Prozent gelegen. Wie
dass Statistische Landesamt anlässlich des
Weltkrebstages am 4. Februar 2025 mitteilt,
starben 2023 insgesamt 51 186 Personen (27 048
Männer und 24 138 Frauen) an den Folgen einer
bösartigen Krebserkrankung.
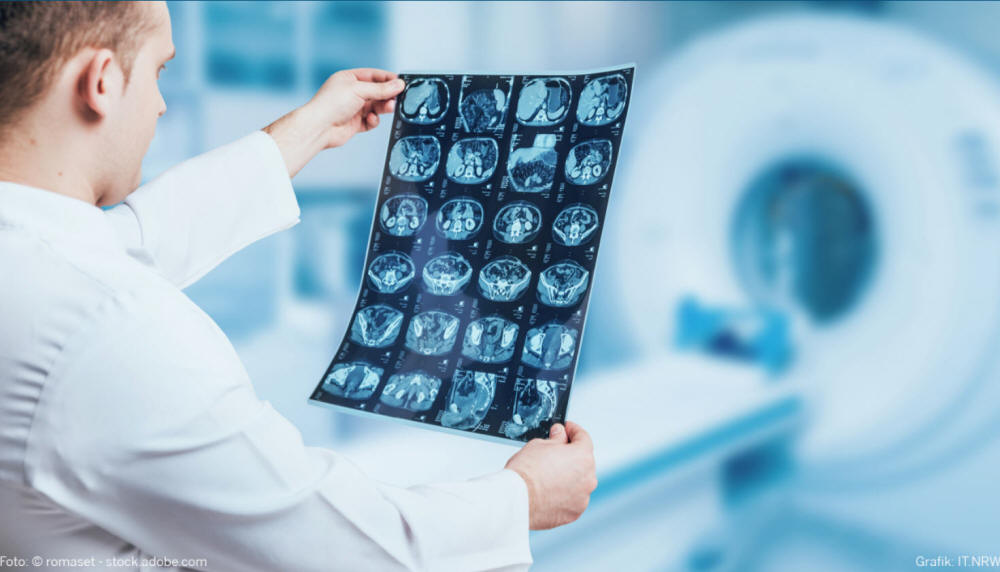
Das waren 0,9 Prozent weniger als ein Jahr
zuvor (2022: 51 653) und 1,7 Prozent weniger als
zehn Jahre zuvor (2013: 52 065). Das
durchschnittliche Sterbealter der an einer
Krebserkrankung Verstorbenen lag 2023 mit
75,1 Jahren um 4,3 Jahre niedriger als das aller
Verstorbenen (79,4 Jahre). Krebserkrankungen der
Verdauungsorgane häufigste krebsbedingte
Todesursache Unter den krebsbedingten
Todesfällen waren Krebserkrankungen der
Verdauungsorgane die häufigste Todesursache
(Männer: 30,8 Prozent, Frauen: 27,6 Prozent).
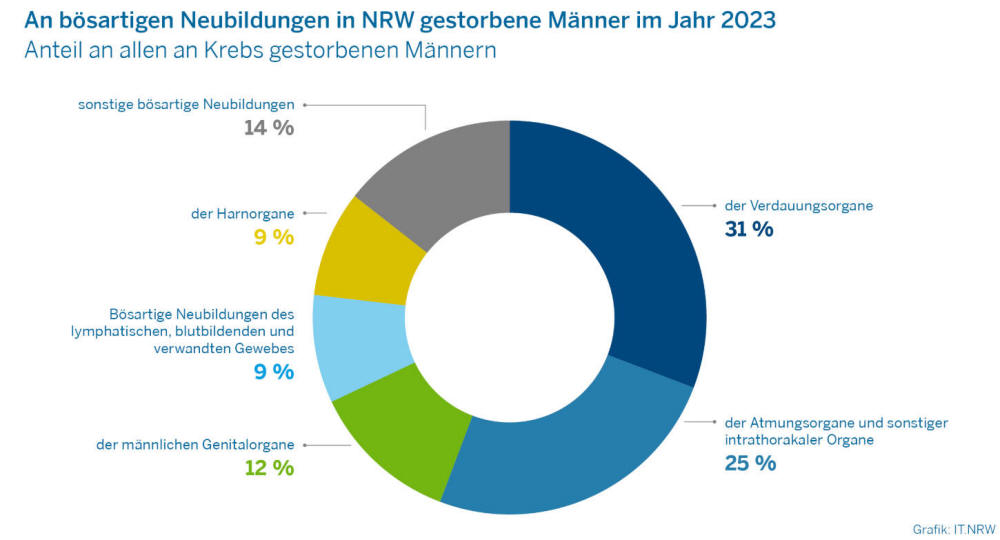
Die zweithäufigste Todesursache waren
Krebserkrankungen der Atmungsorgane und
sonstiger intrathorakaler Organe (Männer:
25,0 Prozent, Frauen: 20,2 Prozent). Die
dritthäufigste Form krebsbedingter Todesfälle
unterscheidet sich bei Männern und Frauen: Bei
Männern liegen bösartige Neubildungen der
männlichen Genitalorgane (12,2 Prozent) auf dem
dritten Rang; bei Frauen war es Brustkrebs
(17,3 Prozent).
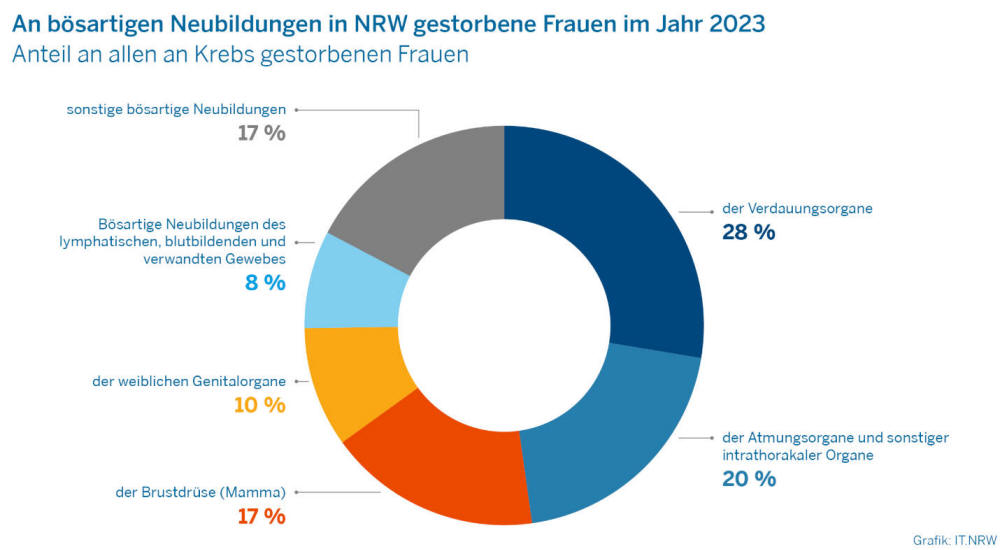
Geringste krebsbedingte Sterberate in
Münster Die kreisfreie Stadt Münster
verzeichnete 2023 die geringste krebsbedingte
Sterberate mit 204 Sterbefällen je 100 000
Einwohner. Die höchste Rate wurde mit 326
Sterbefällen je 100 000 Einwohner im Kreis
Recklinghausen ermittelt. Landesweit starben von
jeweils 100 000 Einwohnern 281 Personen an den
Folgen einer Krebserkrankung.
Montag, 3. Februar 2025
Für
lebendige Dörfer und Gemeinden: Landesregierung
unterstützt neue Projekte zur Stärkung des
ländlichen Raums
Die ländlichen
Räume abseits der großen Metropolen sind die
flächenmäßig bedeutendsten Regionen in
Nordrhein-Westfalen. Sie nehmen über zwei
Drittel der Landesfläche ein und sind Wohn- und
Lebensmittelpunkt für mehr als die Hälfte aller
Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens und
wichtiger Produktionsstandort für die Land- und
Forstwirtschaft, die frische Lebensmittel und
nachwachsende Rohstoffe erzeugt.
Zudem haben
die ländlichen Räume aufgrund ihrer Verbindung
zu den Ballungsräumen eine erhebliche Bedeutung
für Freizeit und Erholung – es bieten sich dort
auch gute Chancen im regionalen und
überregionalen Tourismus.
Die
Landesregierung setzt sich daher für die
Stärkung des ländlichen Raums und für lebendige
Dörfer und Gemeinden ein. Seit Regierungsantritt
sind über 40 Millionen Euro Landes- und
Bundesmittel in die Struktur- und
Dorfentwicklung geflossen. Jetzt ruft das Land
Nordrhein-Westfalen interessierte Dörfer,
Gemeinden, Vereine und weitere Einrichtungen
auf, Projektideen für das Jahr 2025
einzureichen.
Ministerin Silke Gorißen:
„Der ländliche Raum in Nordrhein-Westfalen ist
mit seinen Dörfern für viele Menschen Wohn- und
Lebensmittelpunkt. Deshalb investiert die
Landesregierung kontinuierlich in ihre
Zukunftsfähigkeit, damit sie lebenswert und
attraktiv bleiben. Davon profitieren Jung und
Alt, Vereine und Kommunen – für den Zusammenhalt
und die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen.
Auch im Jahr 2025 werden wir neue
Projekte zum Wohl der Menschen, unserer Dörfer,
Orte und Ortsteile unterstützen: Ich freue mich
auf neue oder modernisierte Gemeinschaftsräume,
auf kulturelle und soziale Treffpunkte und viele
Ideen, die zu mehr Lebensqualität vor Ort
beitragen.“

Foto Pixabay
Gefördert werden im Jahr
2025 Dorfläden, Dorfplätze, Bouleplätze,
Skater-Anlagen, Bolzplätze ebenso wie zum
Beispiel barrierefreie Umbauarbeiten von
Mehrfunktionshäusern oder Kultur-, Naherholungs-
und Tourismuseinrichtungen. Unterstützt wird
zudem eine Umnutzung land- oder
forstwirtschaftlicher Gebäude zur Stärkung des
dörflichen Lebens oder die Entwicklung von
IT-Lösungen, um die Infrastruktur im ländlichen
Raum zu verbessern. Projekte bis zu einer
Zuwendungshöhe von 250.000 Euro können gefördert
werden.
Ab dem 1. Februar 2025 wird über
die Bezirksregierungen das digitale
Antragsverfahren für die diesjährige Struktur-
und Dorfentwicklung gestartet. Interessierte
Gemeinden, Vereine und Einrichtungen können für
das Jahr 2025 bis zum 15. April 2025 Anträge
über die Internetseiten der Bezirksregierungen
einreichen.
Es wird empfohlen, dass
sich die Antragstellenden zwecks Klärung ihrer
Fördermöglichkeiten vor Einreichung eines
Förderantrages mit ihrer zuständigen
Bezirksregierung (Dezernat 33) in Verbindung
setzen.
Auf den Internetseiten der
Bezirksregierungen gibt es alle wichtigen
Informationen zum Förderaufruf:
Bezirksregierung Düsseldorf
An
reinen Landesmitteln stehen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt rund fünf Millionen Euro für das Jahr
2025 zur Verfügung. Es wird damit gerechnet,
dass im weiteren Verlauf des Kalenderjahres noch
zusätzliche Fördermittel über den Bund
hinzukommen, sobald ein neuer Bundeshaushalt
beschlossen ist.
Weitere Informationen finden
Sie auch auf der Internetseite des Ministeriums
für Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
Moers: Berichte über städtische
Baumaßnahmen im Ausschuss am 3. Februar
Aktuelle Berichte zu städtischen Baumaßnahmen
erhalten die Mitglieder des Ausschusses für
Bauen, Wirtschaft und Liegenschaften am Montag,
3. Februar. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im
Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1. Unter
anderem geht es um den Neubau und Sanierungen in
den Bereichen Sport, Schulen, Kitas, Kultur und
Feuerwehr. Die Verwaltung stellt auch die
Baumaßnahmen mit Fördermitteleinsatz vor.
Moers: Betreuer für die Tummelferien
gesucht
Viel Spiel, Spaß und Action
– doch ohne Betreuerinnen und Betreuer können
sie nicht stattfinden: Die ,Tummelferien‘ sind
die größte Moerser Ferienfreizeit und finden in
diesem Jahr vom 14. bis 30. Juli an den sechs
verschiedenen Spielpunkten statt. Hier können
bis zu 850 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren
eine tolle Zeit verbringen.

Auch die Betreuerinnen und Betreuer haben viel
Spaß an den Tummelferien.
Interessierte Jugendliche ab 16 Jahren können
sich ab sofort online bewerben und an einem der
6 Spielpunkte mit anpacken. Als Betreuer und
Betreuerinnen begleiten sie die Kinder bei den
verschiedenen Aktivitäten, Projekten, Spielen
und Aktionen und sorgen für Spaß. Deshalb sind
die wichtigsten Voraussetzungen: Freude am
Umgang mit Kindern, Motivation und Teamgeist.
Die Arbeit wird mit einer Aufwandsentschädigung
honoriert.
Auf der Website www.moers.de
(Stichwort ,Tummelferien‘) kann man sich online
als Betreuer für die Spielpunkte Innenstadt
(Freizeitpark), Kapellen (Spielhaus), Repelen
(ReKi), Eick (Jugendzentrum), Asberg (Asbär)
oder Meerbeck (Offene Einrichtung Römerstraße)
bewerben.
Weitere Infos: Telefon: 0 28 41 /
201-883, E-Mail:
tummelferien-innenstadt@moers.de.
Moers: Zustimmung für Streetwork-Konzept
und Gelder für das Jugendzentrum Eick
Sie treffen sich meist am Kreisgesundheitsamt an
der Mühlenstraße und ziehen dann zu
verschiedenen Orten in der Innenstadt. Die
Gruppe fällt durch Drogenkonsum und teilweise
laute, aggressive Gespräche auf. In einem
gemeinsamen Projekt wollen der Caritasverband
Moers – Xanten und die Grafschafter Diakonie
über Streetworker Zugang zu den Personen
bekommen und ihnen Hilfsangebote machen.
Der Jugendhilfeausschuss hat dem Konzept
am Donnerstag, 30. Januar, zugestimmt. Da sich
der Kreis Wesel zur Hälfte an der Finanzierung
beteiligen soll, muss vor dem Start dort auch
noch ein Beschluss gefasst werden. Sechs
Projekte im Rahmen des ‚Moerser Signal‘ – eine
Initiative gegen extremistische Tendenzen in der
Gesellschaft - erhalten eine finanzielle
Unterstützung, so eine weitere Entscheidung des
Jugendhilfeausschusses.
Dazu gehören
z. B. ein ‚Demokratisches Wochenende der
Jungpfadfinder‘, ‚Weltreligionen an der
Uhrschule‘ oder das Auschwitzprojekt am
Gymnasium Adolfinum. Das Kinder- und
Jugendzentrum Eick der evangelischen
Kirchengemeinde Rheinkamp erhält zunächst bis
zum Jahr 2027 Geld von der Stadt, lautet ein
einstimmiger Beschluss.
Für dieses
Jahr stehen knapp 118.000 Euro im Haushalt zur
Verfügung. Im Rahmen der Neustrukturierung der
Kirchengemeinde vor fünf Jahren hatte sich in
Eick der Arbeitsschwerpunkt der Kinder- und
Jugendarbeit gebildet. Neben dem bereits
vorhandenen Jugendkeller wurden auch die anderen
Räume des Gemeindehauses in Eick für Kinder- und
Jugendarbeit umgestaltet und genutzt. Das
Angebot ist sehr beliebt.
Moers:
Haushaltsfragen im Ausschuss
Haushalts- und Finanzierungsthemen stehen im
Mittelpunkt des nächsten Hauptausschusses. Er
findet am Mittwoch, 5. Februar, um 16 Uhr im
Ratssaal (Rathaus Moers) statt. Ein weiteres
Thema ist der Rettungsdienstbedarfsplan des
Kreises Wesel.
Mitmachausstellung „Mobilität: Unterwegs mit
Rädern, Flügeln und Raketen“ in der
Stadtbibliothek Dinslaken
Die
Stadtbibliothek Dinslaken lädt vom 11. Februar
bis 31. Oktober 2025 zur Mitmachausstellung
„Mobilität: Unterwegs mit Rädern, Flügeln und
Raketen“ ein. Besucher*innen erwartet eine
vielseitige Auseinandersetzung mit dem Thema
Mobilität – von historischen Entwicklungen bis
hin zu innovativen Technologien.
Wie
auch das Museum Voswinckelshof und das
Stadtarchiv widmet sich die Bibliothek in diesem
Jahr der Frage, wie Menschen, Waren und Ideen in
Bewegung kommen und welche Visionen die Zukunft
bereithält. Die Ausstellung ist im Bereich der
Kinderbibliothek entlang der Fenster sowohl von
außen als auch von innen sichtbar und lädt
Passant*innen sowie Bibliotheksbesucher*innen
ein, einen Blick darauf zu werfen.
Ein besonderes Highlight für Kinder ist der
Bausatz für ein kleines Auto, der direkt vor Ort
mit dem 3D-Drucker der Bibliothek hergestellt
wird. Für einen Unkostenbeitrag von 2 Euro
können Interessierte ihr eigenes Modellauto
zusammenbauen und kreativ gestalten. Zusätzlich
lädt die Kreativecke in der Kinderbibliothek
alle ein, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen:
Hier können kleine Autos, Flugzeuge oder Boote
gebastelt werden, um die Welt der Mobilität
spielerisch zu entdecken.
Darüber
hinaus bietet die Bibliothek das ganze Jahr 2025
über spannende Veranstaltungen rund um das Thema
Mobilität an. Die genauen Termine werden
rechtzeitig angekündigt. Ergänzt wird die
Ausstellung durch wechselnde Thementische, die
Mobilität aus unterschiedlichen Perspektiven
beleuchten.
Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen, die Ausstellung zu
besuchen, sich inspirieren zu lassen und
gemeinsam über die Mobilität von gestern, heute
und morgen nachzudenken. Das Projekt wird vom
Freundeskreis Stadtbibliothek und Stadtarchiv
Dinslaken e.V. unterstützt.
EU schiebt
missbräuchlicher Nutzung von KI den Riegel vor -
Neue Regeln treten am 2. Februar in Kraft
Die Europäische Union geht als weltweit Erster
gegen missbräuchliche Anwendungen Künstlicher
Intelligenz (KI) vor. Mit dem 2024
verabschiedeten KI-Gesetz („AI Act“) schafft die
EU verbindliche Regeln für den Einsatz von
KI-Systemen. Diese wirken sich mittlerweile auf
viele Lebensbereiche aus. Am 2. Februar treten
erste Regelungen in Kraft. Das Europäische
Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) erklärt,
was nun verboten ist.
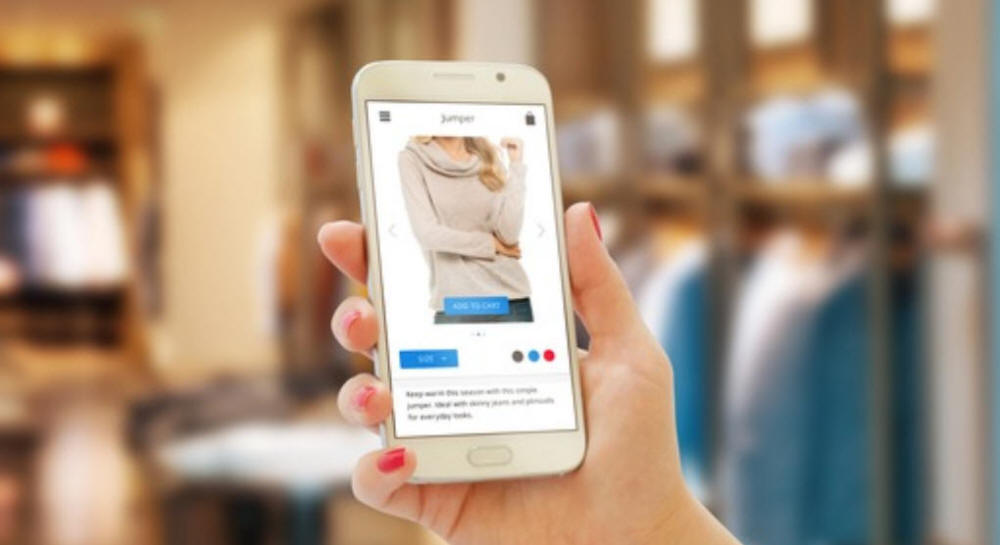
Auch beim Online-Shopping kann KI das
Kaufverhalten überwachen und beeinflussen /
Adobe Stock - Stanisic Vladimir
KI-Gesetz: Worum geht es?
Bereits seit 2018
schützt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
die Privatsphäre von Verbraucherinnen und
Verbrauchern in der EU. Doch der Einsatz
ausgefeilter Künstlicher Intelligenz hat die
Karten neu gemischt. KI-Systeme analysieren
heute Internet-Suchen, Kaufverhalten und
persönliche Daten, oft in Echtzeit, und häufig
ohne das Wissen der Betroffenen.
Die
anstehende Bundestagswahl gab Anlass zur Warnung
vor KI-generierten Desinformationskampagnen und
Deepfakes. Also zum Beispiel echt wirkende
Videos, in denen bekannten Politikern Sätze in
den Mund gelegt werden, die sie nie sagen
würden. Aber auch andere bekannte Personen des
öffentlichen Lebens, wie Sänger oder
Schauspielerinnen, werben in künstlich
erstellten Werbeclips im Internet für
verschiedenste Produkte.
Für die
europäischen Gesetzgeber besteht die
Herausforderung darin, Verbraucherrechte zu
schützen, ohne den technischen Fortschritt und
die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stark
einzuschränken. 2024 wurde das EU Gesetz zur
künstlichen Intelligenz („AI Act“)
verabschiedet. Es gilt unmittelbar in allen
Mitgliedstaaten und wird bis 2026 schrittweise
umgesetzt. Die Regelungen betreffen alle
Unternehmen weltweit, die KI-Systeme in der EU
entwickeln, verkaufen oder nutzen. Sie schützen
somit alle Verbraucherinnen und Verbraucher in
Europa.
Verbotene KI-Anwendungen ab
dem 2. Februar 2025
Das sogenannte „Social
Scoring“ („soziale Bewertung“) wird ab dem 2.
Februar verboten. Ein Beispiel: Wer eine
Ferienwohnung in Rom mieten möchte, könnte von
einer Buchungsplattform aufgrund seines
Social-Media-Verhaltens als „unzuverlässig“
eingestuft werden – etwa, weil frühere Beiträge
auf wilde Partys hinweisen. Den Zuschlag für die
Wohnung bekommt dann ein anderer Nutzer.
Unternehmen dürfen Verbraucherinnen und
Verbraucher aber nicht aufgrund ihres sozialen
oder wirtschaftlichen Verhaltens benachteiligen.
Weitere missbräuchliche KI-Praktiken,
die ab sofort untersagt sind:
Manipulative
Systeme, die Verbraucher beeinflussen, um sie zu
finanziellen Verpflichtungen zu verleiten (z. B.
gefälschte KI-generierte Videos, die zu
riskanten Investitionen animieren).
KI-Systeme, die gezielt Kinder oder andere
besonders schutzbedürftige Gruppen ausnutzen,
etwa durch psychologische Tricks, um
In-App-Käufe zu fördern.
Alexander Wahl,
Jurist im Europäischen Verbraucherzentrum
Deutschland (EVZ) begrüßt das Inkrafttreten des
Gesetzes: „Der AI Act der EU schützt Verbraucher
vor missbräuchlicher Nutzung von KI, indem er
manipulative und diskriminierende Praktiken
verbietet. Verbraucher müssen künstlicher
Intelligenz (KI) vertrauen können. Es braucht
aber nicht nur klare Regeln, sondern auch eine
starke Kontrolle. Nur so kann KI sicher und fair
für alle sein.“
KI-Kennzeichnungspflicht
ab 2026
Ab dem 2. August 2026 wird das
KI-Gesetz weiter verschärft. Dann gilt eine
Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte
– egal ob Video, Audio, Bild oder Text.
Verbraucherinnen und Verbraucher müssen es klar
erkennen können, wenn Inhalte durch KI erstellt
oder manipuliert wurden, beispielsweise durch
ein Wasserzeichen auf Videos. Unternehmen, die
sich nicht an die neuen Regeln halten, drohen
Strafen von bis zu 35 Millionen Euro oder 7
Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes.
Alle Infos zum Klever
Karneval 2025: Glasverzicht, Regelungen,
Termine, Zugwege und Sperrungen
Mehr
Spaß ohne Glas: für mehr Sicherheit und
gegenseitige Rücksichtnahme im Klever Karneval.

Kampagnenbild "Mehr Spaß ohne Glas!"
In
den kommenden Wochen stehen im Klever
Stadtgebiet wieder zahlreiche karnevalistische
Aktivitäten an. Damit alle Besucherinnen und
Besucher die Veranstaltungen unbeschadet und bei
bester Laune genießen können, sind auch in
diesem Jahr wieder verschiedene
ordnungsbehördliche Maßnahmen und Regelungen
notwendig.
Insbesondere möchte die Stadt
Kleve auf die Kampagne „Mehr Spaß ohne Glas!“
hinweisen. Gemeinsam mit dem Klever
Rosenmontags-Komitee e.V. und der Polizei Kleve
wird in den sozialen Medien dazu aufgerufen, zum
Rathaussturm und zum Rosenmontag auf
Glasbehältnisse jeglicher Art zu verzichten.
In den vergangenen Jahren war leider immer
wieder festzustellen, dass Glasscherben und
herumliegende Glasbehältnisse nicht nur für
Zugwagen und Einsatzfahrzeuge, sondern auch für
Fußgruppen sowie Besucherinnen und Besucher der
Züge gefährlich werden können.
Nach dem
Aufruf zum Glasverzicht in den letzten beiden
Jahren ist die Menge an Glas bereits deutlich
zurückgegangen – mit der Hilfe aller
Karnevalistinnen und Karnevalisten hoffen die
beteiligten Organisationen, die Menge in diesem
Jahr weiter reduzieren zu können.
Die
Regelungen zum Klever Karneval 2025 im Überblick
Folgende Regelungen gelten im Rahmen der
anstehenden karnevalistischen Aktivitäten:
1.
Es wird darum gebeten, auf Glas am Rand des
Zugweges (Rathaussturm am 01.03. und
Rosenmontagszug am 03.03.2025) zu verzichten.
2. Es wird darum gebeten, die Lautstärke auf den
Wagen beim Rosenmontagszug auf einen „normalen
Bereich“ zu reduzieren.
3. Der Konsum von
Cannabis ist im Bereich des Zugweges
(Rathaussturm am 01.03. und Rosenmontagszug am
03.03.2025) verboten.
4. Das Abbrennen und
der Verkauf von Feuerwerkskörpern sind nicht
gestattet.
5. In Gaststätten, Verkaufsstellen
oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen
-
Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder
Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur
geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und
Jugendliche,
- andere alkoholische Getränke
an Kinder oder Jugendlichen unter 16 Jahren
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr
gestattet werden.
6. Der Aufenthalt in
Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter
16 Jahren nur gestattet werden, wenn eine
personensorgeberechtigte oder
erziehungsberechtigte Person sie begleitet oder
wenn sie in der Zeit zwischen 05.00 und 23.00
Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen.
Jugendliche ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in
Gaststätten ohne Begleitung einer
personensorgeberechtigten oder
erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von
24.00 Uhr bis 05.00 Uhr morgens nicht gestattet
werden.
7. Die Anwesenheit bei
öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung
einer personensorgeberechtigten oder
erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und
Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und
Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24.00
Uhr gestattet werden.
Rathaussturm am
Samstag, dem 01.03.2025
Der Rathaussturm
findet auf dem Parkbereich Rathaus/
Kavarinerstraße statt.
Ab 10.15 Uhr wird am
Narrenbrunnen (Parkbereich Kleiner Markt) die
Veranstaltung beginnen.
Gegen 11.11 Uhr
beginnt dort der Festumzug über Kleiner Markt –
Propsteistraße – Hagsche Straße – Große Straße –
Kavarinerstraße – bis zum Vorplatz des
Rathauses, wo dann der eigentliche Rathaussturm
stattfindet.
Erwartet werden ca. 500
Personen, davon im Umzug ca. 300 Personen.
Wegen der Auf- und Abbauarbeiten werden
Teilflächen auf dem Rathausvorplatz gesperrt.
Rosenmontagszug am Montag, dem 03.03.2025
Der Rosenmontagszug beginnt wieder im Ortsteil
Kellen, und zwar auf der Emmericher Straße, und
endet auf der Hoffmannallee am Kreuzungsbereich
Albersallee/ Königsallee/ Materborner Allee.
Der Zug beginnt planmäßig um 12.11 Uhr. Das
interne Vorbeifahren des Zuges, beginnend mit
dem Spitzenfahrzeug, findet in der Zeit vom
11.30 Uhr bis 12.11 Uhr auf der Emmericher
Straße, zwischen dem Postdeich und der
Steinstraße statt. Die Aufstellung der
Zugteilnehmer erfolgt ab 10.00 Uhr auf der
Emmericher Straße, im Bereich zwischen der
Kreuzung Steinstraße/ Lindenstraße und der
Kreuzung Postdeich/ Wilhelmstraße.
Der
Zugweg verläuft über die Emmericher Straße –
Wiesenstraße – Bensdorpstraße – Herzogstraße –
Große Straße – Hagsche Straße – Hoffmannallee.
Aufgrund des Rosenmontagszuges sind die
nachfolgenden verkehrsregelnden und
verkehrslenkenden Maßnahmen erforderlich:
Ab 10.00 Uhr werden wegen der Aufstellung
des Zuges die nachfolgenden Straßen gesperrt:
Emmericher Straße, im Bereich zwischen dem
Klever Ring und dem Postdeich in beiden
Fahrtrichtungen. Die Umleitung erfolgt über die
Kreuzhofstraße. Die Emmericher Straße kann an
den Kreuzungen überquert werden. Das Befahren
der Emmericher Straße ist ab 10.00 Uhr nicht
mehr zulässig. Die Anfahrt zum Parkplatz bei
Aldi kann ab 10.00 Uhr nur über die Lindenstraße
und über die Briener Straße/ Sonnenweg/
Steinstraße erfolgen.
Ab 12.00 Uhr (je
nach Fußgängeraufkommen) werden die
nachfolgenden Straßen für den
Kraftfahrzeugverkehr gesperrt:
Emmericher
Straße (Klever Ring bis Wiesenstraße) –
Wiesenstraße – Bensdorpstraße – Bahnhofstraße
(ab Bahnhofsplatz Fahrtrichtung Wiesenstraße) –
Hafenstraße (ab Kreisverkehr Ludwig-Jahn-Straße)
– Minoritenstraße (ab Deutsche Bank) –
Herzogstraße – Große Straße – Hagsche Straße
Während des Zeitraumes der Straßensperrungen
in den vorgenannten Bereichen sind entsprechende
Umleitungsstrecken über die Wilhelmstraße/
Kreuzhofstraße – Klever Ring – Uedemer Straße –
Nassauerallee – Lindenallee – Gruftstraße
eingerichtet. An den Hauptzufahrtstraßen sind
Hinweisschilder aufgestellt.
Ab 13.30 Uhr
(je nach Fußgängeraufkommen) werden die
nachfolgenden Straßen für Fahrzeuge aller Art
gesperrt:
Hoffmannallee – Materborner
Allee (Bereich zwischen der Albersallee/
Königsallee und der Kapellenstraße). Die Zufahrt
zu den Supermärkten ist sichergestellt.
Wegen der Einrichtung der Umleitungsstrecke über
die Lindenallee u.a. bleibt der Kreuzungsbereich
Linde möglichst lange für den
Kraftfahrzeugverkehr geöffnet. Während des
Zeitraumes der Straßensperrung (und Sperrung des
Kreuzungsbereichs Linde) verläuft die
Umleitungsstrecke über den Klever Ring -
Emmericher Straße – Kreuzhofstraße –
Wilhelmstraße, sowie für den
Kraftfahrzeugverkehr aus Fahrtrichtung Emmerich/
A 3 über den Oraniendeich – Nordtangente –
Tweestrom. Entsprechende Hinweistafeln sind an
den Hauptzufahrtstraßen aufgestellt.
Aufgrund des Rosenmontagszuges sind im Bereich
der Wilhelmstraße, der Kreuzhofstraße, der
van-den-Bergh-Straße, der Emmericher Straße, der
Bensdorpstraße, der Hagschen Straße und der
Hoffmannallee Haltverbote eingerichtet. Sollten
in den eingerichteten Haltverbotszonen oder
innerhalb der Fußgängerzonen widerrechtlich
Fahrzeuge abgestellt werden, so werden diese
durch die Ordnungsbehörde auf Kosten des Halters
abgeschleppt. Für die Bediensteten der
Fachbereiche Öffentliche Sicherheit und Ordnung
und Jugend- und Familie der Stadt Kleve besteht
Rufbereitschaft. Diese sind über die
Polizeiwache Kleve, Telefon: 50 40, zu
erreichen.
Die Verkehrslenkung und
Verkehrsregelung wird durch die Beamten der
Polizei, Direktion Verkehr, in Zusammenarbeit
mit dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit und
Ordnung der Stadt Kleve und dem Ordnungsdienst
des Veranstalters durchgeführt.
Zuwiderhandlungen gegen die vorgenannten
gesetzlichen Bestimmungen stellen eine
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße
geahndet werden kann. Die Polizei und der
Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
der Stadt Kleve werden verstärkte Kontrollen
durchführen.
Der
Bundeswahlausschuss hat über Beschwerden zu
Landeslisten entschieden
Der
Bundeswahlausschuss hat sich am 30. Januar in
einer öffentlichen Sitzung mit insgesamt 37
Beschwerden befasst. Eine verfristete Beschwerde
ging noch nach der Veröffentlichung der
Pressemitteilung bei der Bundeswahlleiterin ein.
27 der 37 Beschwerden wurden zurückgewiesen;
insoweit wurden die Entscheidungen der
Landeswahlausschüsse vom 24. Januar 2025
bestätigt:
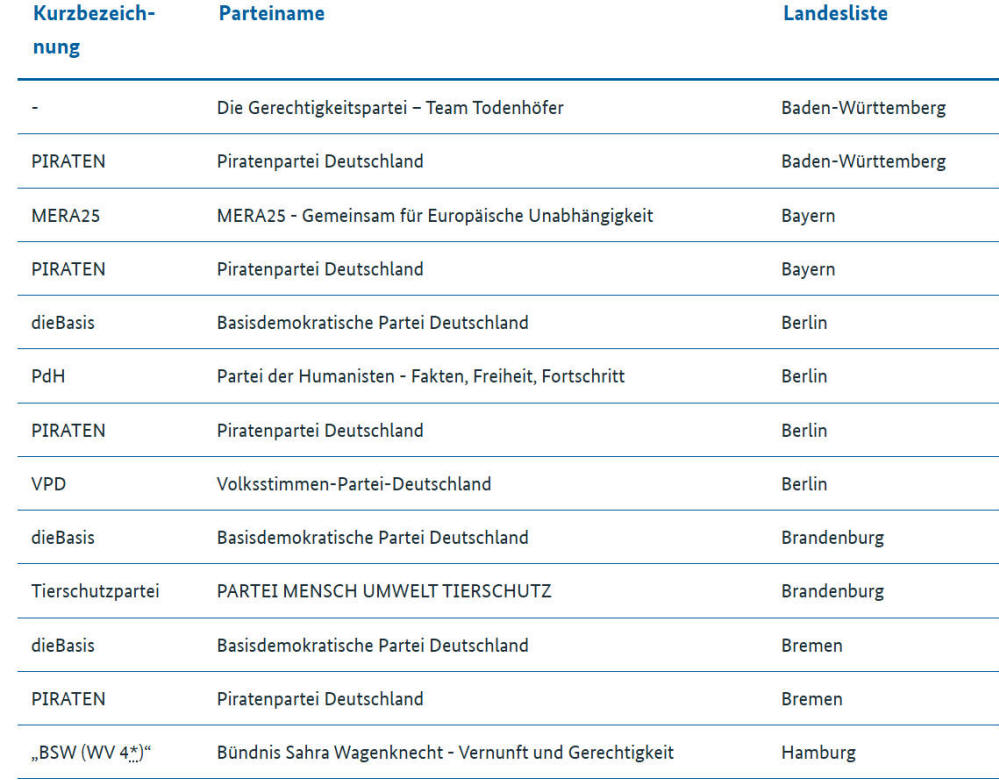
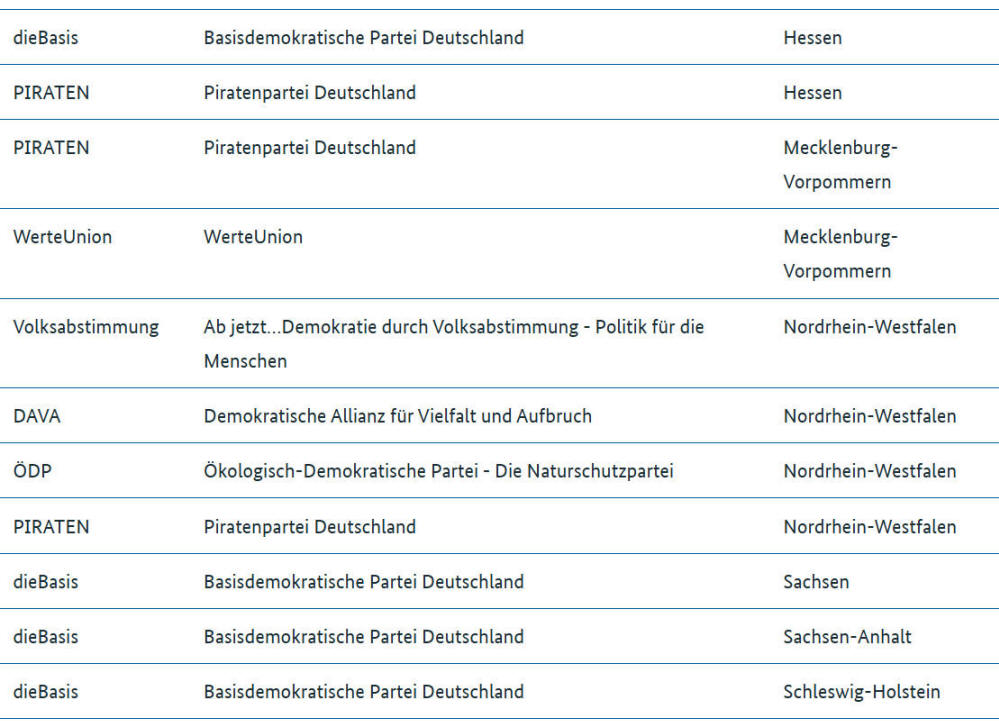
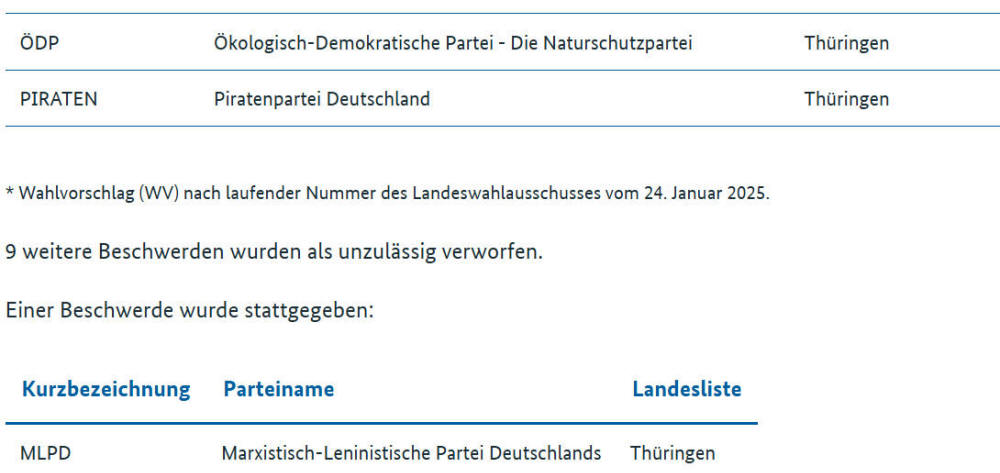
Kleve: Mataré-Workshop „Schreiben im Museum“ mit
Kathrin Klug
Als Begleitprogramm zur großen
Sonderausstellung „Ewald Mataré: KOSMOS“ findet
am Samstag, dem 8. Februar 2025 von 11 bis 14
Uhr der Workshop „Schreiben im Museum“ von und
mit Kathrin Klug statt. Der Workshop richtet
sich gezielt an Erwachsene jeden Alters. Die
Teilnahme am Workshop ist aus Anlass der
Ausstellung frei. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen, teilzunehmen und lebendig
zu partizipieren.

Worum geht’s?
Ins Gespräch kommen mit der
Kunst, mit sich und der Welt.
Schreiben im
Museum ist vielleicht eine der kostbarsten
Möglichkeiten aus dem Alltag auszusteigen und in
den Kosmos der Kunst, diesmal in den von Ewald
Mataré einzusteigen. Nach einer ersten
Schreibübung widmen sich die Teilnehmerinnen den
Werken Matarés und lassen sich zu kleinen Texten
inspirieren.
Schreibdozentin Kathrin
Klug steht mit Rat und Tat zu Seite. Die
Miniaturen, Dialoge und Gedichte können
anschließend in der Runde vorgestellt werden, so
dass alle an dem Gesehenem und Erfahrenen Freude
haben. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich,
lediglich Freude und Mut am Schreiben und an der
Kunst.
Über die Dozentin
Kathrin Klug
ist Historikerin und Dozentin an der Hochschule
in Bremen für Kunst und Kulturvermittlung. Seit
2003 arbeitet sie für StattReisen Bremen, wo sie
den Stadtvermittlungsbereich für Kinder und
Jugendliche aufgebaut hat.
Darüber
hinaus ist sie als Kunstvermittlerin in den
Bremer und Worpsweder Museen tätig. Seit 2018
entwickelt sie in der „Großen Kunstschau
Worpswede“ zusammen mit Angelika Sinn und Janine
Lancker das Format „Schreiben im Museum“.
„Luft nach oben –
Was Sie für Ihre Lunge tun können.“:
Hybridveranstaltung des Lungen- und
Thoraxzentrums Nordrhein am Krankenhaus
Bethanien am 12.02.2025
Experten-Vorträge, Angebote und Austausch rund
ums Thema Lungengesundheit online und vor Ort
Am 12. Februar 2025 lädt das Lungen- und
Thoraxzentrum Nordrhein am Krankenhaus Bethanien
Moers alle Interessierten zur
Hybridveranstaltung „Luft nach oben – Was Sie
für Ihre Lunge tun können.“ ein.
Die
Veranstaltung findet wahlweise online oder vor
Ort in der Bethanien Akademie (Bethanienstraße
15, 47441 Moers, Seminarraum 1 bis 3) von 16 bis
18.30 Uhr statt. In den Experten-Vorträgen,
die um 16 Uhr starten, dreht sich alles um die
Bereiche „Neues beim Lungenkrebs – Vom
Nobelpreis ins Ruhrgebiet“, „30 Jahre
Lungenvolumenreduktion – Was gibt es Neues in
der Emphysemtherapie“, „E-Zigarette und
Krebsrisiko“, „Smartwatch bei
Lungenerkrankungen“ und „COVID 2024“.
Darüber hinaus haben Teilnehmer:innen unter
anderem die Möglichkeit, im Seminarraum 1 der
Bethanien Akademie einen Lungenfunktionstest
sowie einen Schlafapnoe-Risiko-Check zu machen.
Bei verschiedenen Selbsthilfegruppen und
Kooperationspartner:innen können sie sich
informieren und beraten lassen – beispielsweise
zu Optionen, die dabei helfen, rauchfrei zu
werden.
Durch die gemeinsame
Veranstaltung des Krankenhauses Bethanien Moers,
des Alfried Krupp Krankenhauses in Essen und des
Evangelischen Krankenhauses in Mülheim sollen
Betroffene und An- sowie Zugehörige über neue
Trends bei Lungenerkrankungen informiert und ein
Austausch mit anderen Teilnehmer:innen sowie den
Expert:innen des Lungen- und Thoraxzentrums
Nordrhein ermöglicht werden.
Für
die Online-Teilnahme an der Veranstaltung wird
um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an
lzm@bethanienmoers.de gebeten, damit der
entsprechende Zugangslink versendet werden kann.
Bei einer Teilnahme vor Ort ist keine Anmeldung
erforderlich.

Das Lungen- und Thoraxzentrum Nordrhein am
Krankenhaus Bethanien Moers lädt in
Zusammenarbeit mit dem Alfried Krupp Krankenhaus
in Essen und dem Evangelischen Krankenhaus in
Mülheim zu einer Hybridveranstaltung rund um
Lungengesundheit ein.

Erwerbstätigkeit im Dezember 2024
stagniert
0,0 % zum Vormonat
(saisonbereinigt)
-0,3 % zum Vormonat (nicht
saisonbereinigt)
-0,1 % zum Vorjahresmonat
Im Dezember 2024 waren rund 46,0
Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die
Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt
gegenüber dem Vormonat unwesentlich um 4 000
Personen (0,0 %).
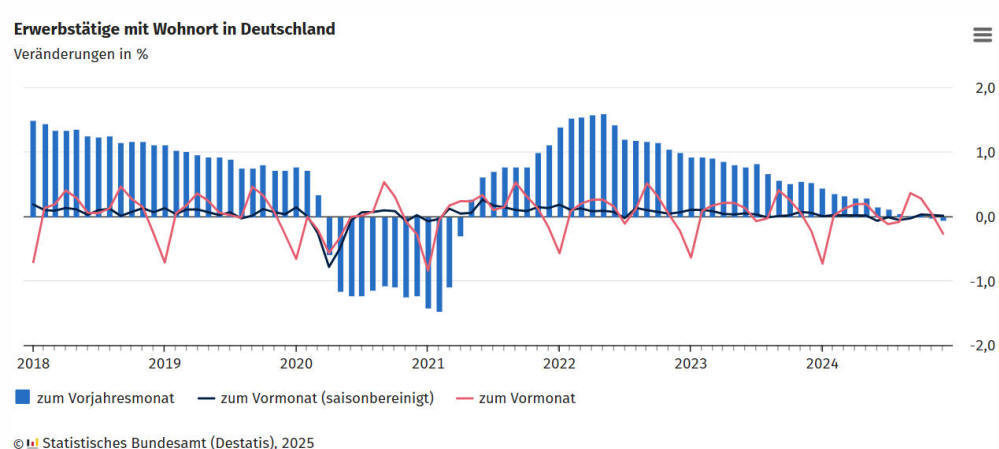
Im Oktober und November war die
Erwerbstätigkeit um 13 000 beziehungsweise 9 000
Personen noch etwas stärker angestiegen. Damit
entwickelte sich die Beschäftigung nach den
saisonbereinigten Rückgängen in den Monaten Juni
bis September 2024 von durchschnittlich jeweils
20 000 zuletzt wieder etwas positiver.
Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der
Erwerbstätigen im Dezember 2024 gegenüber
November 2024 um 125 000 Personen (-0,3 %) ab.
Dieser Rückgang gegenüber dem Vormonat fiel
stärker aus als im Dezember-Durchschnitt der
Jahre 2022 und 2023 (‑104 000 Personen).
Entwicklung der Erwerbstätigkeit kühlt sich
ab
Gegenüber Dezember 2023 sank die Zahl
der Erwerbstätigen im Dezember 2024 um
24 000 Personen (-0,1 %). In den Monaten
September, Oktober und November hatten die
Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr bei
jeweils 0,0 % gelegen, im Juni 2024 lag sie noch
bei +0,2 %. Die Abkühlung der
Beschäftigungsentwicklung setzt sich somit
weiter fort; die Zahl der Erwerbstätigen liegt
inzwischen leicht unter dem Vorjahresniveau.
Erwerbstätigenzahl im 4. Quartal
2024 saisonbereinigt unverändert gegenüber dem
Vorquartal
Im Durchschnitt des 4. Quartals
2024 gab es nach vorläufigen Berechnungen rund
46,3 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in
Deutschland (Inlandskonzept). Im Vergleich zum
Vorquartal blieb die Zahl der Erwerbstätigen
saisonbereinigt unverändert (+1 000 Personen;
0,0 %). Ausführliche Ergebnisse zum 4. Quartal
2024 erscheinen am 18. Februar 2025.
Bereinigte Erwerbslosenquote im Dezember
2024 bei 3,4 %
Im Dezember 2024 waren nach
Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung
1,44 Millionen Personen erwerbslos. Das waren
129 000 Personen oder 9,9 % mehr als im Dezember
2023. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,2 %
(Dezember 2023: 2,9 %). Bereinigt um saisonale
und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl
im Dezember 2024 bei 1,52 Millionen Personen und
damit nur geringfügig höher als im Vormonat
November 2024 (+2 000 Personen; +0,1 %). Die
bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich
zum Vormonat unverändert bei 3,4 %.
7,7 % mehr Fluggäste im Jahr 2024
• Mit 199,5 Millionen Fluggästen
blieb die Passagierzahl an den deutschen
Hauptverkehrsflughäfen 12,0 % niedriger als im
Rekordjahr 2019
• Innerdeutscher Luftverkehr
im Vergleich zu 2019 trotz steigender Tendenz
weiterhin auf deutlich niedrigerem Niveau (-48,5
%) als der Auslandsverkehr (-7,8 %)
•
Luftfrachtaufkommen im Vorjahresvergleich um 2,1
% gestiegen und damit nur 0,2 % unter dem
Vor-Corona-Niveau
Im Jahr 2024 haben die
22 deutschen Hauptverkehrsflughäfen rund 199,5
Millionen Fluggäste gezählt. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind
damit 7,7 % mehr Passagierinnen und Passagiere
von den Flughäfen gestartet oder gelandet als im
Jahr 2023.
Gegenüber dem Vor-Corona- Niveau
des Jahres 2019, als die Flughäfen mit 226,7
Millionen Fluggästen ein Allzeithoch verzeichnet
hatten, lag das Passagieraufkommen im Jahr 2024
um 12,0 % niedriger. Dabei wurden weiterhin
deutlich weniger Inlandsflüge unternommen als
vor der Corona-Pandemie, während sich der
Auslandsverkehr dem Vor-Corona-Niveau stärker
annäherte.
Knapp halb so viele
Fluggäste auf Inlandsflügen wie vor der
Corona-Pandemie
Während der Flugverkehr mit
dem Ausland im Jahr 2024 um 8,0 % gegenüber dem
Vorjahr auf 173,7 Millionen Fluggäste zulegte,
stieg die Fluggastzahl auf Inlandsflügen
lediglich um 3,7 % auf 11,9 Millionen Personen.
Damit verfestigte sich eine Entwicklung, die
bereits in den Jahren 2021, 2022 und 2023 zu
beobachten war.
In diesen Jahren
hatte sich der Auslandsverkehr insgesamt besser
entwickelt als der innerdeutsche Verkehr,
nachdem die Fluggastzahlen im ersten
Corona-Jahr 2020 in
beiden Bereichen gleich stark um jeweils 75 %
eingebrochen waren. Danach stieg der
Auslandsverkehr bereits im Jahr 2021 wieder an
und näherte sich seither stark dem
Vor-Corona-Niveau, wohingegen der innerdeutsche
Verkehr 2021 zunächst weiter zurückging und
seither deutlich schwächer zunahm als der
Verkehr mit dem Ausland.
So war die
Zahl der Fluggäste im innerdeutschen Luftverkehr
im Jahr 2024 noch immer um fast die Hälfte
(-48,5 %) niedriger als im Vor-Corona-Jahr 2019.
Die Zahl der Fluggäste im Auslandsverkehr lag
dagegen nur um 7,8 % unter dem
Vor-Corona-Niveau.
Luftfrachtaufkommen
nahezu auf Vorkrisenniveau
Anders als im
Passagierverkehr hat das Luftfrachtaufkommen im
Jahr 2024 das Vor-Corona-Niveau fast wieder
erreicht: Mit 4,7 Millionen Tonnen wurde im Jahr
2024 an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen
2,1 % mehr Fracht transportiert als im Jahr 2023
(4,6 Millionen Tonnen). Im Vergleich zum Jahr
2019 (4,7 Millionen Tonnen) war das
Luftfrachtaufkommen damit lediglich um 0,2 %
geringer.
|














 © Initiative Bienen machen Schule, Foto_Daniel
Saarschmidt) Initiative Bienen machen Schule
© Initiative Bienen machen Schule, Foto_Daniel
Saarschmidt) Initiative Bienen machen Schule